Phantastische Gesellschaft
Gespräche über falsche und imaginierte Familiengeschichten zur NS-Verfolgung

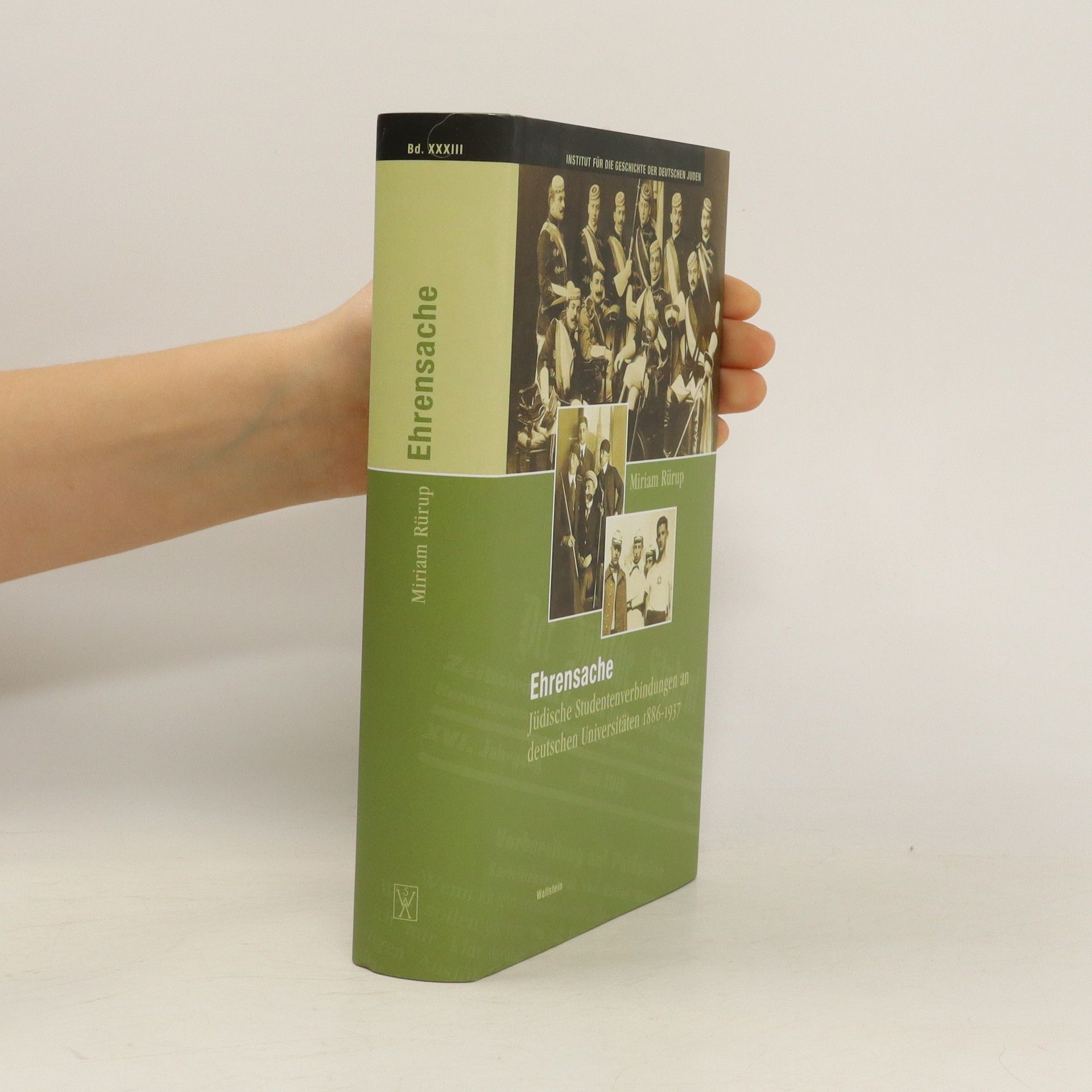


Gespräche über falsche und imaginierte Familiengeschichten zur NS-Verfolgung
Das erste Bethaus, das Hamburger Juden sich erbauten, war der Tempel in der Poolstrasse. Ein eindrucksvoller, eleganter und repräsentativer Bau. Bisher fanden die jüdischen Gottesdienste in Bestandsbauten statt, die dem Zweck durch Umbauten angepasst wurden und nach außen nicht auffielen. Der Tempel, der Begriff Synagoge wurde bewusst nicht gewählt, war aber nicht nur ein modernes Bethaus, sondern eine der Keimzellen des Reformjudentums, das bis heute weite Teile des jüdischen Lebens - vor allem in der Diaspora - gestaltet. Diese überragende Bedeutung des Tempels verbunden mit dem glücklichen Umstand, dass er den Zerstörungen der Pogromnacht entging und auch nach starken Kriegsschäden nicht völlig abgerissen, sondern umgenutzt wurde, sollte zu einem neuen Ansatz im Umgang mit seiner erhaltenen Substanz führen.
Jüdische Studentenverbindungen an deutschen Universitäten 1886-1937
Jüdische Studentenverbindungen als Orte der deutsch-jüdischen Identitätsfindung. Als Reaktion auf die zunehmende Ausgrenzung aus den traditionellen deutschen Studentenverbindungen gründeten jüdische Studenten 1886 die erste eigene Korporation. Die in der Folge entstehenden jüdischen Verbindungen übernahmen die traditionellen verbindungsstudentischen Formen: Sie legten Farben an, trugen bei Feierlichkeiten die studentische Uniform, den Wichs, sangen »auf ihren Kneipen« studentische Lieder und bildeten einen »Lebensbund«. Vor allem der Ehrbegriff und die Wehrhaftigkeit nahmen in der verbandsinternen Erziehung eine wichtige Rolle ein. Durch Mensur und Fechtübungen sollte die Anerkennung seitens der nichtjüdischen Studenten erreicht werden. Miriam Rürup untersucht in ihrer Arbeit vor allem die Vielfalt der Zugehörigkeiten und Selbstbeschreibungen innerhalb der Verbindungen. Sollten sich die Mitglieder der verschiedenen Verbände als deutsch, deutsch-jüdisch, jüdisch, zionistisch oder jüdisch-national verstehen? Vor der Folie der deutschen verbindungsstudentischen Tradition ergeben sich so ganz neue Aspekte der deutsch-jüdischen Identitätsfindung.
Focusing on the social history of modern German Jews from the late 18th century to post-World War II, the book examines their rise to middle and upper middle-class status amidst challenges and self-assertion. It highlights the transformative effects of emancipation on Jewish life and demographics, while exploring daily interactions between Jews and non-Jews in various aspects of life, such as housing, profession, and education. This analysis sheds light on the complex dynamics of integration and exclusion faced by the Jewish community in Germany.