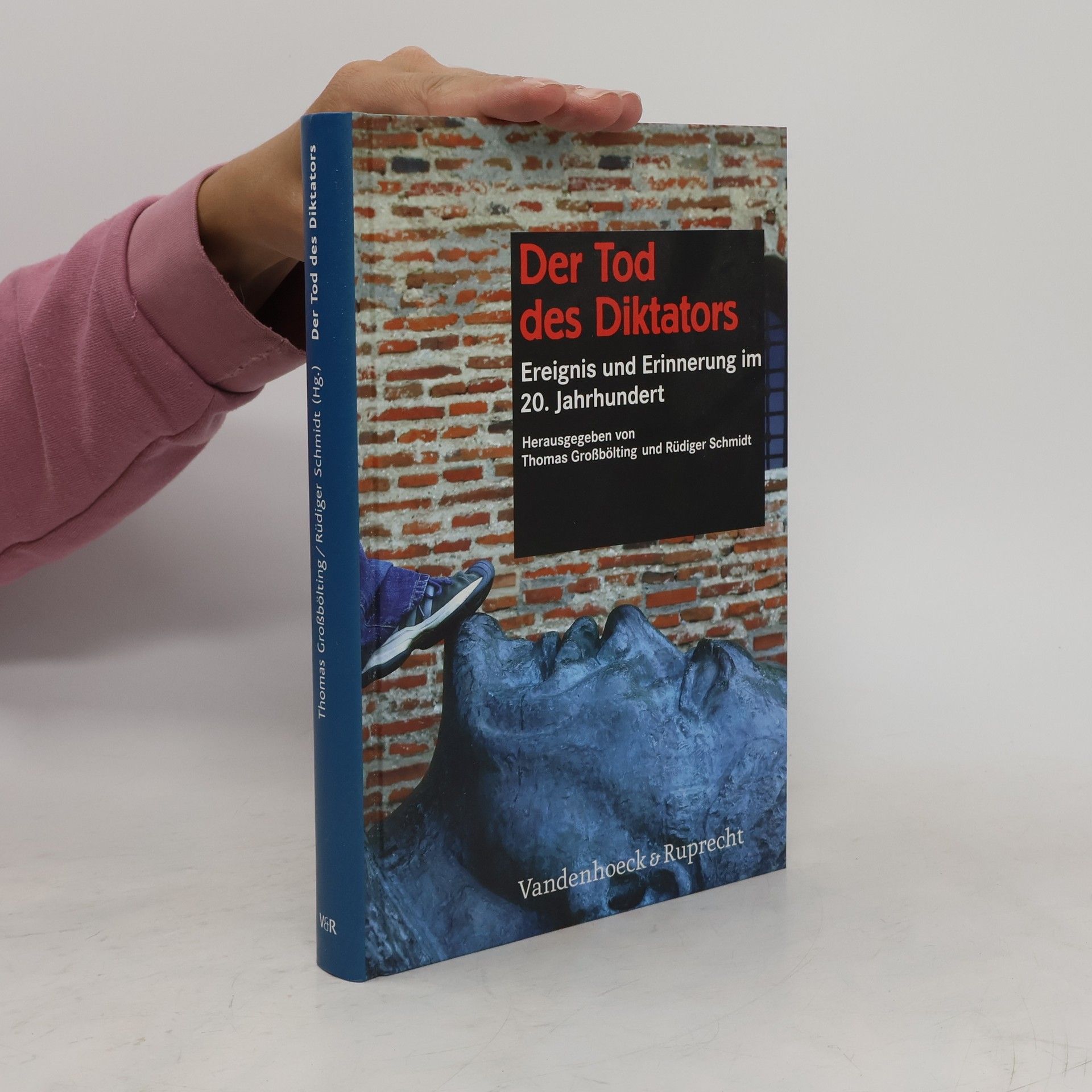Die Beiträge des Bandes vertieften die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit dem »Missbrauchsskandal« der katholischen Kirche. Thematisiert werden die Ursachen dieser Gewalt sowie ihre Legitimation in religiösen Texten und in der Organisationsstruktur der Kirche. Es wird beschrieben, welche Traumatisierungen aus sexualisierten Gewalterfahrungen von Betroffenen folgen und welche Behandlungsoptionen es für die Täter gibt. Dabei werden unterschiedliche Dimensionen der Formen kirchlicher Gewalt in den Blick genommen wie etwa Gewalt gegen Frauen, ritualisierte Gewalt, Aktenarchive als Grundlage der Aufarbeitung, das Verhältnis der Kirche zum Krieg und die besonderen Merkmale der Kirche als »Täterorganisation«.
Thomas Großbölting Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)



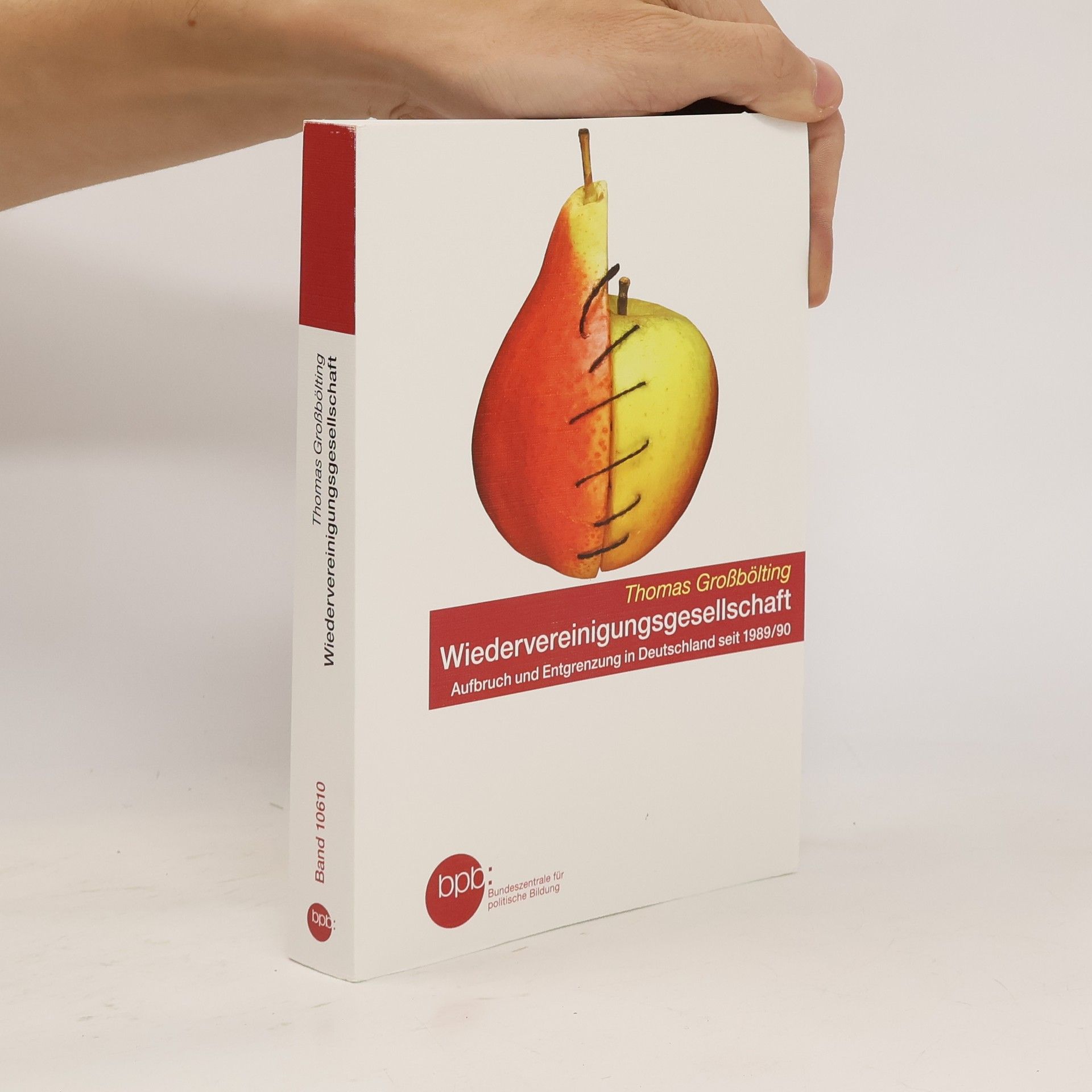

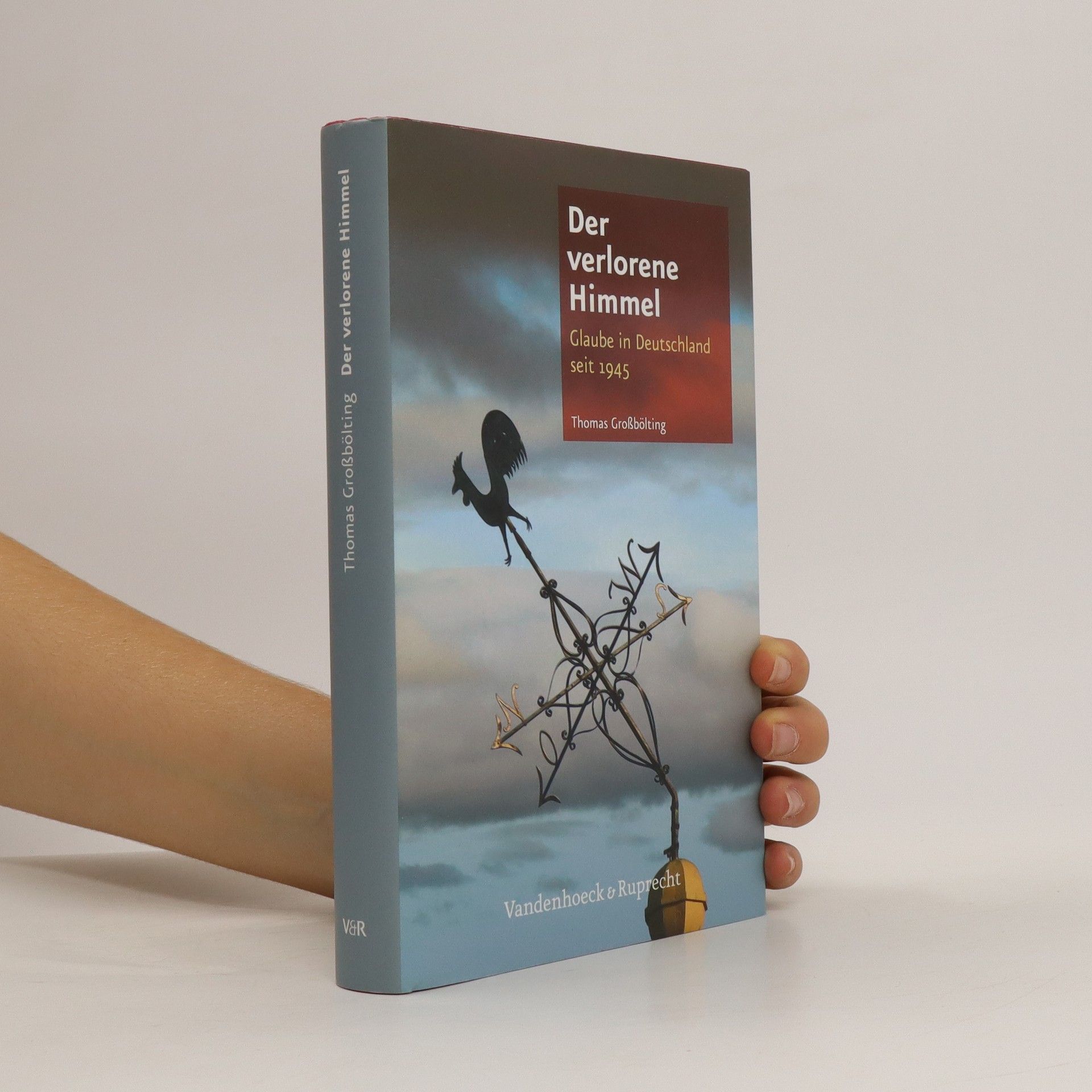
Alfred Müller-Armack in Ludwig-Erhard Pose inklusive der ikonischen Zigarre – der in Münster und Köln aktiv gewesene Ökonom war eine schillernde Person. Aktuell wird er vor allem als „Erfinder“ der „sozialen Marktwirtschaft“ erinnert. Diesen Begriff hat Müller-Armack 1946 aufgebracht und ihn populär gemacht, als Wissenschaftler, als Politikberater und als hochrangiger Beamter. Hinter diesem gängigen Bild steht aber auch ein Wissenschaftler, der sich 1933 tief auf die Denkwelt des Nationalsozialismus eingelassen hat. Dieser Umstand verschwand hinter dem populären Bild ebenso wie die letztlich vordemokratische Grundausrichtung der Überlegungen: ein starker Staat lenkt die Wirtschaft aus übergeordneten, der politischen Meinungsbildung entzogenen Prinzipien – so das Idealbild Müller-Armacks, welches auch in seinen Nachkriegsschriften durchschlug. Das vorliegende Buch zeichnet die intellektuelle und politische Entwicklung Müller-Armacks nach und eröffnet damit neue Perspektiven sowohl auf das Schaffen des Ökonomen als auch auf den öffentlichen Umgang damit.
Macht und sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche
Betroffene, Beschuldigte und Vertuscher im Bistum Münster seit 1945
Das Buch untersucht den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen durch katholische Priester im Bistum Münster seit 1945. Es beleuchtet das Leid der Betroffenen, die Täter, begünstigende Faktoren sowie die Reaktionen der Kirchenleitungen und des sozialen Umfelds, um die Dynamiken und Auswirkungen dieser Verbrechen zu verdeutlichen.
Die schuldigen Hirten
Geschichte des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche
Eine »Zäsur in der Kirchengeschichte« – so bewertet der Historiker Thomas Großbölting den weltweiten sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. In diesem Buch zeichnet er die Geschichte von Betroffenen, Tätern und Vertuschern des Missbrauchsskandals nach und analysiert die fatalen kirchlichen Strukturen, die die Taten ermöglichten. Das Buch ist damit das erste historische Sachbuch zum Thema, das Gesamtbild eines der erschütterndsten Kapitel der Kirchengeschichte und ein Anstoß für die Zukunft.
Wiedervereinigungsgesellschaft
Aufbruch und Entgrenzung in Deutschland seit 1989/90
The churches in Germany are rarely full these days, and the number of children still being christened is on the wane. Fewer and fewer people choose to become priests or pastors. And yet the notion that religion and piety are somehow disappearing from society would be wrong. There is in fact a very lively market for popular religious themes, and guidebooks and how-to manuals on spiritual matters are booming. How can we reconcile these two apparently contradictory facts? What are the consequences for our religious communities? Thomas Großbölting provides some concrete answers to these questions in an easy-to-read volume – an indispensable book for anyone interested in matters of faith.
Der Tod des Diktators
- 320 Seiten
- 12 Lesestunden
“The King is dead, long live the King!” – this statement, expressing the very essence of political stability, was no longer valid for dictatorships in the 20th century. Last used in 1824, this cry was the attempt to defuse the situation surrounding the death of a monarch by showing that power could be transferred from one ruler to the next in line without delay. In the 20th century, however, this was no longer the case. The “Age of Extremes” was characterized by a multitude of political fractures and upheavals. The death of a powerful leader, especially a dictator, in the 20th century usually was accompanied by a political void: The dictator is dead, so what happens now? That is the modern version of the ancient French approach.
Friedensstaat, Leseland, Sportnation?
- 333 Seiten
- 12 Lesestunden
War die DDR ein 'Friedensstaat', ein 'Leseland', eine 'Sportnation'? Nahm sie zu Recht für sich in Anspruch, ein 'Hort des Antifaschismus' zu sein? Gab es wirklich eine Gleichberechtigung von Mann und Frau? Und gehen die Erfolge Finnlands in den jüngsten Pisa-Studien tatsächlich auf eine Kopie des DDR-Bildungssystems zurück? 16 renommierte Autorinnen und Autoren gehen den bis heute wirkenden Legenden der DDR auf den Grund. Sie untersuchen detailliert und ergebnisoffen die Urteile und Vorurteile über den sozialistischen deutschen Staat. Von verschiedenen Disziplinen aus beleuchten sie die einzelnen Gesellschaftsbereiche der DDR und stellen den Meinungen überprüfbare Fakten gegenüber. Mit Beiträgen von Jutta Braun, Gunilla Budde, Anselma Gallinat, Thomas Großbölting, Stefan Haas, Dierk Hoffmann, Rainer Karlsch, Sabine Kittel, Christoph Kleßmann, Wolfgang Lambrecht, Christoph Links, Marc-Dietrich Ohse, Patrice G. Poutrus, Matthias Rogg, Rüdiger Schmidt und Hermann Wentker.