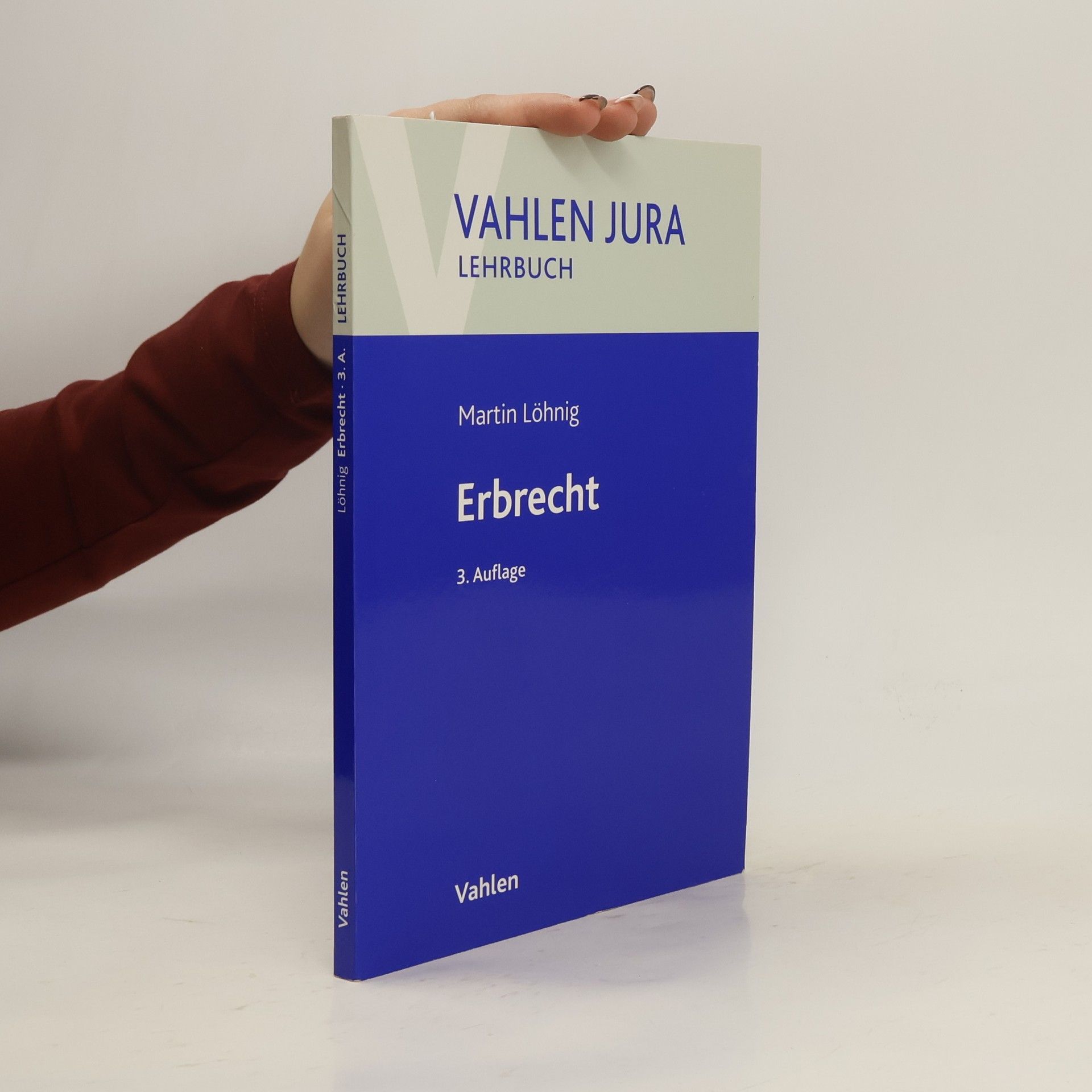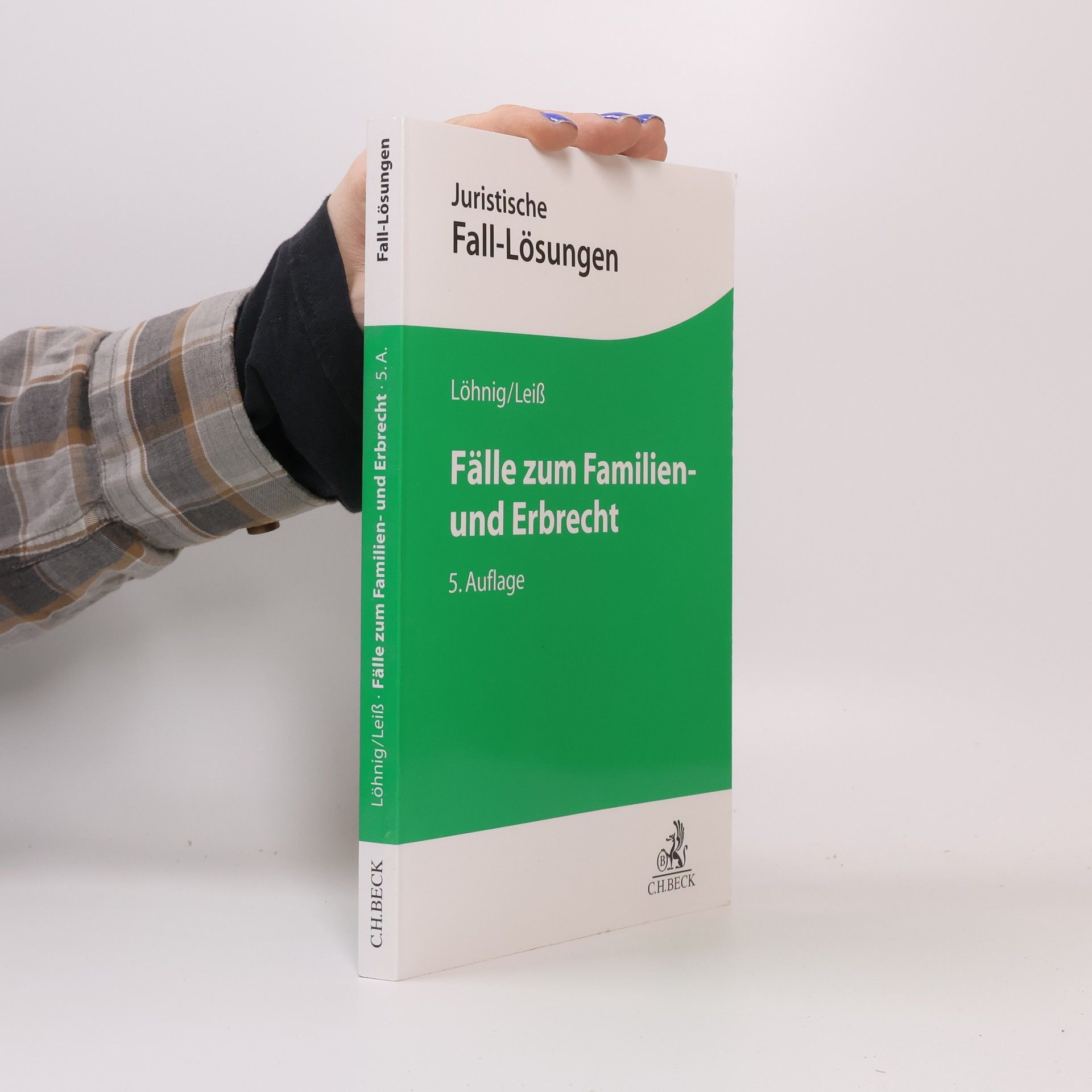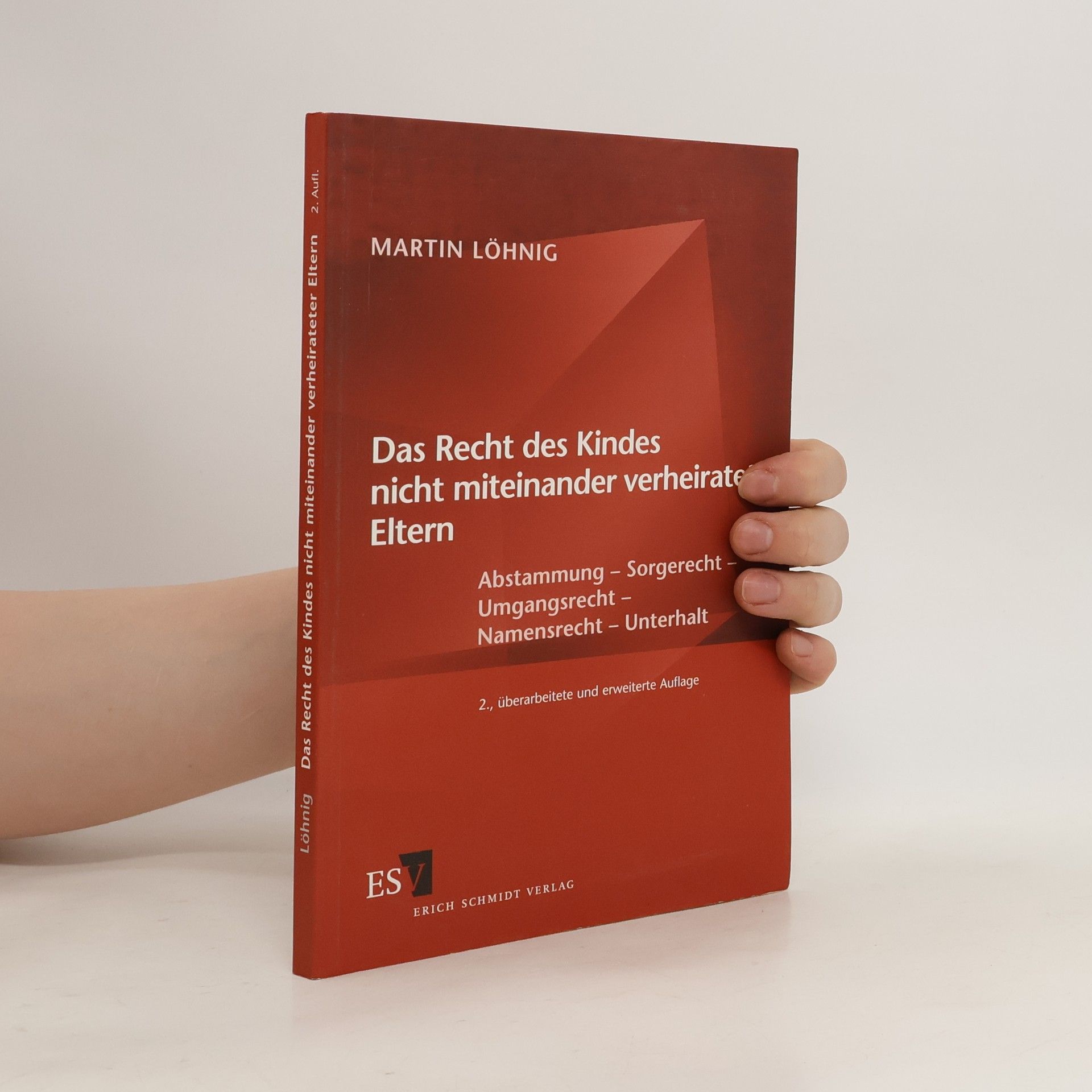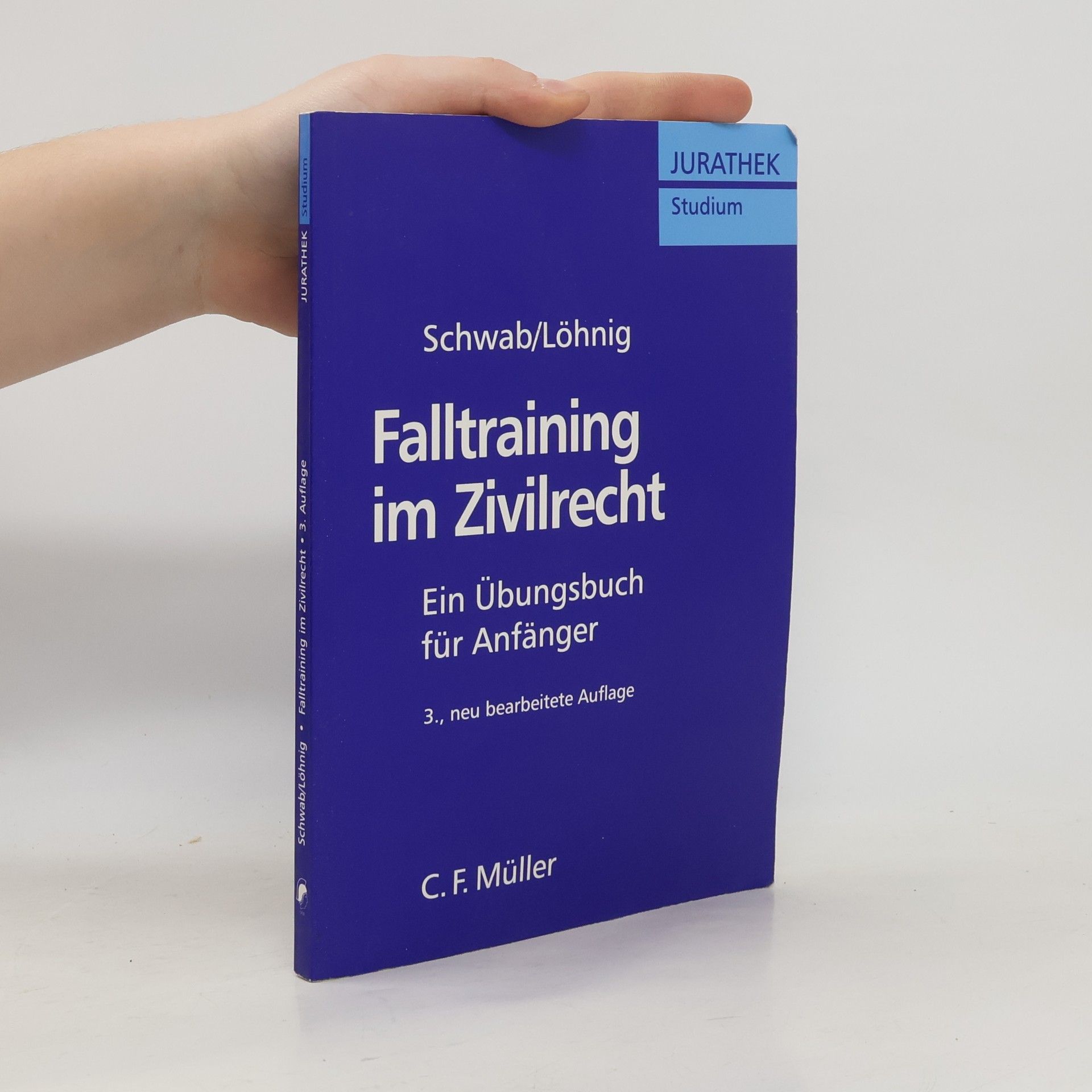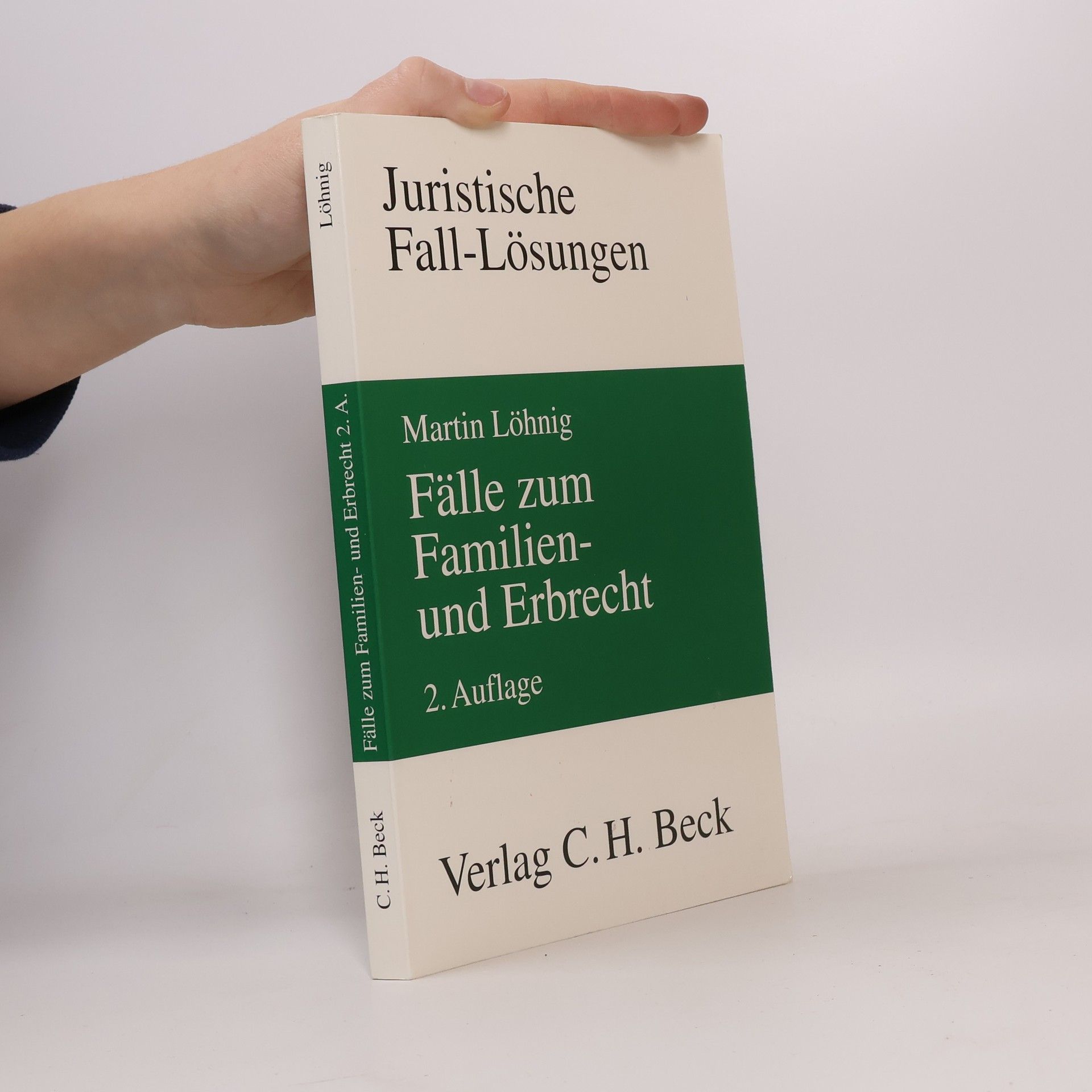Notarformulare Erbscheinsverfahren, Testamentsvollstreckerzeugnis, Europäisches Nachlasszeugnis
Testamentsvollstreckerzeugnis, Europäisches NachlasszeugnisMuster - Anträge - Erläuterungen
Das Buch bietet eine umfassende Sammlung von Formulierungsvorschlägen und Mustern speziell für das Erbscheinsverfahren, um Notaren, Nachlassrichtern und im Erbrecht tätigen Anwälten die tägliche Arbeit zu erleichtern. In sechs detaillierten Kapiteln werden verschiedene Fallkonstellationen behandelt, einschließlich Zuständigkeit, Verfahren und Kosten. Über 60 sofort einsetzbare Muster, Formulare und Checklisten unterstützen die effiziente Bearbeitung von Erbscheinsverfahren. Herausgeber Dr. Peter Becker und sein Team stellen damit ein praxisorientiertes Hilfsmittel bereit, das eine Lücke in der Fachliteratur schließt.