Thema des Bandes ist die herrschaftliche Reprasentation adeliger Damen im Sudwesten des Reiches im spaten Mittelalter und ihre internationalen Verbindungen, vor allem die engen Kontakte zwischen dem deutschen Sudwesten, Oberitalien und Savoyen/Burgund. Die Beitrage wurden auf einer interdisziplinaren Tagung 2020 vorgestellt, die eine breite kulturhistorische Annaherung an das hofische Umfeld "starker Frauen" unternahm. Sie betrachten dynastische Heiratsstrategien, weibliche Handlungsspielraume und Netzwerke ebenso wie hofische und klosterliche Lebenswelten anhand von Literatur und materieller Kultur. Im Zentrum steht Margrethe von Savoyen (1420-1479), die Tochter des (Gegen-)Papstes Felix V., die im Vergleich mit weiteren adeligen Damen besonders profiliert wird.
Peter Rückert Bücher
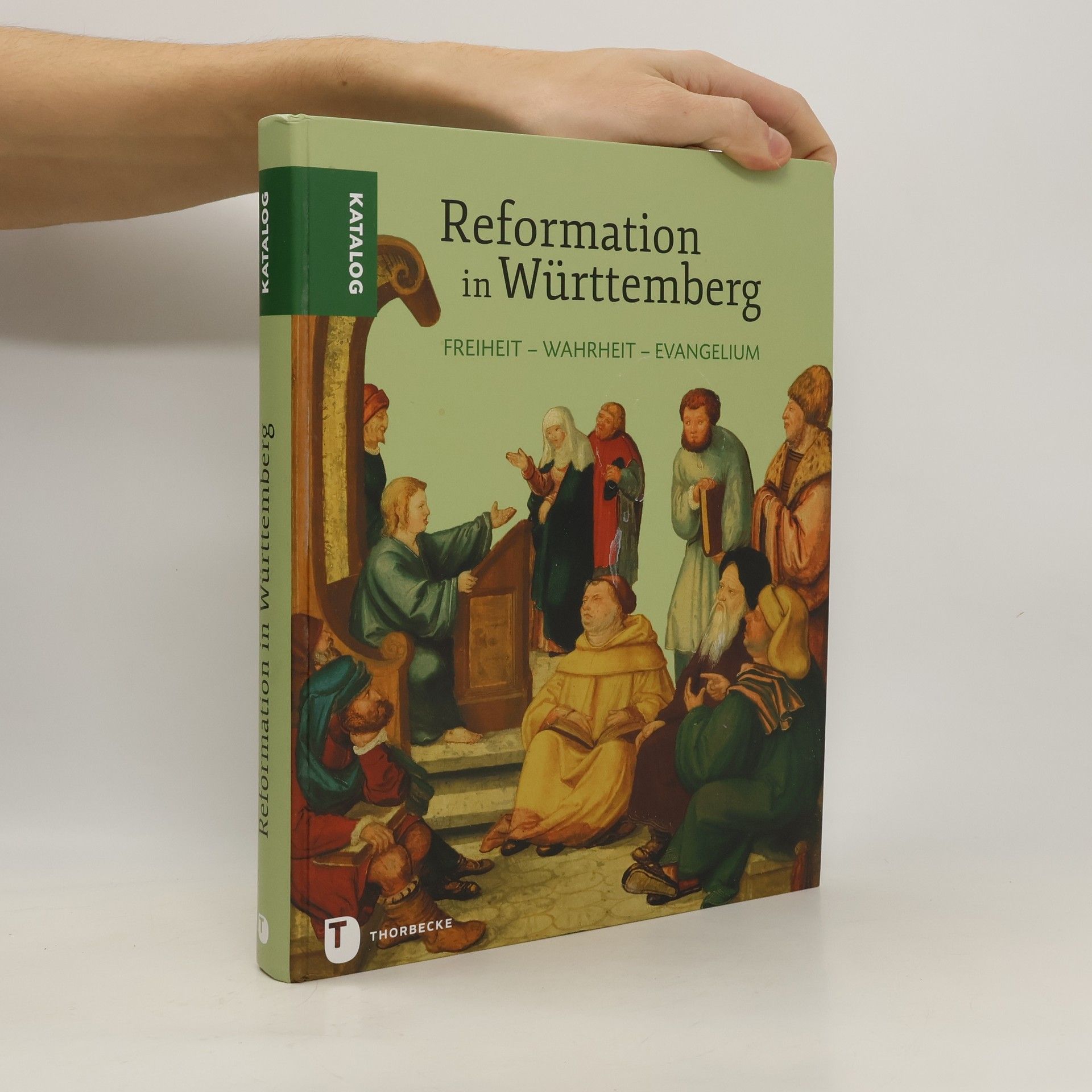




Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 83 (2024)
- 608 Seiten
- 22 Lesestunden
Die Zeitschrift, die ursprünglich als Anhang zu den »Württembergischen Jahrbüchern für Statistik und Landeskunde« erschien, wurde 1937 neu gestaltet und umbenannt. Sie dient als anerkanntes wissenschaftliches Diskussionsforum und konzentriert sich auf die Geschichte des Landesteils Württemberg, einschließlich Hohenzollern seit 1945. Mit einer langen Tradition seit 1881 bietet die Publikation tiefgehende Analysen und Diskussionen zu landeskundlichen Themen.
Die Benediktinerabtei Gottesaue
Studien zu ihrer Geschichte und den benediktinischen Reformen im deutschen Südwesten
- 194 Seiten
- 7 Lesestunden
Die Benediktinerabtei Gottesaue, gegründet 1094 von Graf Berthold von Hohenberg, spielte über 450 Jahre eine prägende Rolle in der Kulturlandschaft und im geistigen Leben am Oberrhein. Mit dem Tod des letzten Mönchs im 16. Jahrhundert endete die Geschichte des Klosters, das anschließend in ein markgräflich-badisches Schloss umgewandelt wurde. Heute ist Schloss Gottesaue ein bedeutendes Bauwerk in Karlsruhe, das an die reiche Geschichte der Abtei erinnert.
Vor genau 600 Jahren wurde Margarethe von Savoyen geboren. Das runde Jubiläum gibt den Anlass für eine Sonderausstellung des Landesarchivs Baden-Württemberg über diese herausragende Frau des späten Mittelalters. Dreimal mit hochadeligen Männern verheiratet, war sie nacheinander Königin von Sizilien, Kurfürstin von der Pfalz und schließlich Gräfin von Württemberg. Die bedeutende Fürstin war vernetzt in ganz Europa. Ihre außergewöhnliche Biografie spiegelt sich in den kostbaren und teils einzigartigen Stücken, die die Ausstellung ab dem 10. September 2020 im Hauptstaatsarchiv Stuttgart zeigen kann. Weitere Stationen der dreisprachig (deutsch ? italienisch ? französisch) angelegten Schau sind Turin in Italien und das schweizerische Morges am Genfer See:00Exhibition: Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Germany (10.09 - 01.12.2020) / Archivio di Stato di Torino, Turin, Italy (19.12.2020 - 12.03.2021) / Chateau de Morges, Morges, Switzerland (21.05 - 05.09.2021).
Freiheit - Wahrheit - Evangelium
Reformation in Württemberg - Katalog
Das Herzogtum Württemberg gehörte zu den ersten protestantischen Territorien des Heiligen Römischen Reiches. Die Ausstellung des Landesarchivs Baden-Württemberg widmet sich der Frühzeit der Reformation in Württemberg. Wie kamen reformatorische Gedanken nach Württemberg? Wie wurden sie von der Bevölkerung aufgenommen, und welche Veränderungen erfolgten im Zuge der Einführung der Reformation? Dabei wird besonders der zeitgenössische Streit um „Freiheit - Wahrheit - Evangelium“ in den Blick genommen. Etwa 300 herausragende Exponate lassen die dynamischen Vorgänge um die Reformation in Württemberg unmittelbar greifbar werden: die Endzeiterwartung und die intensive Frömmigkeit der Menschen, die Ausstrahlung Martin Luthers und seine Lehre im deutschen Südwesten ebenso wie die gewaltsamen Auseinandersetzungen um geistige und soziale Freiheit im Bauernkrieg von 1525.