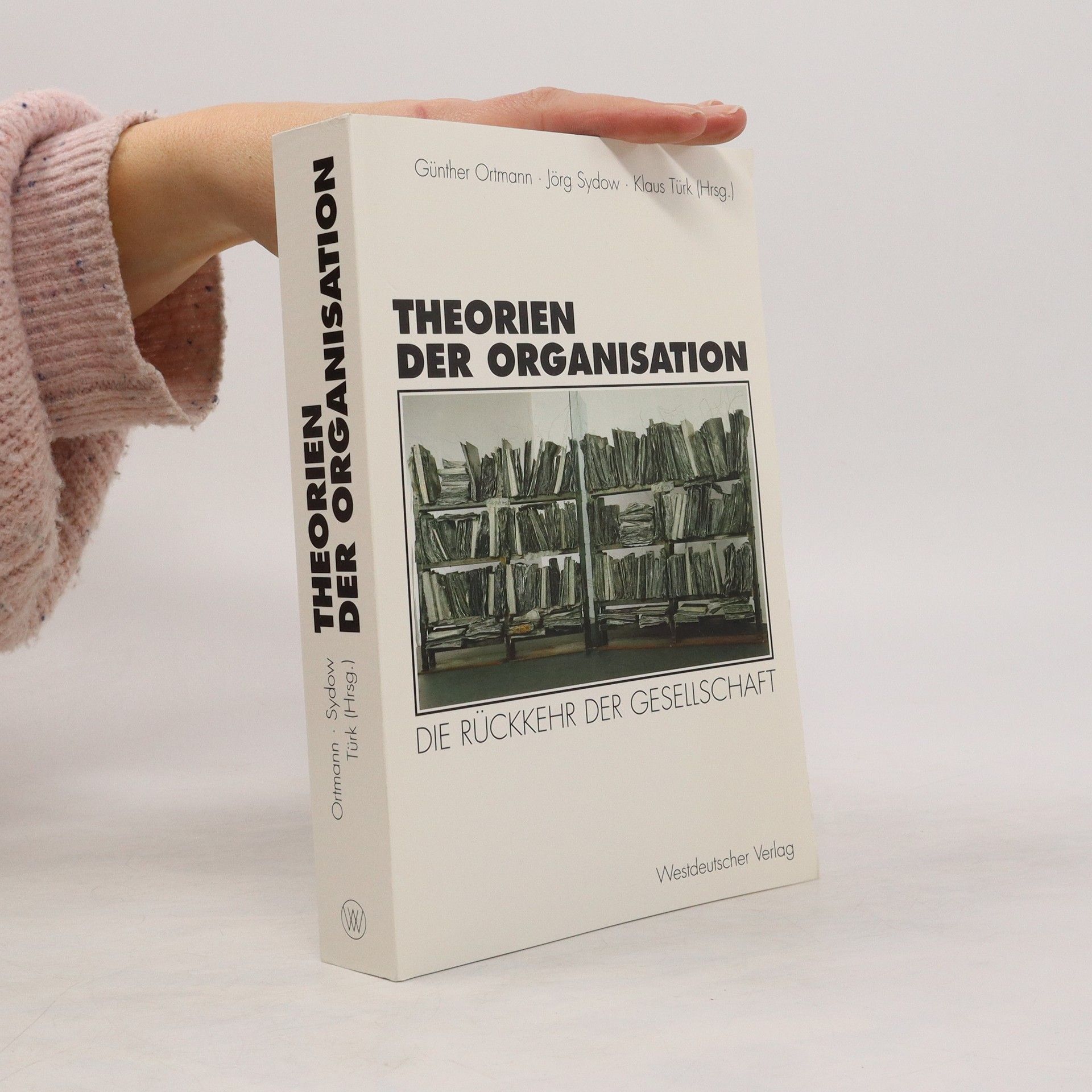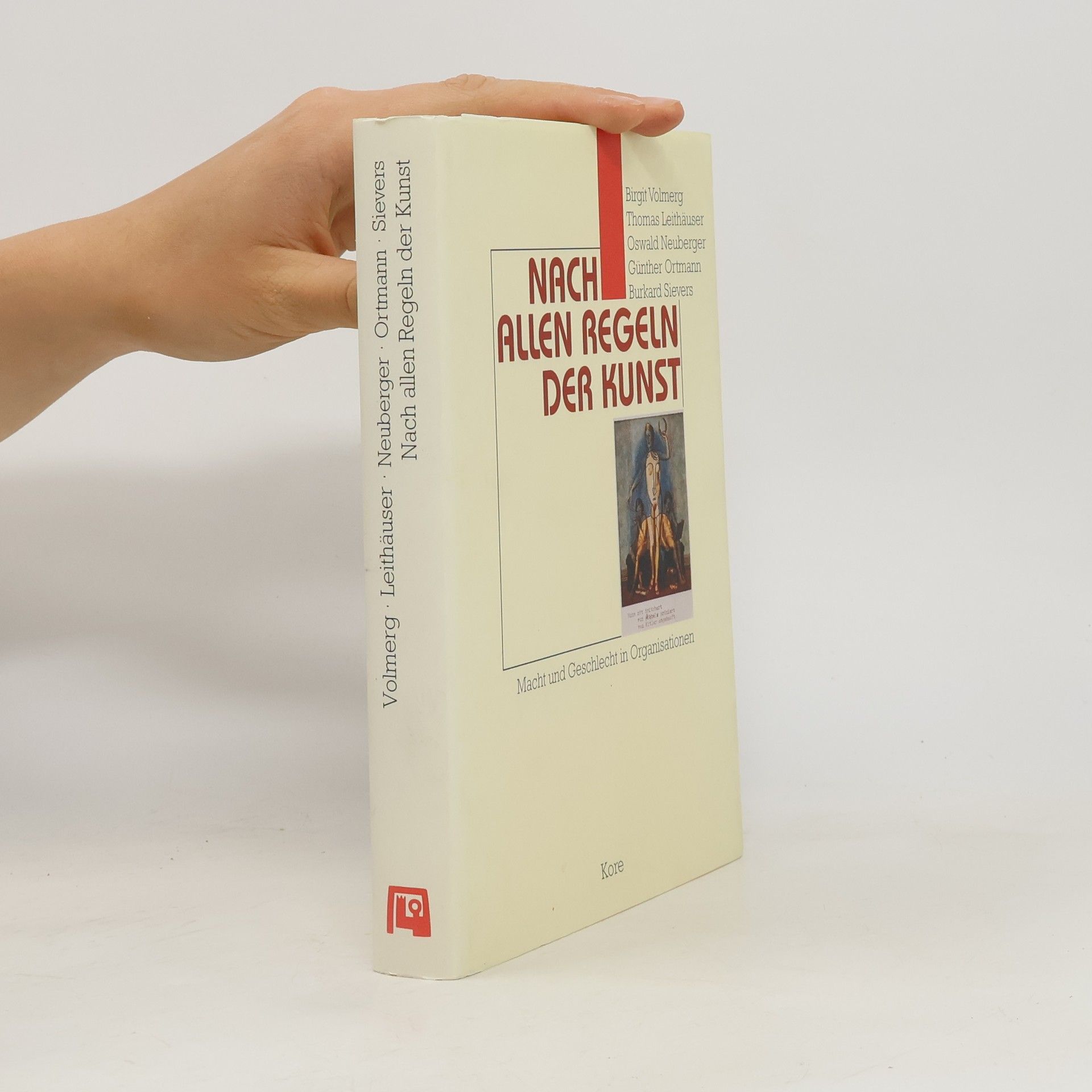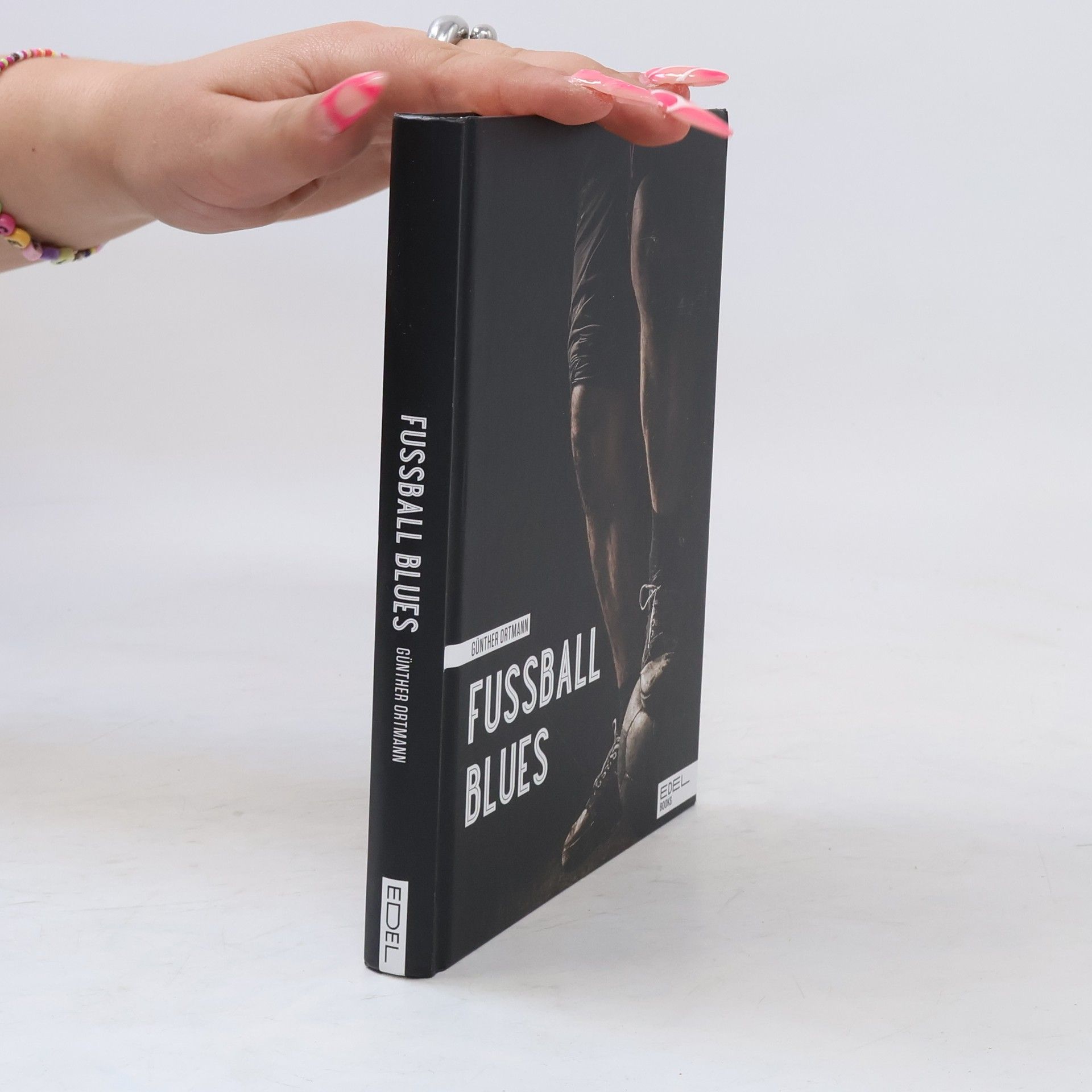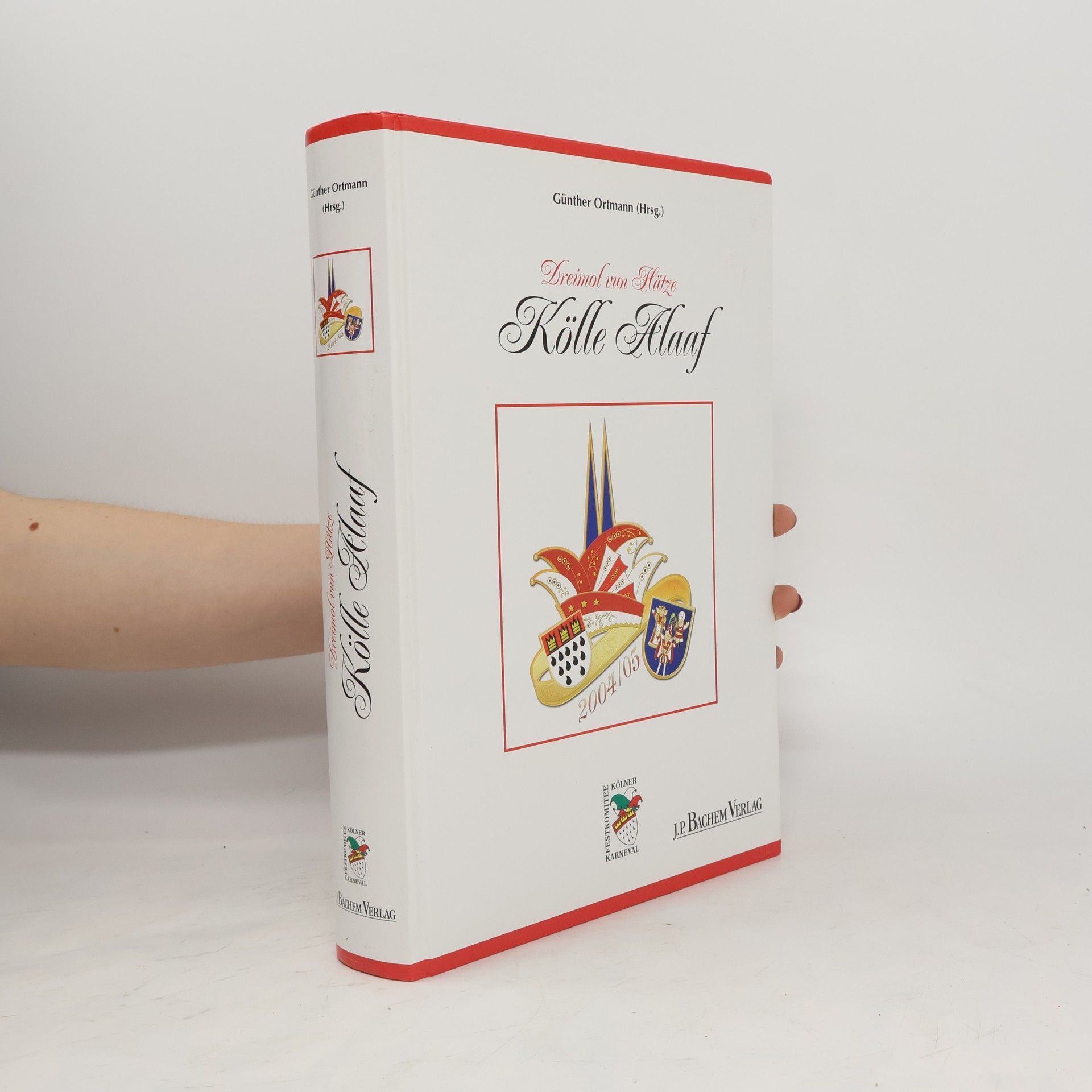Gabe versus Tausch
Reziprozität in Organisationen
In diesem Buch geht es um die Bedeutung der Gabe im Gegensatz zum Tausch, mit dem sie gleichwohl verflochten ist. In der einen, der Welt der überreichen ethnologischen, anthropologischen, kulturwissenschaftlichen und -soziologischen Literatur wimmelt es von Gaben, die in der anderen, der Welt der ökonomischen und Rational-Choice-theoretischen Literatur, nicht gesehen, bestritten, unsichtbar gemacht und vielmehr mit Tausch gleichgesetzt werden. In beiden kommen Gaben in Organisationen kaum vor, in der einen, weil man dort Gaben inmitten der Wirtschaft, der Unternehmen, der Organisationen kaum Aufmerksamkeit widmet (obwohl gerade das im Sinne Marcel Mauss‘ gewesen wäre), in der anderen, weil sie da ein Geben jenseits eines do ut des überhaupt nicht wahrhaben können und wollen. Sonstige Ingredienzien unter anderem: Eine scharfe Kritik der Gabentheorie Bourdieus, eine Erörterung der Missachtung der Gabe bei Luhmann, Konsequenzen für die Organisations- und die Unternehmungstheorie und ein paar launige kleine Stücke zu Weihnachts- und zu Festschriftgaben.