Die Leidenschaft, für Menschen zu Kochen
- 319 Seiten
- 12 Lesestunden

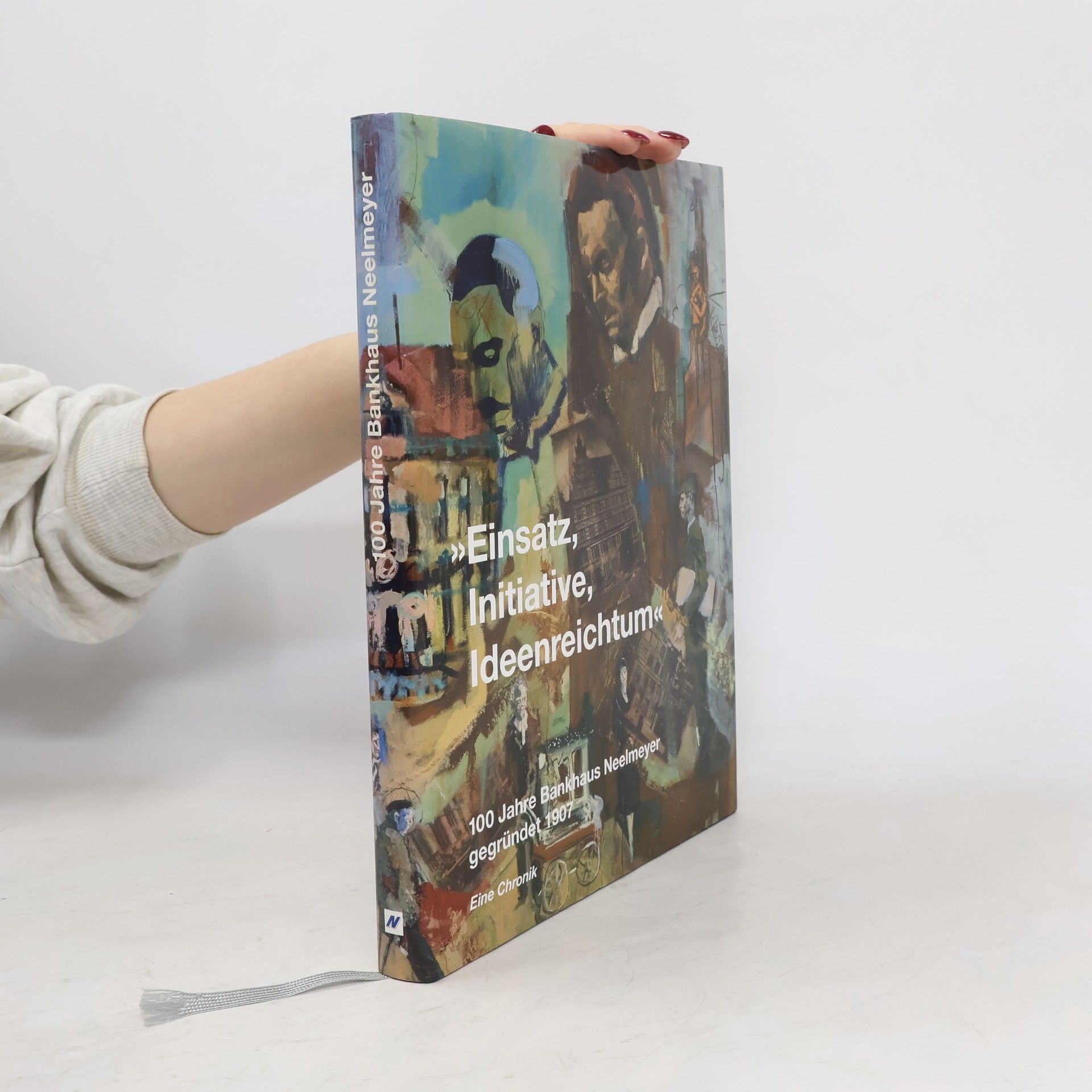

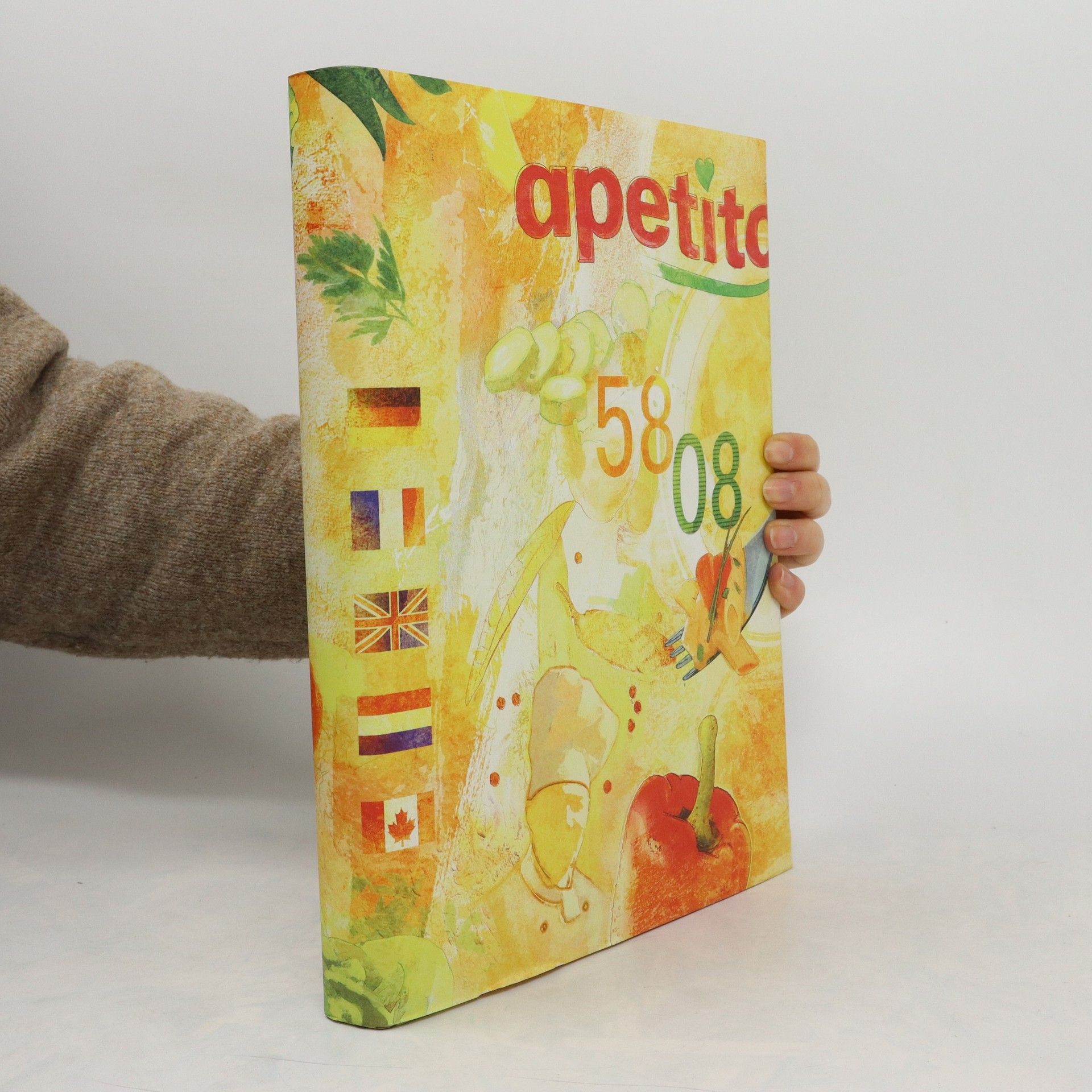
Biografische Studien zum Verhältnis von Literatur und Ideologie. 10 Autorenporträts und eine Skizze über die Deutsche Akademie für Bildung und Kultur
Hanns Johst (1890-1978), SS-Gruppenführer und Vertrauter Himmlers, war ein gefeierter Dichter der NS-Bewegung und Präsident der Reichsschrifttumskammer (RSK). Diese Biographie beleuchtet sein ideologisches Wirken als RSK-Präsident und seine frühe Karriere als erfolgreicher Schriftsteller, der zunächst expressionistisch und später völkisch orientiert war. Johst wurde von der NS-Führung geschätzt, da er aktiv an der ideologischen Ausrichtung des literarischen Lebens in Deutschland mitwirkte. Ein zentraler Aspekt ist, inwiefern er sich auch dem Eroberungskrieg, der Ostkolonisierung und dem rassistischen Vernichtungsprogramm des Dritten Reiches widmete. Himmler beauftragte ihn, als deutscher Tacitus die „Saga des Großgermanischen Reiches“ für zukünftige Generationen deutscher Kolonialherren zu verfassen. Diese kritische Biographie stellt Johsts literaturpolitisches und ideologisches Wirken in den Kontext seiner gesamten Entwicklung dar, einschließlich seiner geistig-sozialen Entwicklung vor dem Dritten Reich und seiner Lebenssituation nach dem Krieg, die von einem fast zehnjährigen Entnazifizierungsverfahren geprägt war, aus dem er rehabilitiert hervorging. Die Untersuchung basiert auf seinem Gesamtwerk und mehreren tausend unveröffentlichten Dokumenten aus verschiedenen Archiven.