Jutta Götzmann Bücher

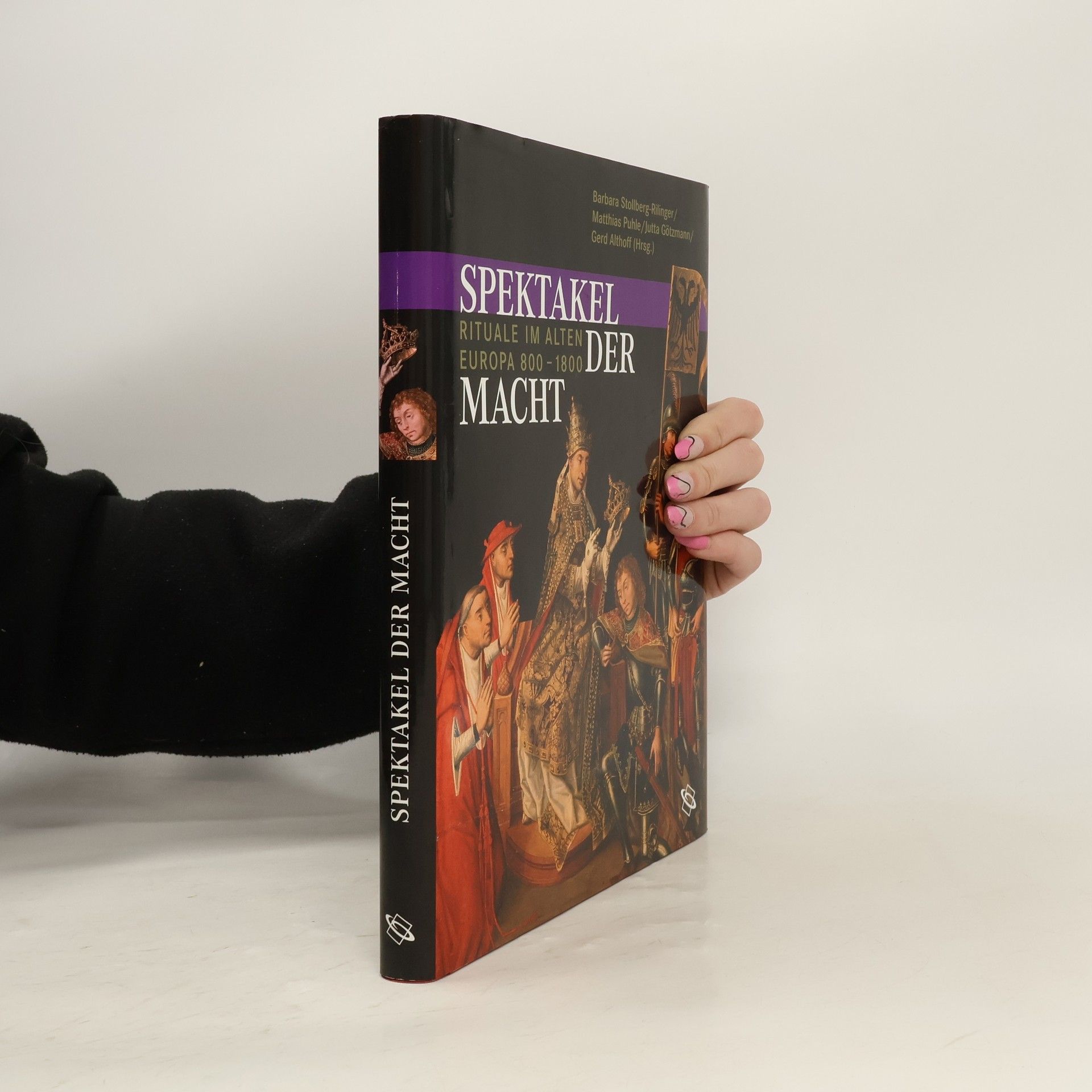
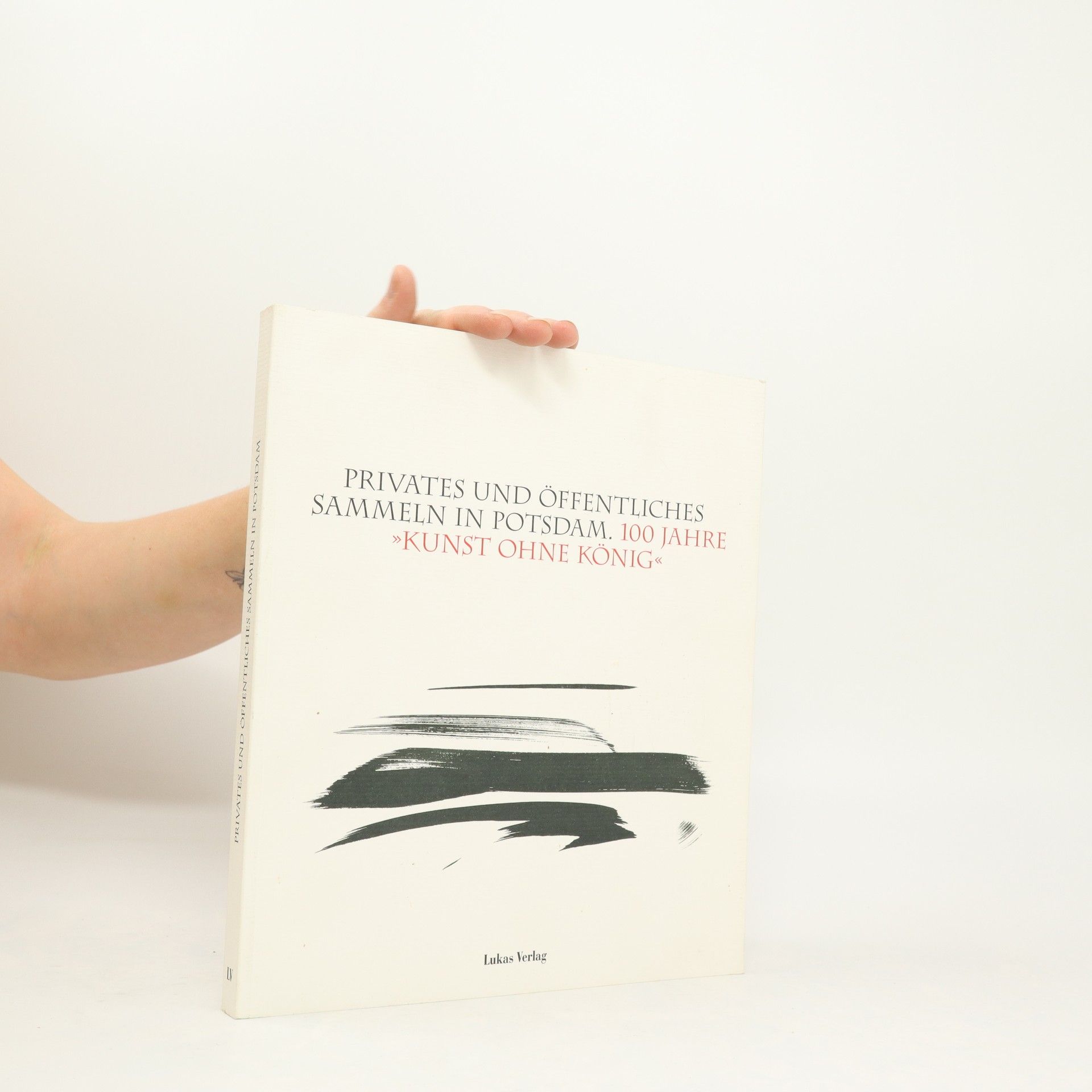


Der Vereinsamte.
Clowns in der Kunst Aschers (1893-1970)
Für Fritz Ascher war die Ambivalenz des Clowns als Außenseiter der Gesellschaft ein zentrales Motiv. Fritz Ascher fand während des Ersten Weltkrieges zu seinem Bajazzo-Motiv, einer Zeit politischer, gesellschaftlicher und sozialer Umbrüche. Rachel Stern zeichnet in ihrer Einleitung zu diesem Katalog die Lebenswelt Aschers sowie seine künstlerische Entwicklung nach und beleuchtet das weitere Leben des verfolgten und verfemten Künstlers durch die Grauen des Naziregimes. In den Katalog-Essays beleuchten die Autoren Jutta Götzmann und Ori Z. Soltes die Bajazzo-Arbeiten Fritz Aschers in fokussierter Form. Ori Z. Soltes schlägt in seinem Beitrag die Brücke zu Jacob Pins (1917-2005), für den das Narrenmotiv ebenfalls von zentraler Bedeutung war.0Neben den Bajazzo-Arbeiten Aschers umfasst der Katalog auch nach 1945 entstandene Landschaftsdarstellungen, die den persönlichen sowie künstlerischen Bruch durch das Erleben von Verfolgung, Verfemung durch das Naziregime und das Überleben deutlich werden lassen
Privates und öffentliches Sammeln in Potsdam
- 246 Seiten
- 9 Lesestunden
Erstmals wird der Versuch unternommen, sich der Geschichte des privaten Sammelns in und um Potsdam grundlegend anzunähern. Die Herausgeber stellen eine Auswahl einstiger und gegenwärtiger Privatsammlungen vor. Zugleich wird anhand der Bestände des vor 100 Jahren gegründeten Potsdam-Museums das öffentliche Sammeln von Kunst in Potsdam thematisiert. Repräsentative Beispiele aus dem Bestand geben Auskunft über die Entstehung, Strukturierung und Entwicklung dieser städtischen Sammlung. Die häufig nachweisbare Provenienz aus Kunstvereins- oder anderem Privatbesitz unterstreicht die historische Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements.
In the wake of the revolution of 1918–1919, members of the artistic vanguard formed the November Group, an alliance of self-described “revolutionaries of the spirit” who made a radical break with traditional forms of art. In honor of the 100th anniversary of the group’s founding, the Potsdam Museum has devoted an exhibition to this most prominent political artists’ association of the Weimar Republic and to one of its leading figures, the cosmopolitan, painter, architect, and adopted Potsdam citizen Wilhelm Schmid. Schmid’s years in Potsdam are closely associated with his early work, and here for the first time an extensive body of work from this phase is presented to the public. With its expressiveness as well as its affinity to the New Objectivity, Schmid’s highly individual aesthetic brought him into contact with other avant-garde artists, whose creative search for a new formal language is also represented in the exhibition with an incisive selection of exemplary works. Numerous international lenders have made possible this dialogue between Wilhelm Schmid and artists including Georg Tappert, Arthur Segal, Moriz Melzer, Otto Möller, and César Klein.