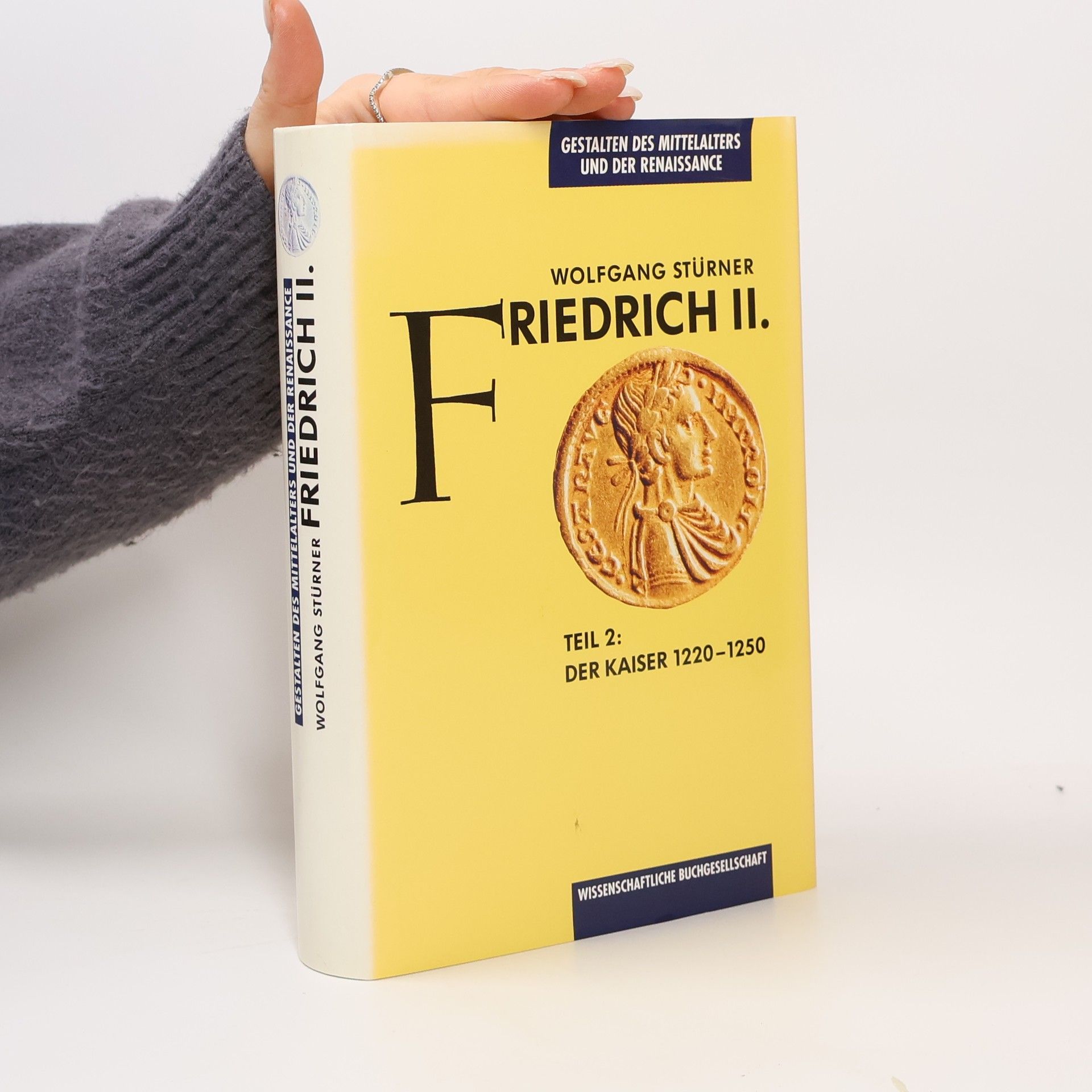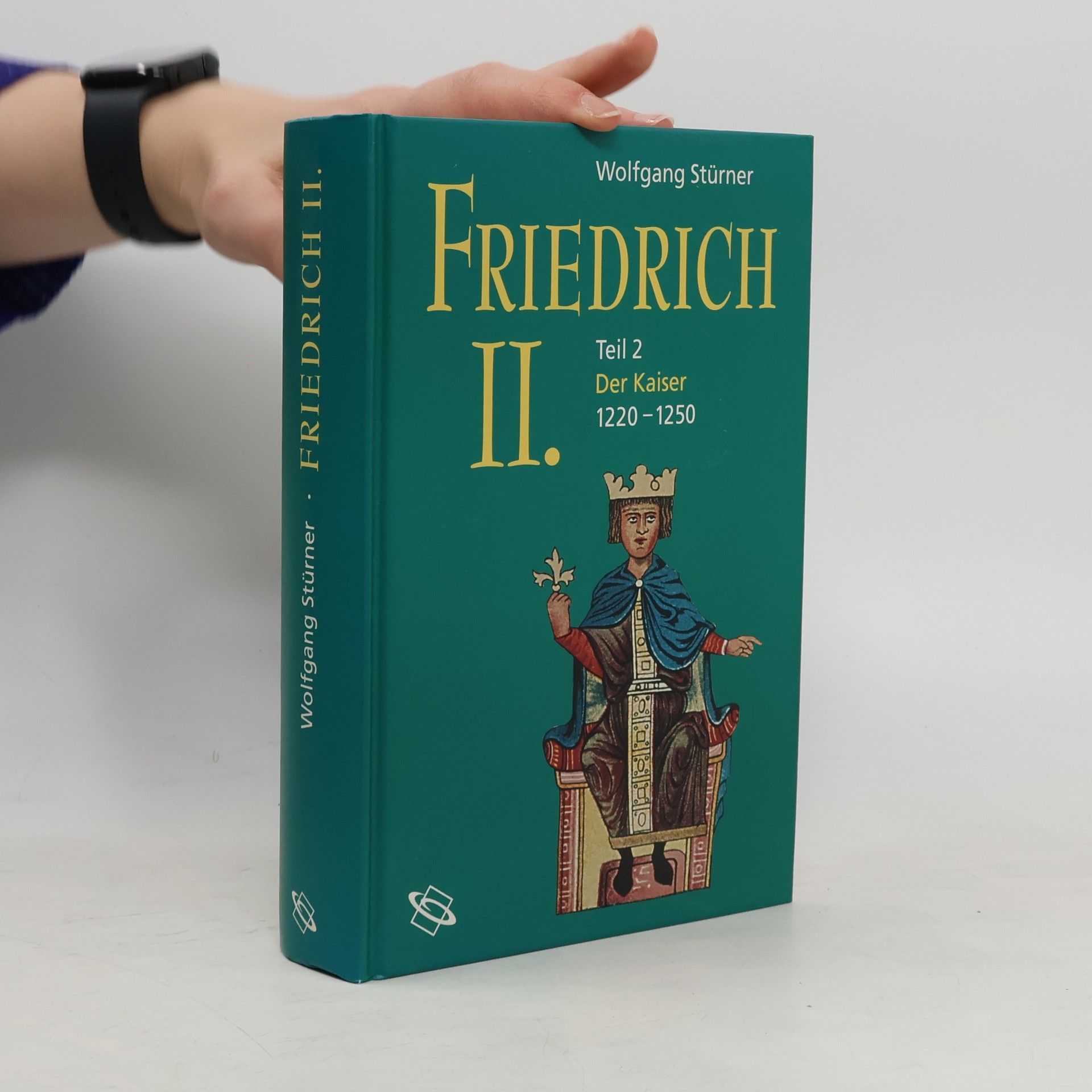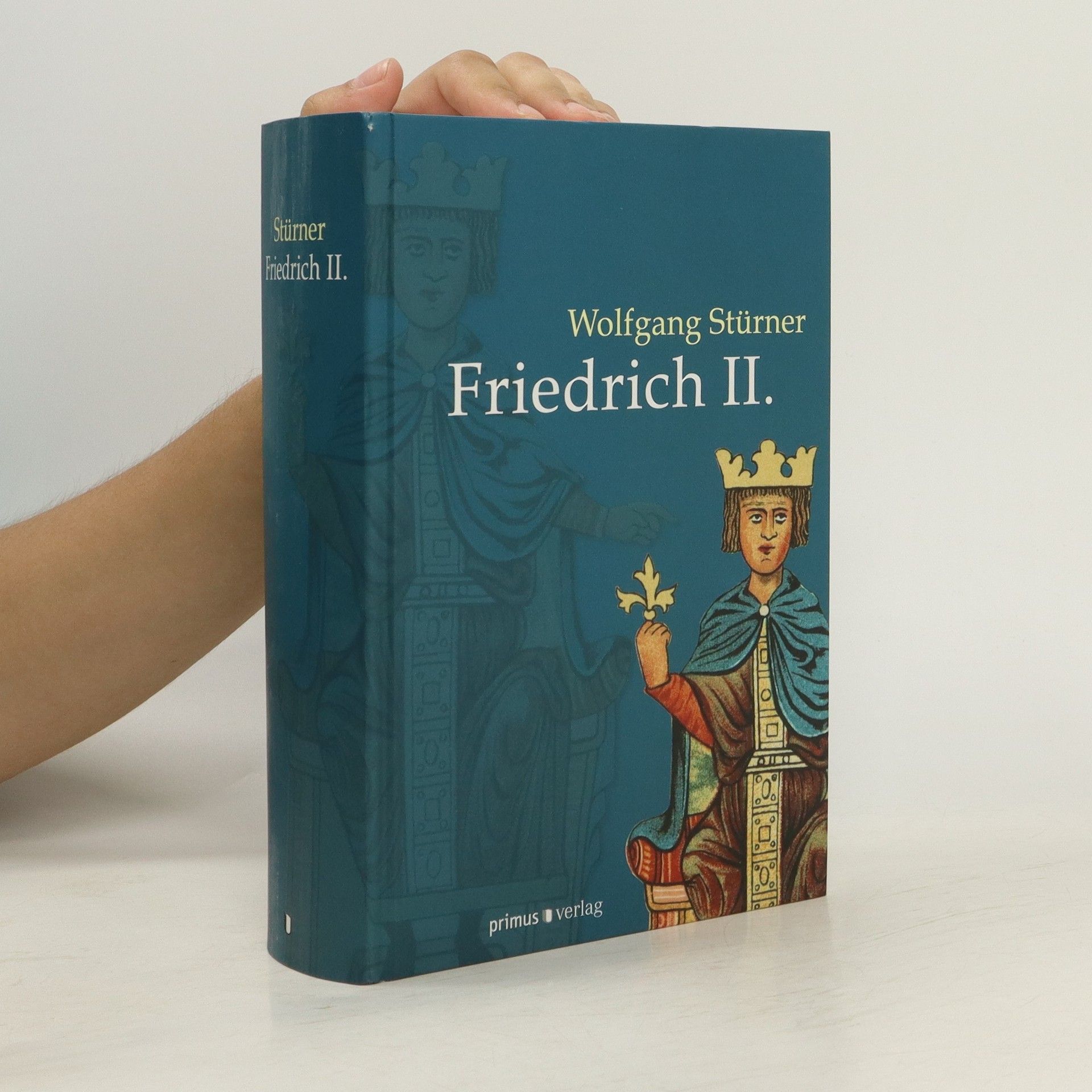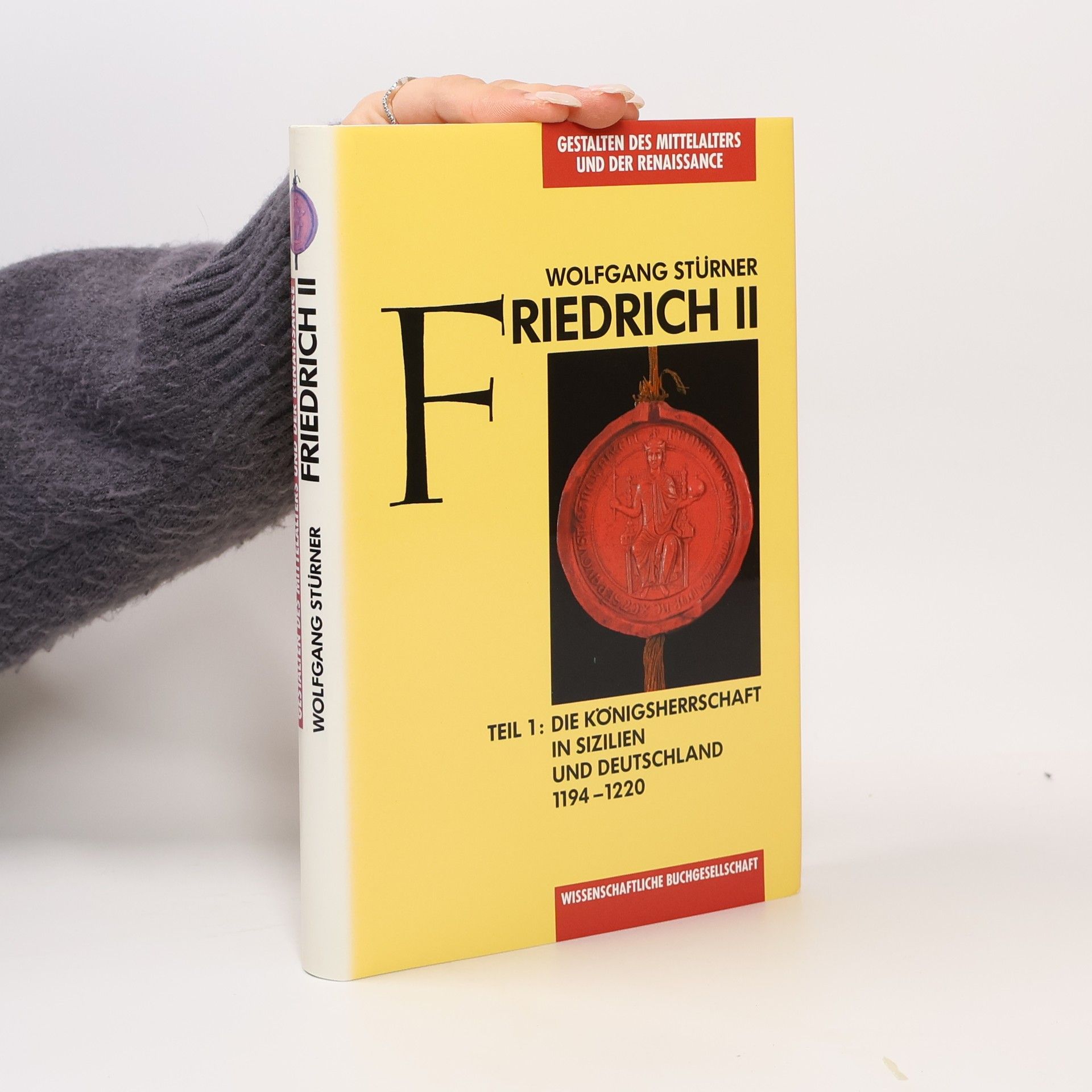Die Staufer
Eine mittelalterliche Herrscherdynastie - Bd. 2: Glanz, Krise und Niedergang (1190 bis 1268)
- 350 Seiten
- 13 Lesestunden
Nachdem mit Friedrich I. Barbarossa erstmalig einem Staufer die Kaiserwürde übertragen wurde, vermochten noch zwei weitere Staufer die Kaiserwürde zu erlangen: Heinrich VI. und Friedrich II. Doch schon im Jahr 1268 fand die erfolgreiche Dynastie mit König Konradin ein abruptes und tragisches Ende. Unmittelbar an den ersten Band anknüpfend, widmet sich der zweite Band der ereignisreichen Zeit der Staufer von 1190 bis 1268. In diesem Zeitraum von beinahe einem Jahrhundert fanden sie nicht nur zu einer neuen Glanzzeit, sondern lenkten mit Reformen, Kämpfen und Entscheidungen maßgeblich zentrale Entwicklungen in ganz Westeuropa. Die vielen politischen Erfolge waren aber auch von Niederlagen begleitet und ihre Herrschaftszeit von fundamentalen Konflikten mit dem Papst geprägt. Dieses Spektrum von der Blüte bis zum Niedergang des herausragenden Adelsgeschlechts legt das Buch in einer Gesamtschau dar.