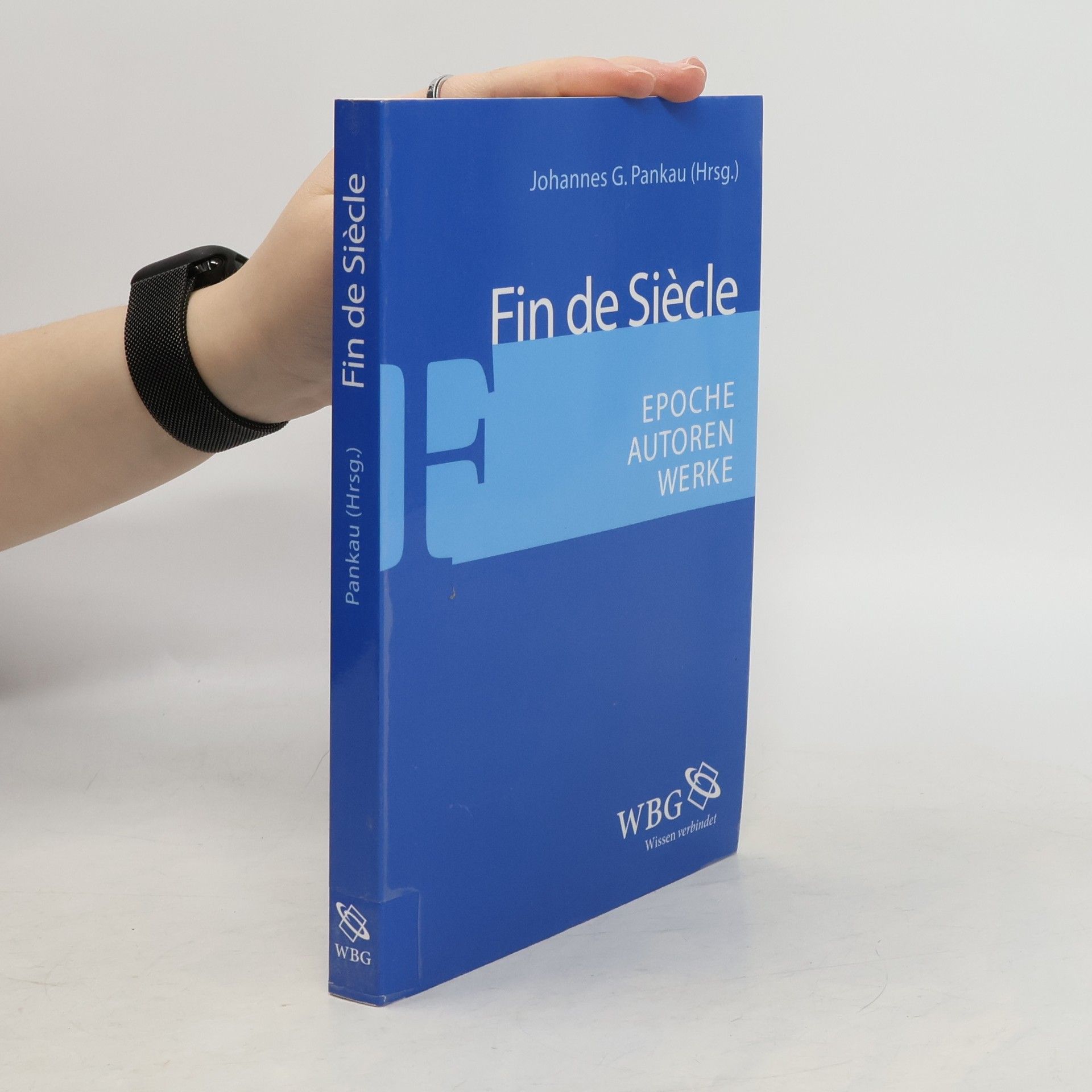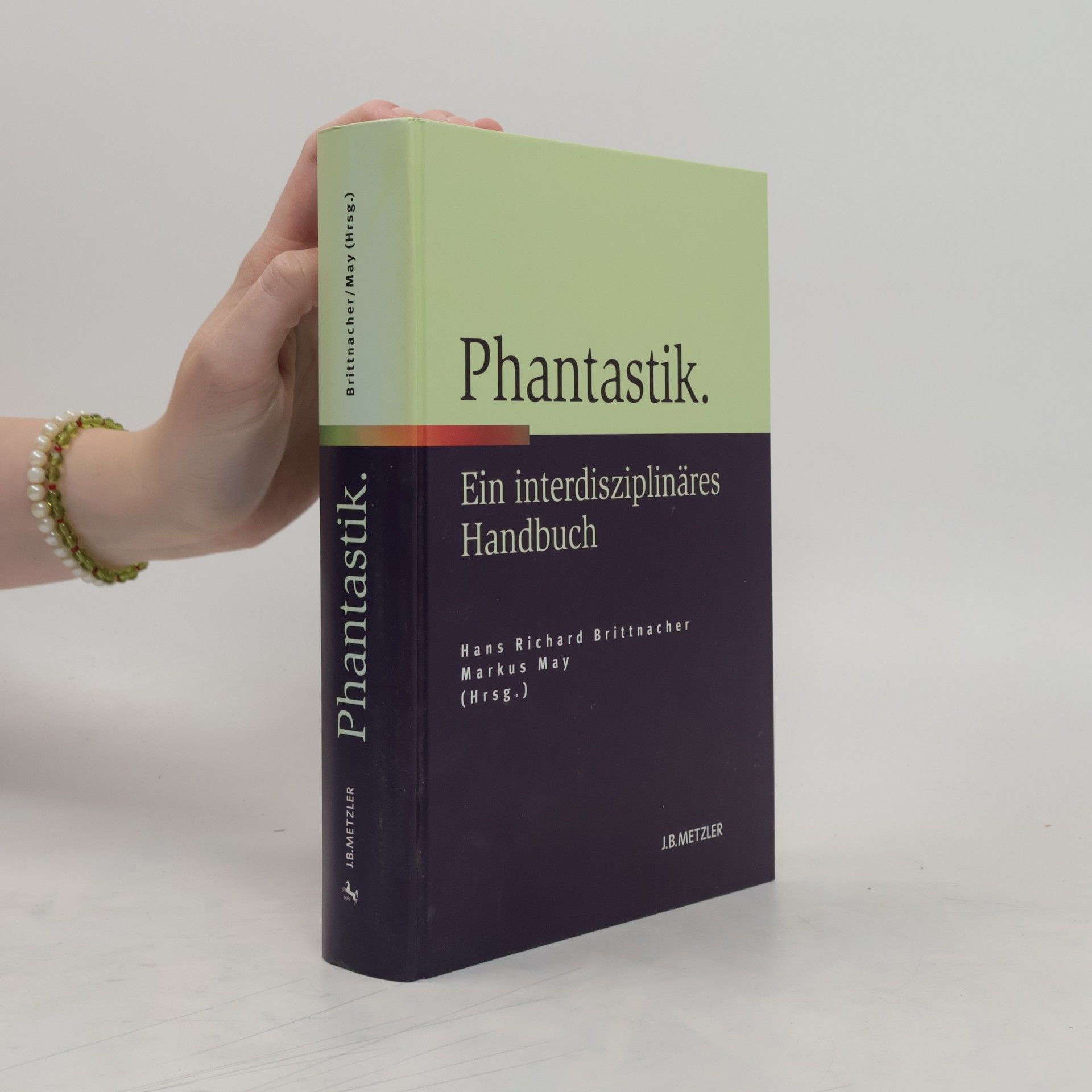Horror
Handliche Bibliothek der Romantik Band 7
Aufklärung und Zivilisierung des Menschen gehen Hand in Hand, Licht und Vernunft sollen fortan in der Welt herrschen. Entsprechend scheu schauen die Autorinnen und Autoren dieser Zeit in die Abgründe des menschlichen Daseins. Statt alle Hässlichkeiten des Lebens auszumalen, überlassen sie den Leser bestenfalls seinem schaurigen Ahnen. Ganz anders die Horror-Literatur der Romantik, der es nicht explizit und drastisch genug sein kann. Sie befreite sich von den Restriktionen der Vernunftkultur und zeichnet mit Menschenfressern, Blutsaugern, Kindsmorden und anderen ebenso eiskalt wie lustvoll geschilderten Grausamkeiten ein anderes, finsteres Bild unserer Natur.