Salons und Musenhöfe
Neuständische Geselligkeit in Berlin und in der Mark Brandenburg um 1800
- 196 Seiten
- 7 Lesestunden

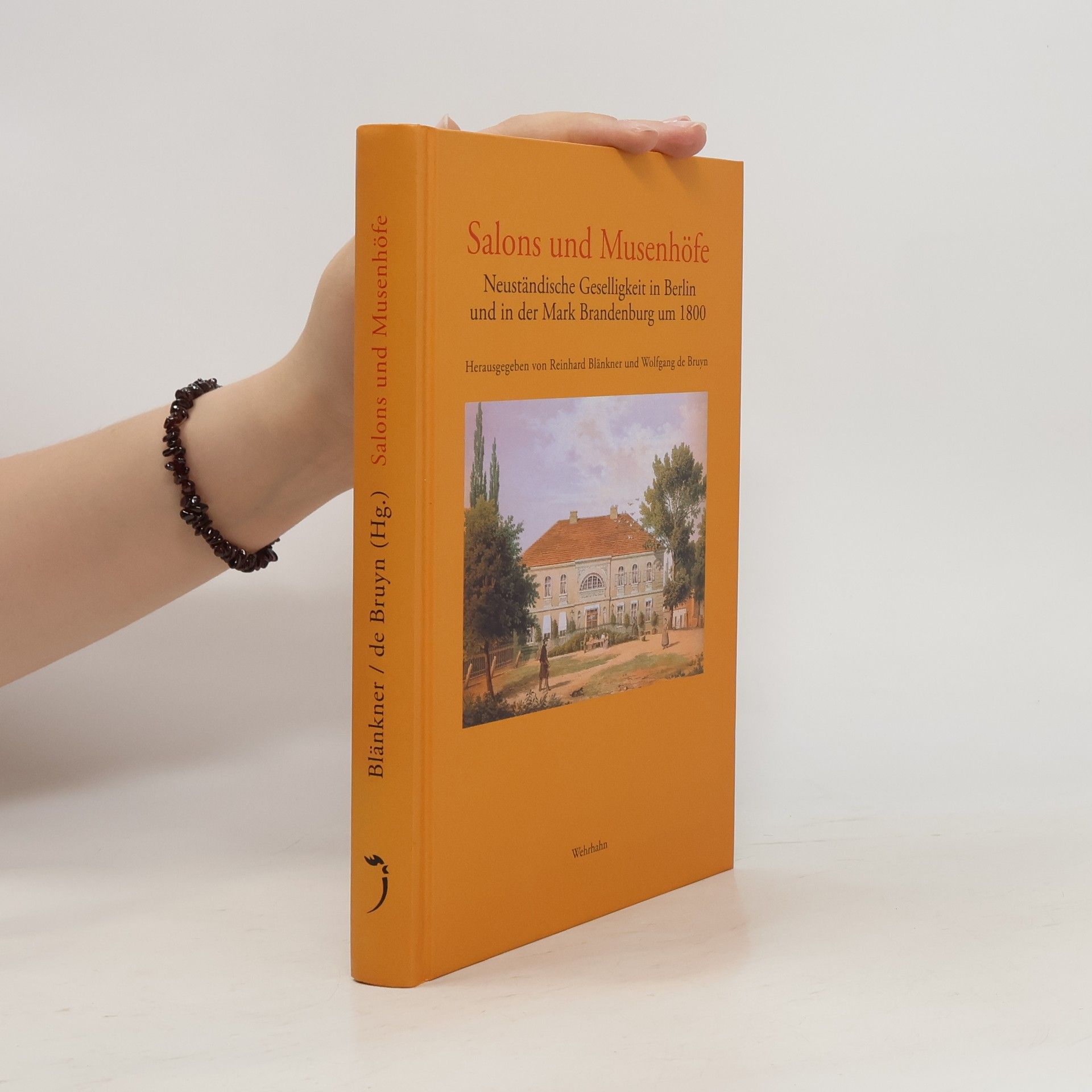
Neuständische Geselligkeit in Berlin und in der Mark Brandenburg um 1800
Perspektiven der Kulturgeschichte im Ausgang von Heinz Dieter Kittsteiner