Philosophische Terminologie
Zur Einleitung. Band 2
SCHNELLVERSAND! 1-2 Werktage. 325 S. Taschenbuch 1974. Seiten Sehr guter Zustand
Theodor W. Adorno war einer der bedeutendsten deutschen Philosophen und Gesellschaftskritiker nach dem Zweiten Weltkrieg. Sein Einfluss wurzelte in der interdisziplinären Natur seiner Forschung und seiner Zugehörigkeit zur Frankfurter Schule. Er untersuchte gründlich westliche philosophische Traditionen und bot eine radikale Kritik der gegenwärtigen westlichen Gesellschaft. Adornos Werk, das anfangs durch unzuverlässige Übersetzungen beeinträchtigt war, hat in englischsprachigen Ländern durch verbesserte Übersetzungen und posthum veröffentlichte Werke eine Renaissance erfahren und seine Wirkung auf Erkenntnistheorie, Ethik, Ästhetik und Kulturtheorie gefestigt.

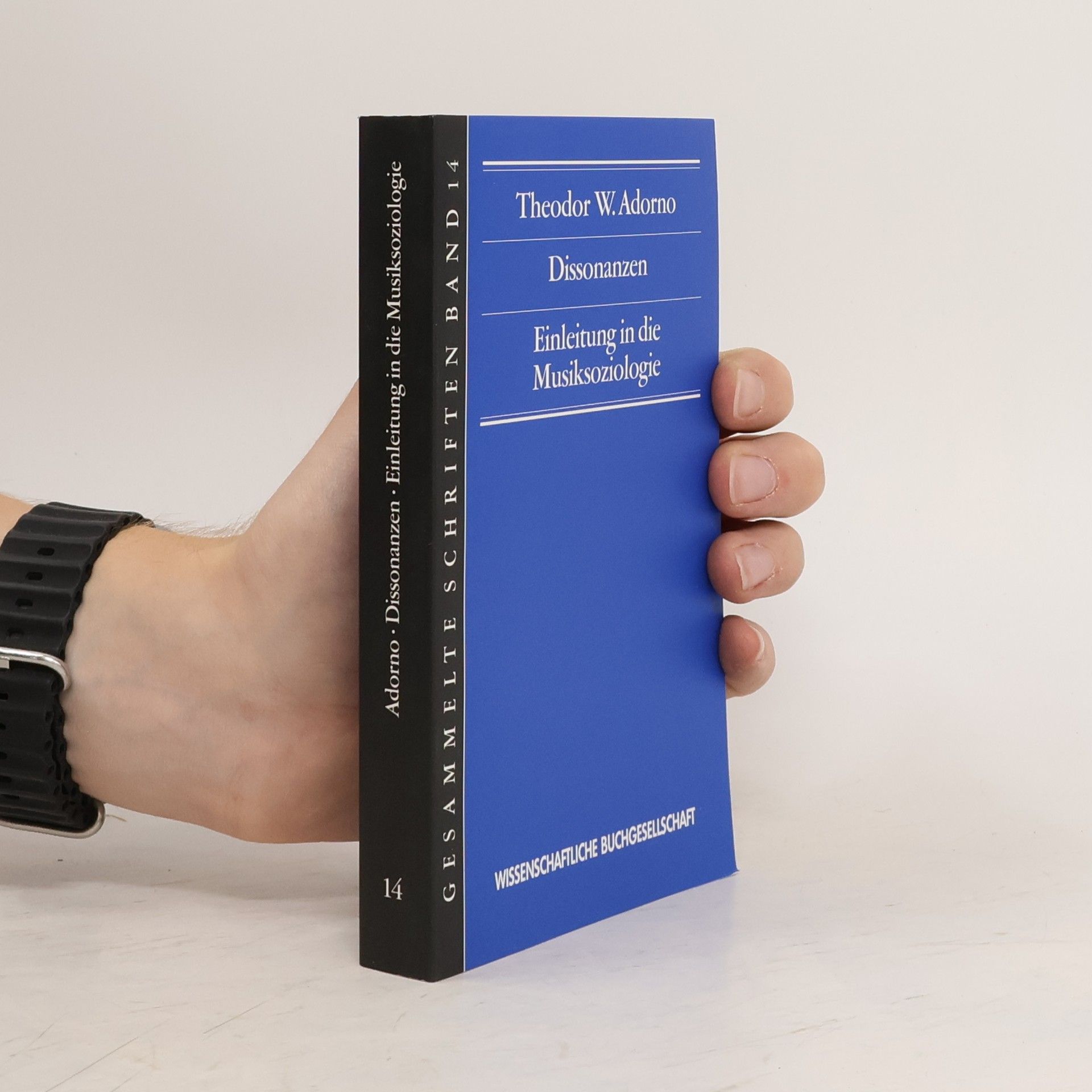
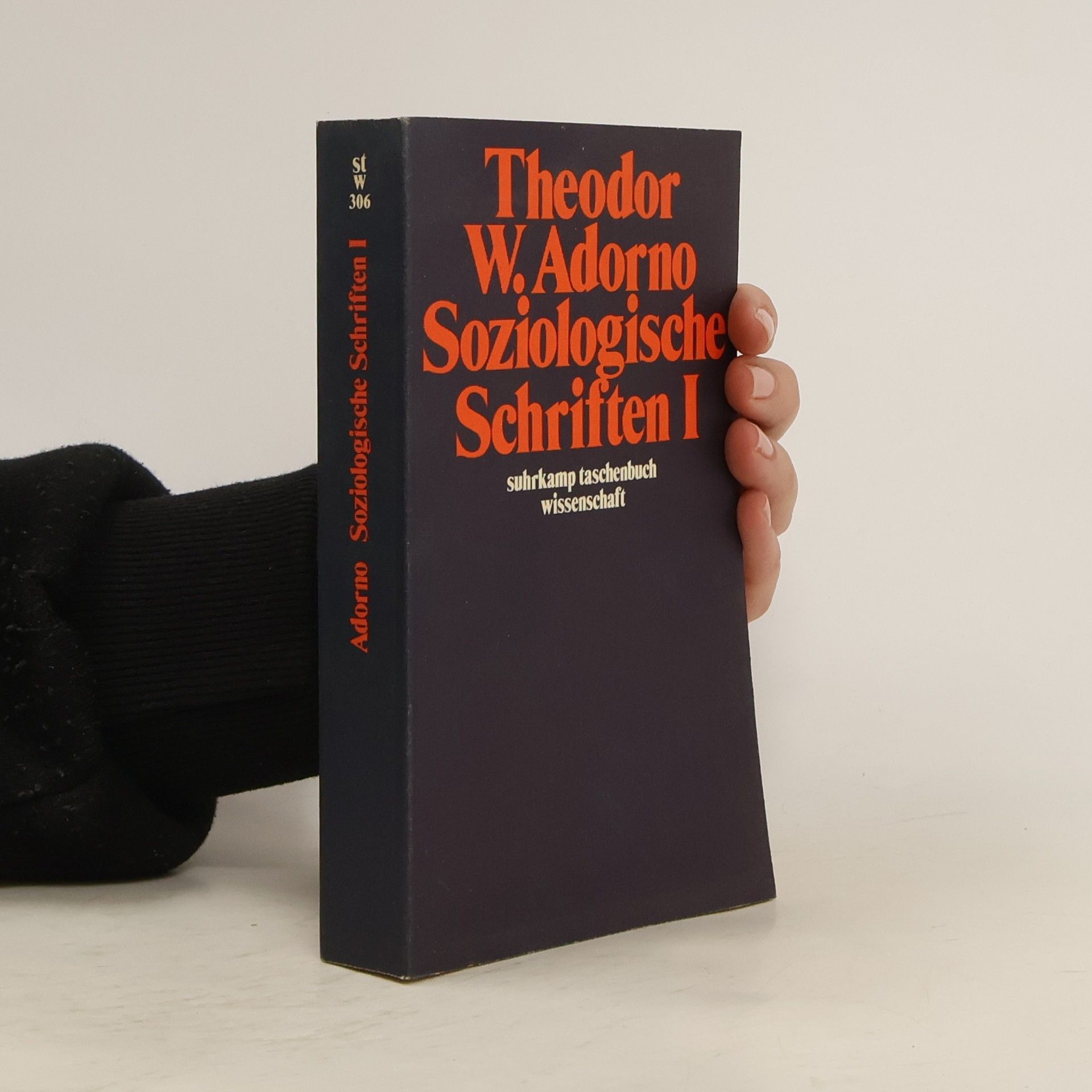


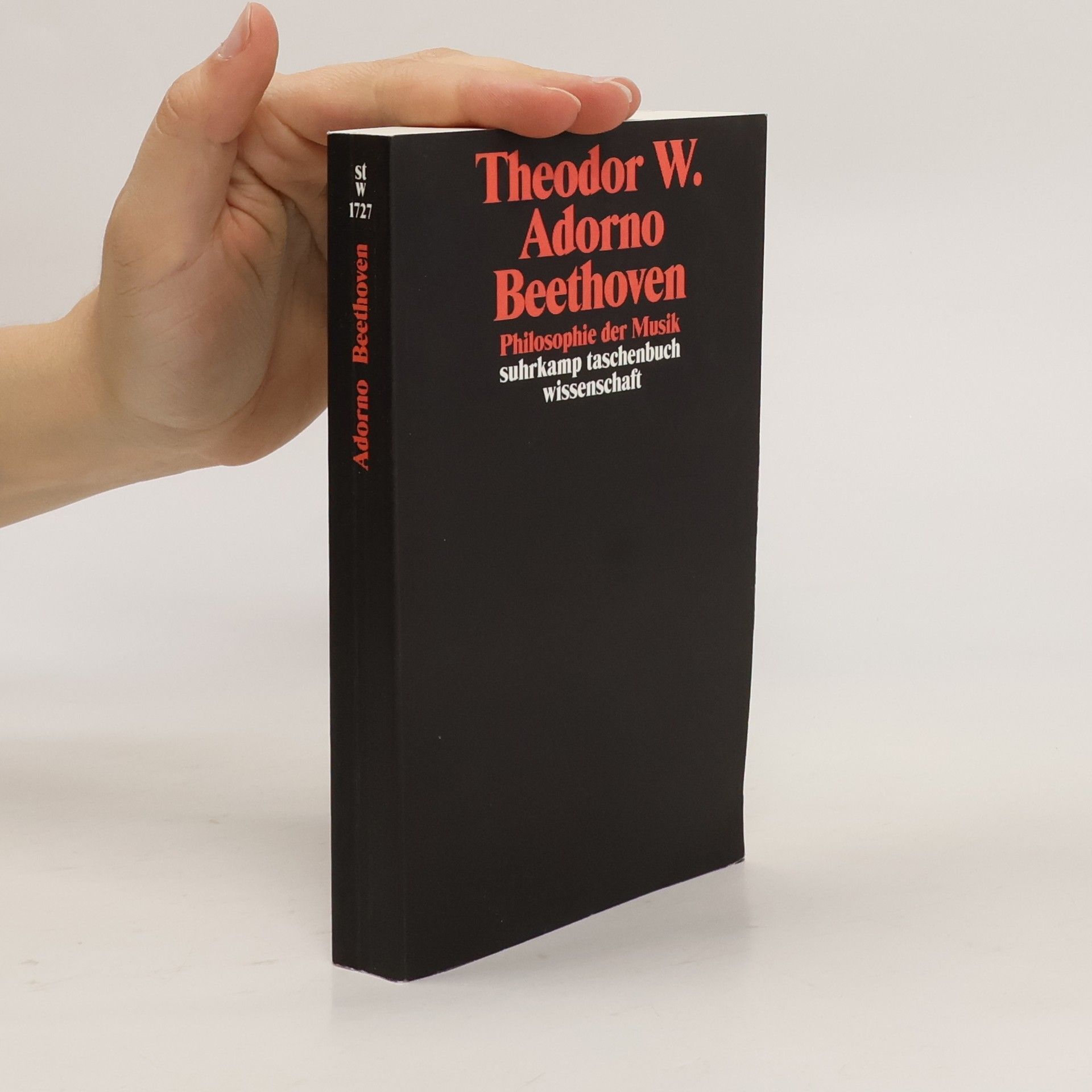
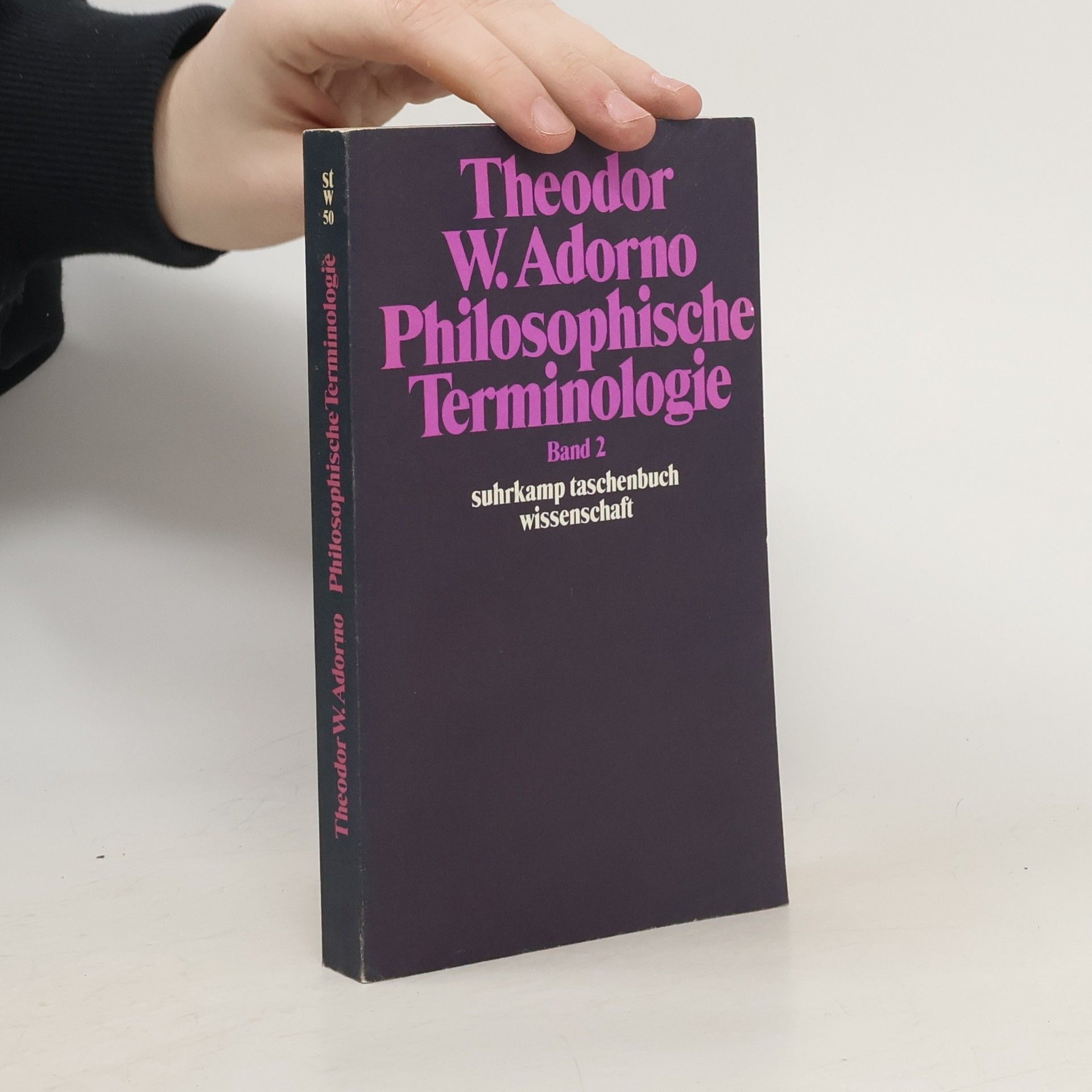
Zur Einleitung. Band 2
SCHNELLVERSAND! 1-2 Werktage. 325 S. Taschenbuch 1974. Seiten Sehr guter Zustand
Nur wenige literarische Pläne hat Adorno ähnlich lange und intensiv verfolgt wie sein Beethovenprojekt, aber keiner blieb in einem vergleichbar frühen Stadium der Arbeit stecken. Ein »philosophisches Werk über Beethoven« projektiert er nach eigenen Angaben seit 1937, die ältesten erhaltenen Aufzeichnungen datieren vom Frühjahr oder Sommer 1938, unmittelbar nach Adornos Übersiedlung nach New York. Nach Kriegsende und der Rückkehr nach Frankfurt am Main werden wiederum nur Notizen und Aufzeichnungen festgehalten, die dann 1956 nahezu abrupt abbrechen. Im Aufsatz über die Missa solemnis, den er 1964 in den Sammelband Moments musicaux aufnahm, heißt es über sein »längst entworfenes Beethovenbuch«: »Bislang kam es nicht zur Niederschrift, vor allem weil die Anstrengungen des Autors immer wieder an der Missa Solemnis scheiterten«. Bis zuletzt ist es »nicht zur Niederschrift« gekommen. Die vorliegende Ausgabe versammelt aus dem Nachlaß sämtliche Vorarbeiten Adornos, die überaus zahlreichen Aufzeichnungen und Notizen sowie wenige ausgearbeitete Texte. Entstanden ist ein Tagebuch über Erfahrungen mit der Musik Beethovens, wie Adorno selbst seine Beethoven-Fragmente bezeichnet hat.
Die Vorlesung über Negative Dialektik ist die letzte der vier Vorlesungen aus den Jahren 1960 bis 1966, die die Entstehung von Adornos Negativer Dialektik begleiteten. Zusammen mit den drei vorangehenden Vorlesungen – Ontologie und Dialektik, Zur Lehre von der Geschichte und von der Freiheit sowie Metaphysik. Begriffe und Probleme – bildet sie sowohl eine Propädeutik als auch den Selbstkommentar zu Adornos Hauptwerk von 1966. In der Variation von Themen, die sich im Buch unter dem Titel »Einleitung« finden, entfaltet Adorno in den Vorlesungen eine »Theorie der geistigen Erfahrung«, in der er diejenige Philosophie zu charakterisieren versucht, die ihm stets vorschwebte. Diese Theorie galt ihm denn auch für nichts weniger als eine Methodologie seiner Philosophie überhaupt.
Die Vorlesungen Adornos aus dem Jahr 1958 lösen noch immer ein, was ihr Titel verspricht: Sie geben eine Einführung in die Dialektik. Anders als etwa die »Negative Dialektik« oder die Arbeiten zu Hegel setzen sie keine Kenntnisse der philosophischen Tradition voraus und lassen sich als Propädeutik zu diesen Schriften lesen. Sie richten sich aber auch an denjenigen, der der Dialektik ablehnend gegenübersteht, weil sie systematisch von den »Schwierigkeiten« mit ihr, von den »Vorurteilen und Widerständen« gegen sie und von den »Zumutungen, vor die die Dialektik stellt« ausgehen.
Als Band 8 der Gesammelten Schriften Adornos erscheint der erste Teil seiner soziologischen Arbeiten. Gesellschaftliches ist der Gegenstand dieser Aufsätze. Es ist im Grunde der Gegenstand des gesamten Denkens von Adorno, da es in allen geistigen, kulturellen und sozialen Phänomenen die Spuren der Vergesellschaftung aufzuweisen trachtet. Deshalb bilden die Soziologischen Schriften nicht eigentlich eine Sondergruppe in seinem Werk, sie sind vielmehr ein integraler Bestandteil der Adornoschen Philosophie. Aber sie zeigen vielleicht leichter, weil direkter auf die gesellschaftliche Wirklichkeit und ihre Diagnose bezogen, welchen Beitrag dieses Philosophieren zur "Kritischen Theorie der Gesellschaft" geleistet hat. Sie zeigen auch, warum Adornos Denken bei manchen seiner Schüler eine Wendung hat nehmen können, die in ihm selbst nicht vorgeprägt ist, für die es aber gleichwohl, dialektisch vermittelt, die Weichen gestellt hat.
Begriff und Probleme (1965)
Die Metaphysik-Vorlebung vom Sommer 1965 ist ein echtes „work in progress“ oder besser: ein bestimmtes Stadium der noch im Entstehen begriffenen Negativen Dialektik, an der Adorno zu dieser Zeit mit Hochdruck arbeitete. Sie ist aber auch die einzige Behandlung eines Themas aus der antiken Philosophie Adornos, und geht in dieser Hinsicht weit über die negative Dialektik hinaus: Zwei Drittel der Vorlesung sind der Metaphysik des Aristoteles gewidmet und verfolgen die Geschichte des „metaphysischen Denkens als den “Versuch der Rettung ursprünglich theologischer Kategorien„mit den Mitteln der Vernunft. Der letztlich affirmative Charakter, der der klassischen Matephysik seit Platon und Aristotelesanhaftet, wird ihr jedoch zum Verhängnis. Denn durch die “Welt der Tortur„ hat sich der Stellenwert der Metaphysik vollkommen verändert. Die Frage “ob man nach Auschwitz überhaupt noch leben kann„ ist zwar die äußerste Negation metaphysischen Denkens, aber auch die eigentliche Gestalt, in der die Metaphysik “einem heute auf den Fingern brennt".
Die hier zusammengestellten Aufsätze und Vorträte aus den Jahren 1942 bis 1968 dokumentieren Formen und Absichten der soziologischen Reflexion, die für Adorno charakteristisch sind: die Entfaltung des Begriffs an der gesellschaftlichen Wirklichkeit und deren Verarbeitung im Erkenntnisprozeß. In ihnen ist eingelöst, was Adorno selbst als Versprechen gesellschaftlicher Kritik bestimmt hat: Differenzierung des Urteils an seinem Gegenstand.
und weitere Texte
1948 schrieb Theodor W. Adorno einen bis heute unpublizierten Text zum autoritären Charakter, in dem es nicht so sehr um einen Rückblick auf die Nazi-Barbarei geht, sondern vor allem und allgemeiner um das Individuum im Spätkapitalismus, das in Unmündigkeit gezwungen ist, diese aber auch zu wählen scheint. Besonders intensiv erörtert er die Dialektik der Aufklärung und die Bedeutung des Antisemitismus für die Kritische Theorie – also Themen, die angesichts der heutigen Krise des Politischen nichts an Aktualität eingebüßt haben. Neben den erstmals publizierten »Bemerkungen« enthält der Band weitere Schlüsseltexte zum autoritären Charakter und zur öffentlichen Meinung. Ein Kommentar der Herausgeberin erläutert deren Entstehungskontext und stellt Bezüge zu heutigen Debatten her.