Leonie Schneider Bücher
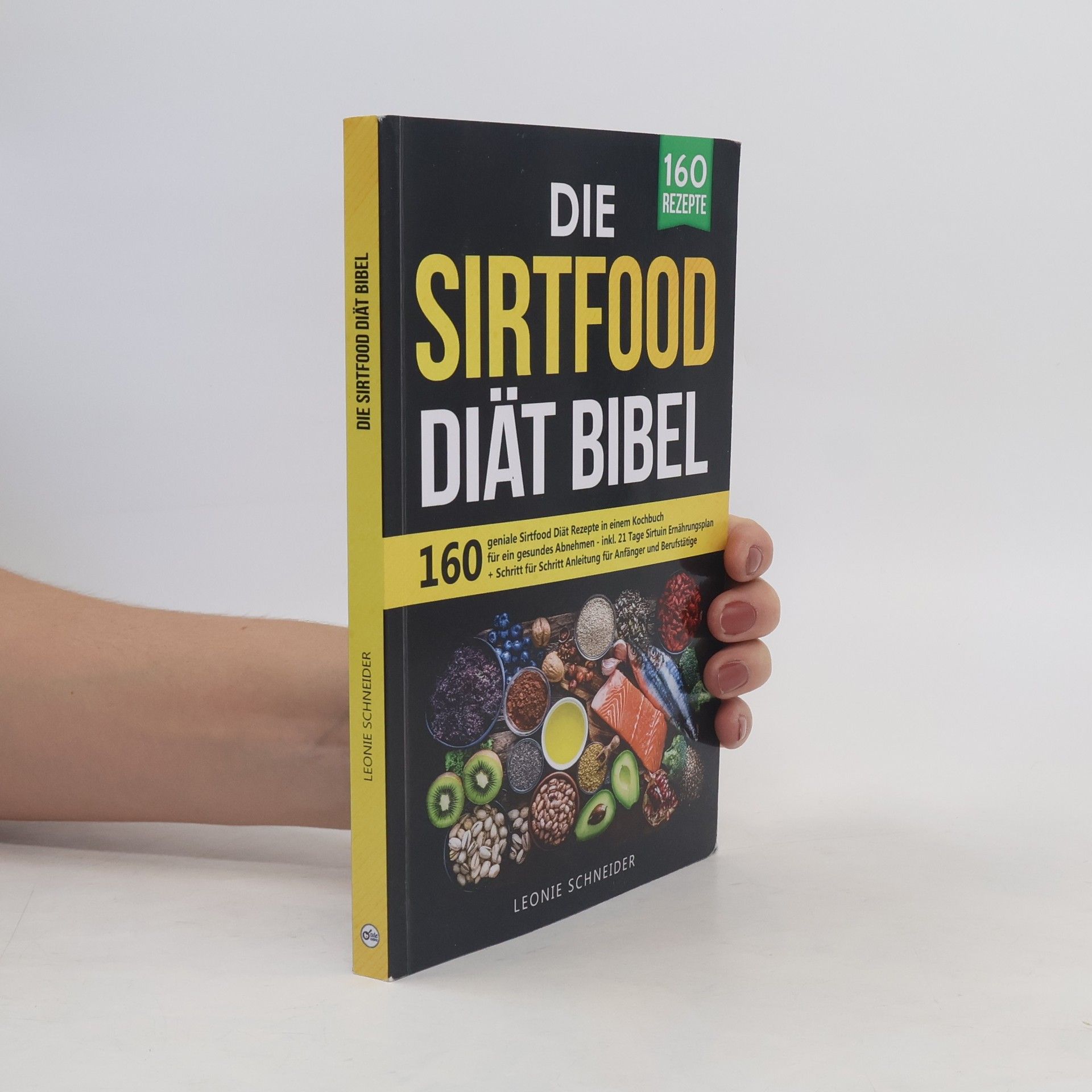


Die Sirtfood Diät Bibel
160 geniale Sirtfood Diät Rezepte in einem Kochbuch für gesundes Abnehmen. Inkl. 21 Tage Sirtuin Ernährungsplan + Schritt für ... Anfänger und Berufstätige
- 210 Seiten
- 8 Lesestunden
Mit dem 21 Tage Ernährungsplan der Sirtfood Diät kannst du endlich das Bauchfett schmelzen lassen. Suchst du ein praktisches Kochbuch mit nährstoffreichen Rezepten für eine erfolgreiche Diät? Möchtest du dich fitter fühlen und fast nebenbei Gewicht verlieren? Dieses Buch ist dein idealer Begleiter und bietet 160 einfache, geniale Rezepte mit verschiedenen Sirtfoods und Nährwertangaben für deinen dauerhaften Erfolg. Eine Ernährung mit Sirtfoods ermöglicht Gewichtsreduktion, ohne Muskelmasse zu verlieren. Es ist möglich, mehr als 3 Kilogramm in einer Woche abzunehmen, ohne auf Rotwein oder Schokolade verzichten zu müssen. Die Sirtfood Diät hat sich als erfolgreich erwiesen, nicht nur bei Stars aus Sport und Mode, sondern auch für viele, die ihr Traumgewicht erreichen möchten. Diese Ernährungsweise erfordert kein monatelanges Hungern. Das Buch enthält zudem Tipps zur dauerhaften Ernährungsumstellung und eine Sirtfood Challenge. Lass dich von den herausragenden Rezepten überzeugen und starte noch heute mit der Sirtfood Diät. Füge das Buch jetzt mit nur einem Klick in deinen Warenkorb hinzu und entdecke, wie nährstoffreiche Rezepte zu körperlichem Wohlbefinden, Krankheitsvorbeugung und einem langen, gesunden Leben beitragen können.