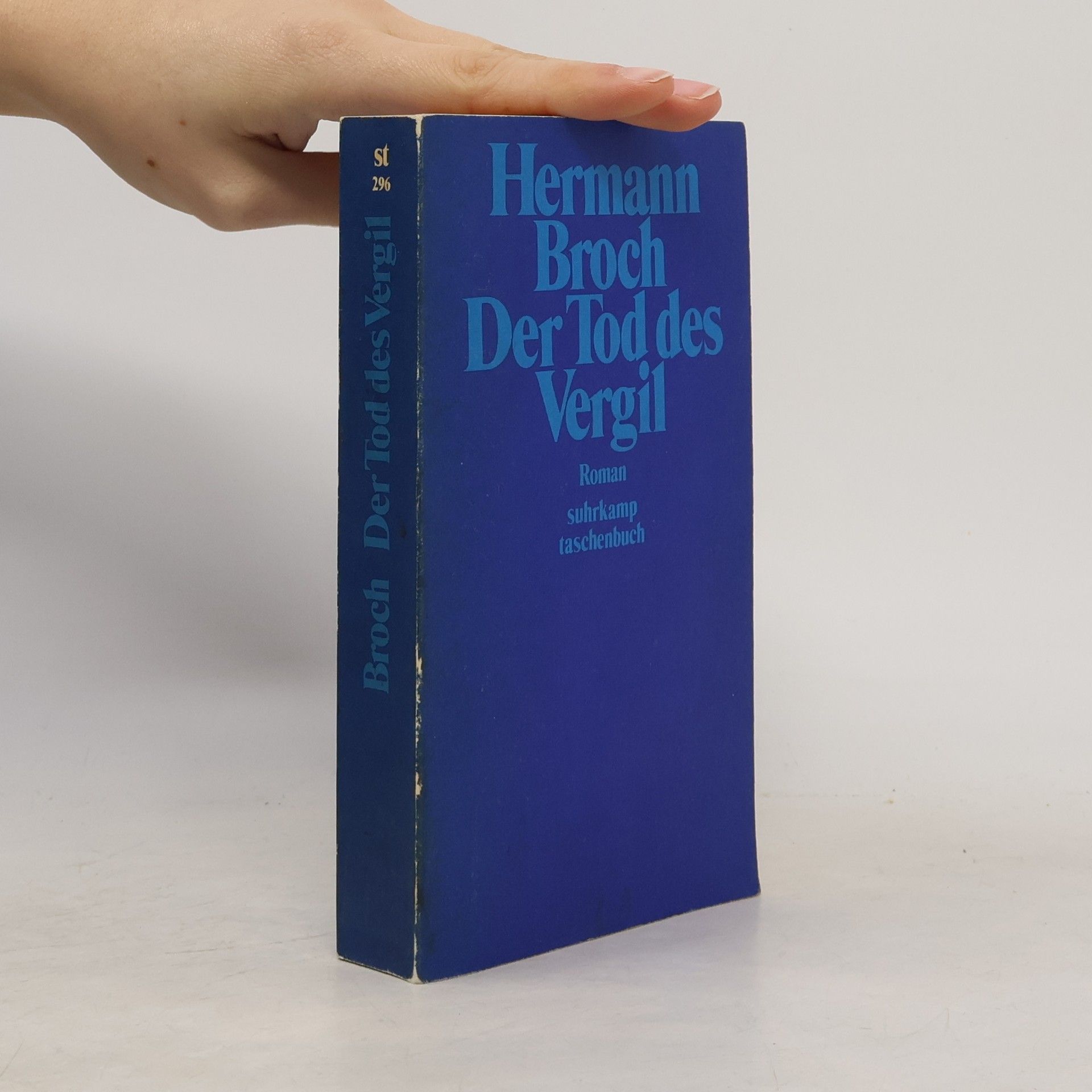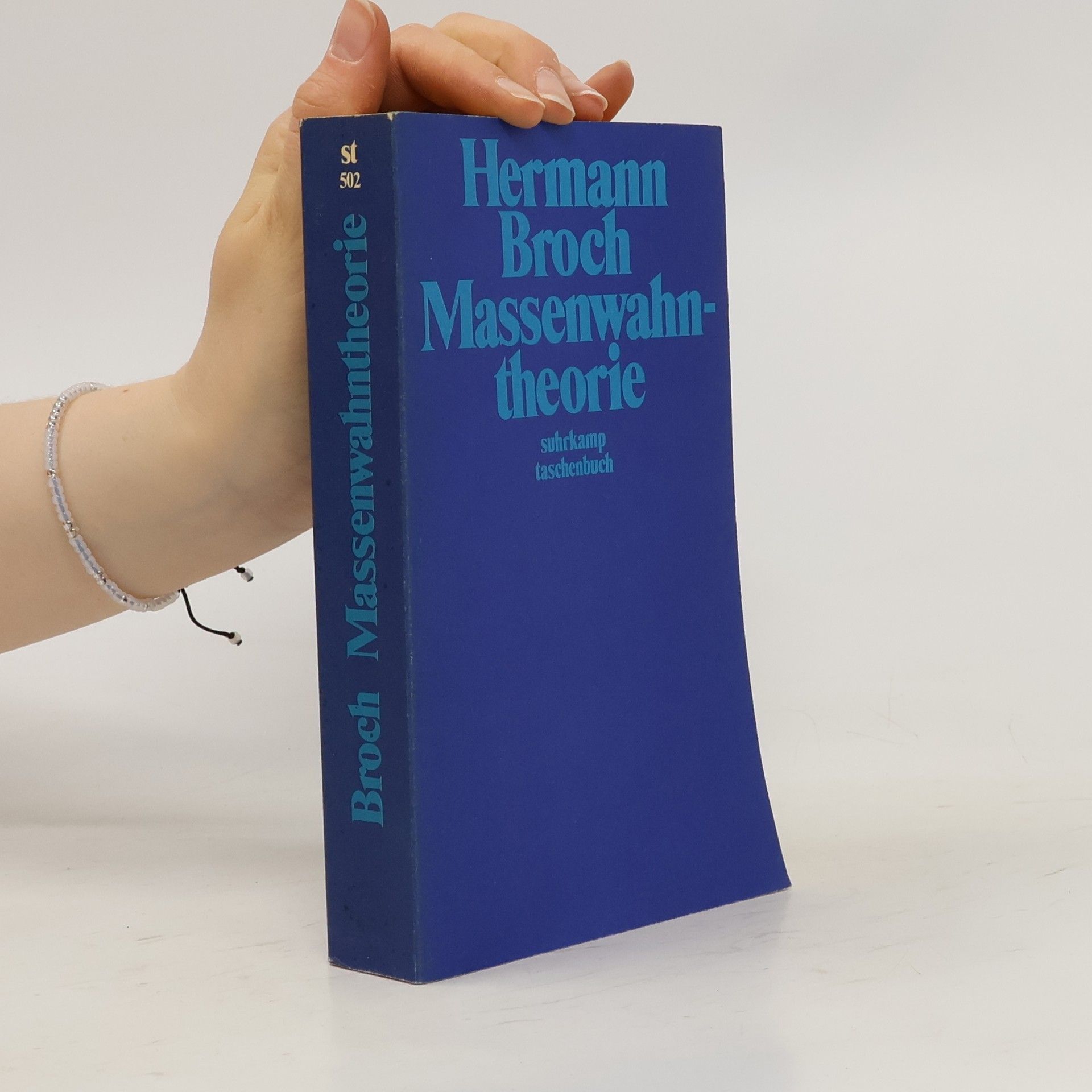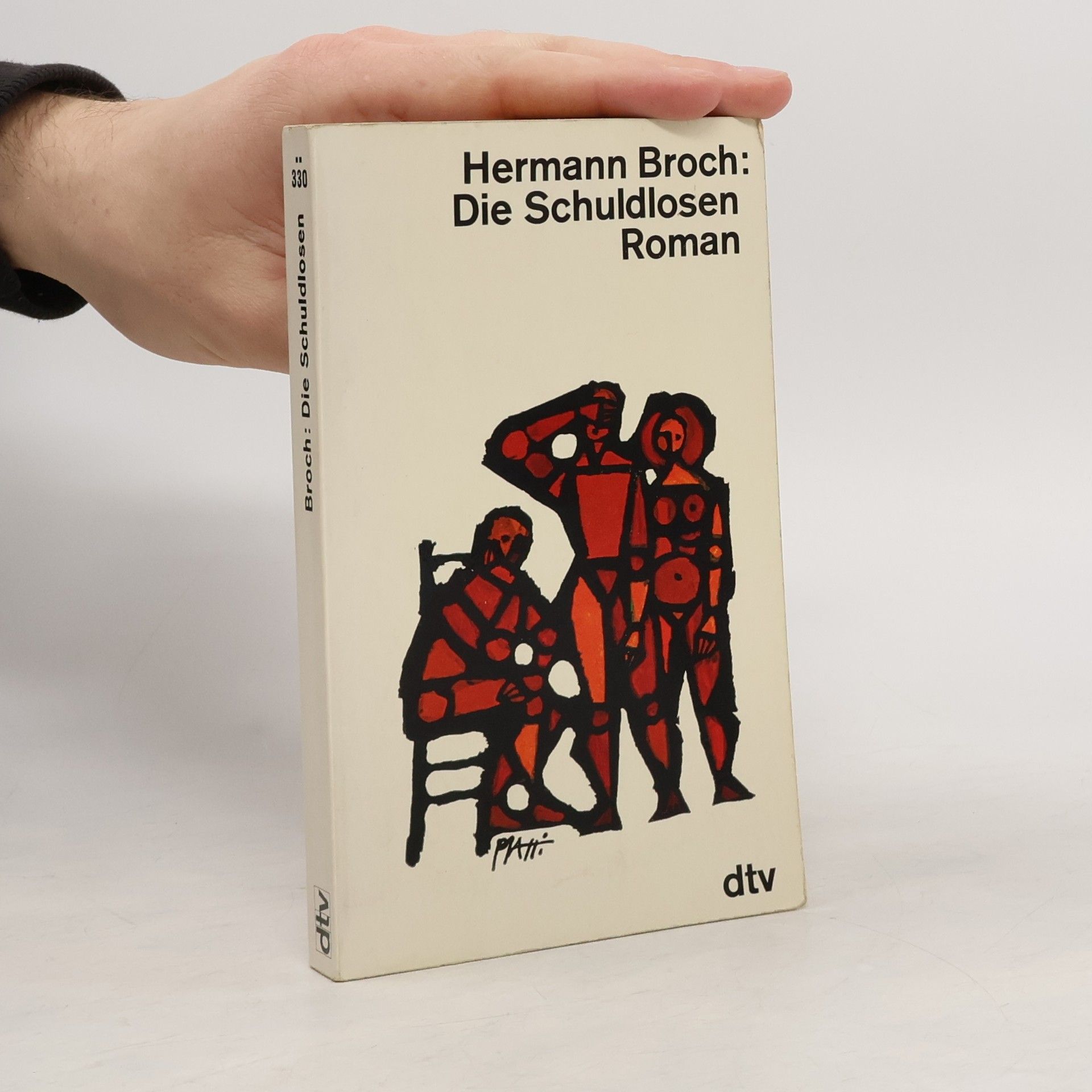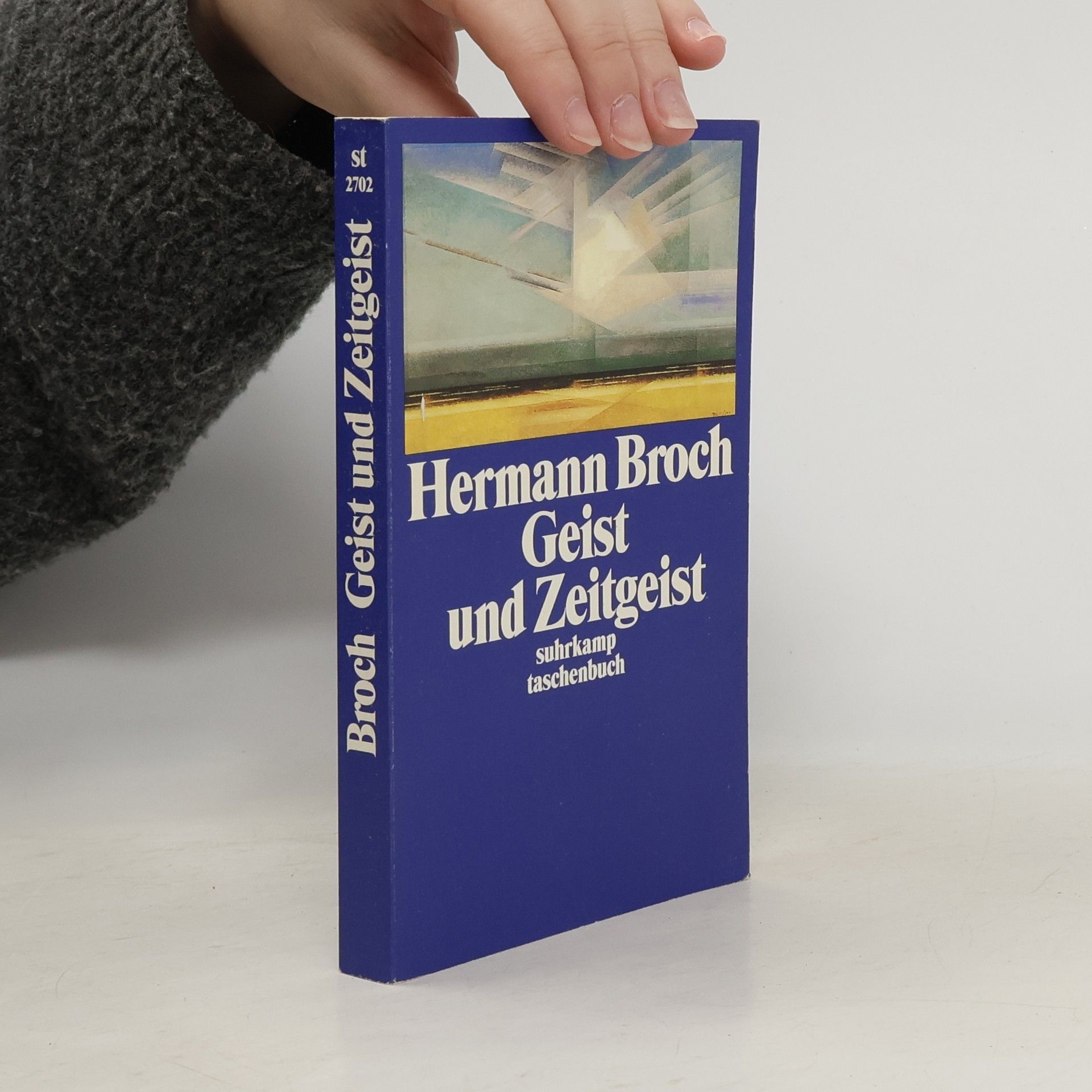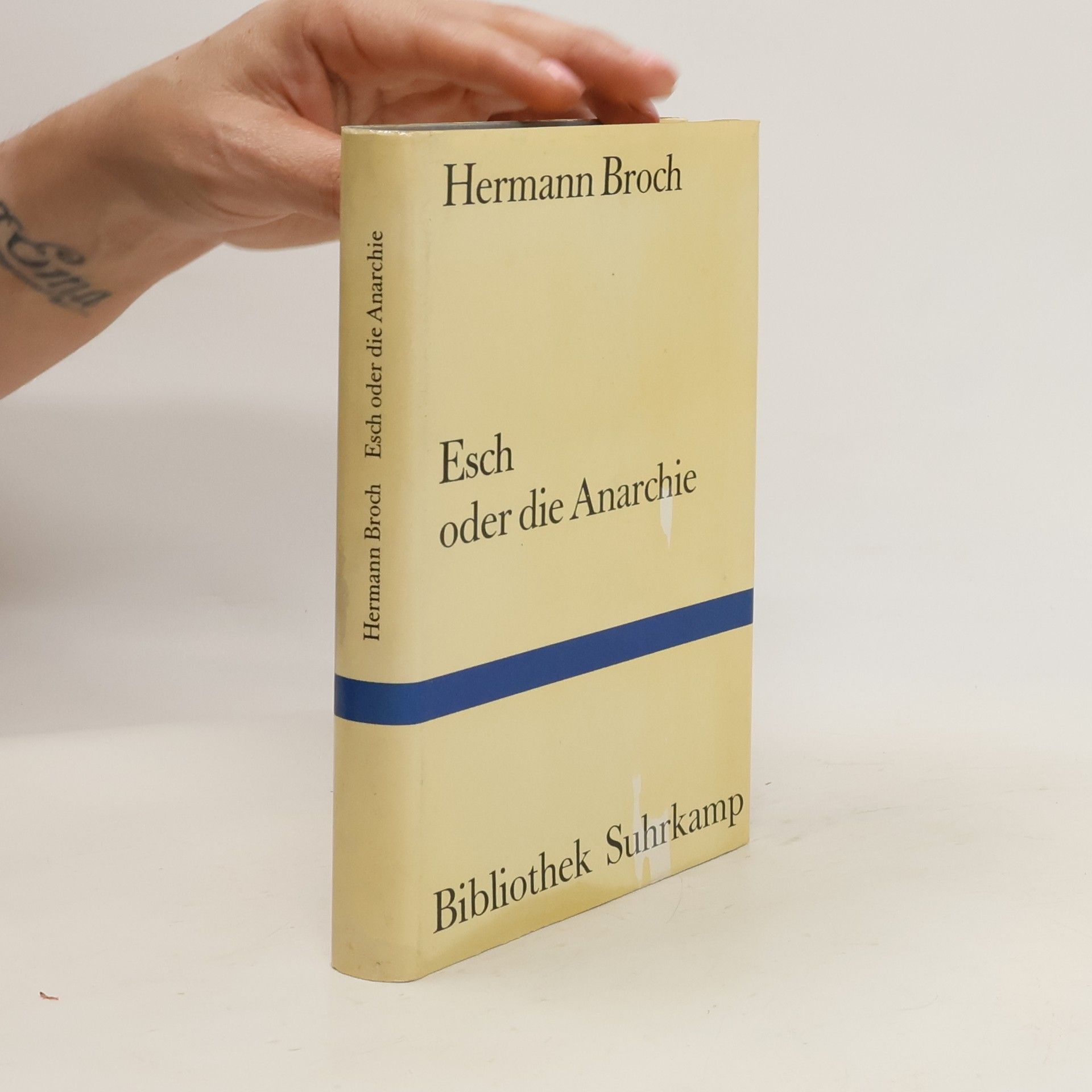Hofmannsthal und seine Zeit
Eine Studie
»›Mythisch ist alles Erdichtete, woran du als Lebender Anteil hast. Im Mythischen ist jedes Ding durch einen Doppelsinn, der sein Gegensinn ist, getragen: Tod = Leben, Schlangenkampf = Liebesumarmung. Darum ist im Mythischen alles im Gleichgewicht.‹ Diese Worte stehen in Hofmannsthals Buch der Freunde, und sie melden die Problemkonstanz, die dem Hofmannsthalschen Leben und seiner Arbeit eine unverbrüchlich eigensinnige Richtung gegeben hat; unverbrüchlich hat er sich um die Stellung des Menschen im Kosmos und um das ethische Gleichgewicht bemüht, das zwischen Ich und Sein etabliert werden soll, auf daß das Menschenleben zur Einheitlichkeit werde.« Indirekt vergegenwärtigte sich Hermann Broch mit seiner Hofmannsthal-Studie von 1947/48 aus dem amerikanischen Exil heraus die eigene Jugend in Wien. Hofmannsthal und seine Zeit ist ein autobiographisches Buch vor allem in dem Sinne, daß es die Summe seiner kulturkritischen Schriften darstellt.