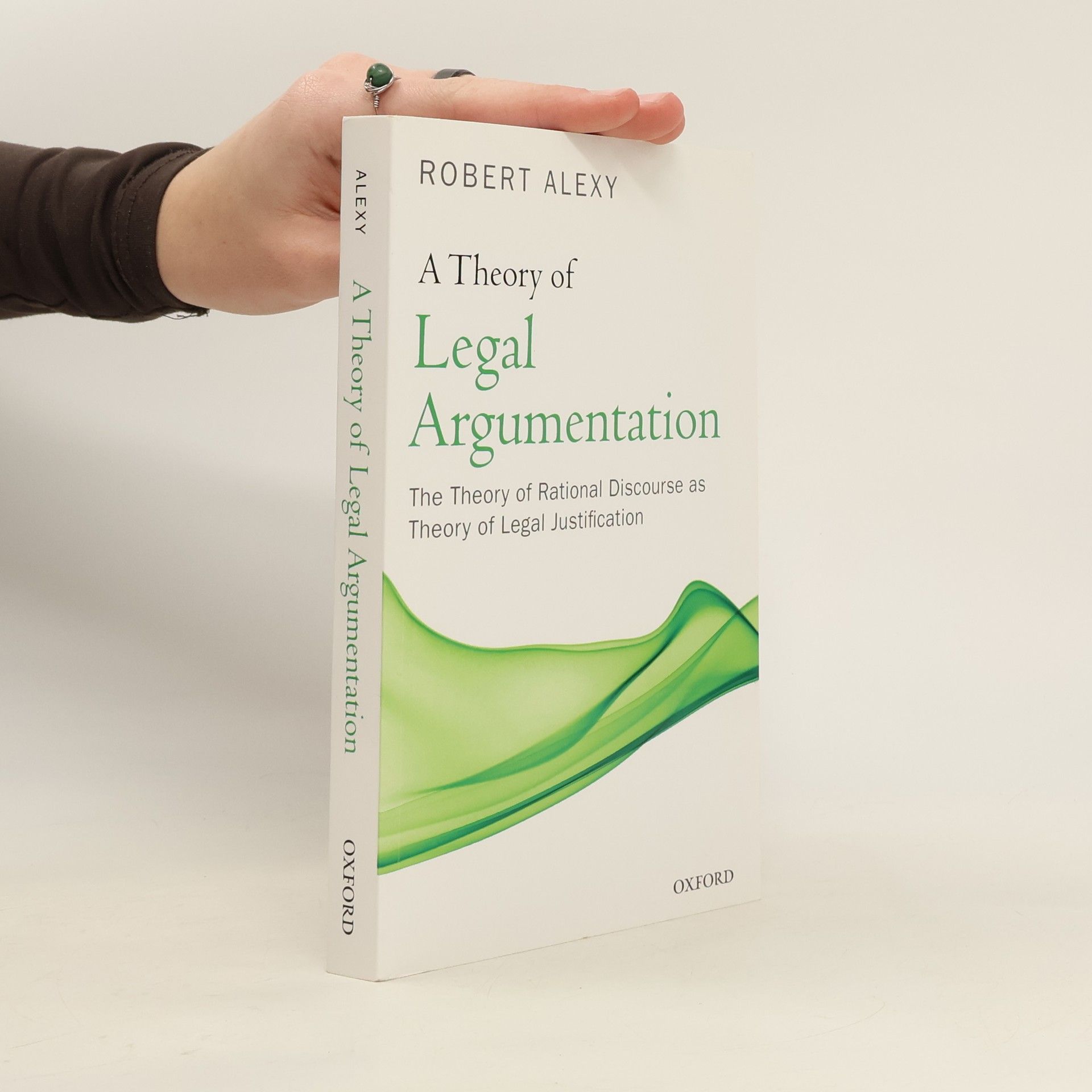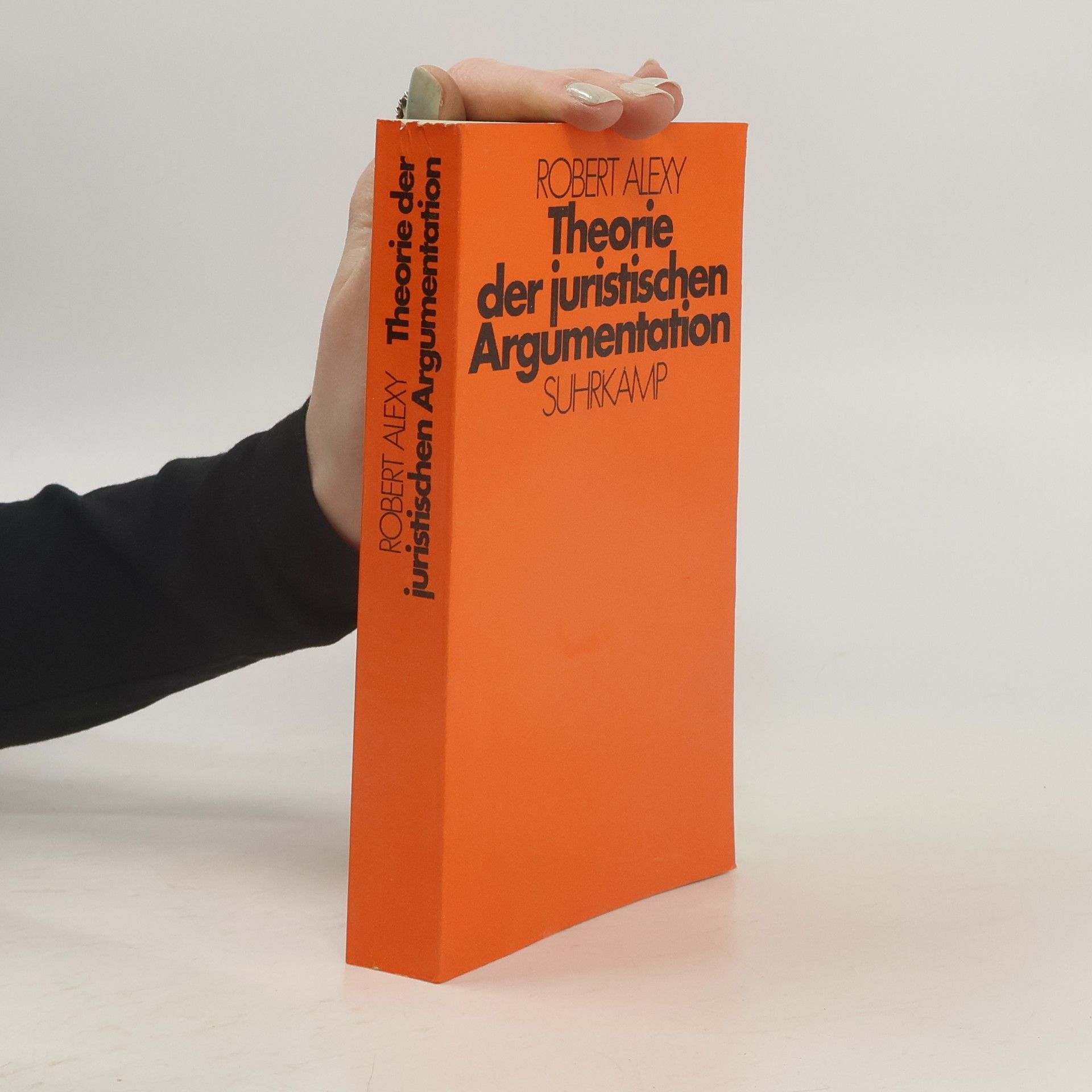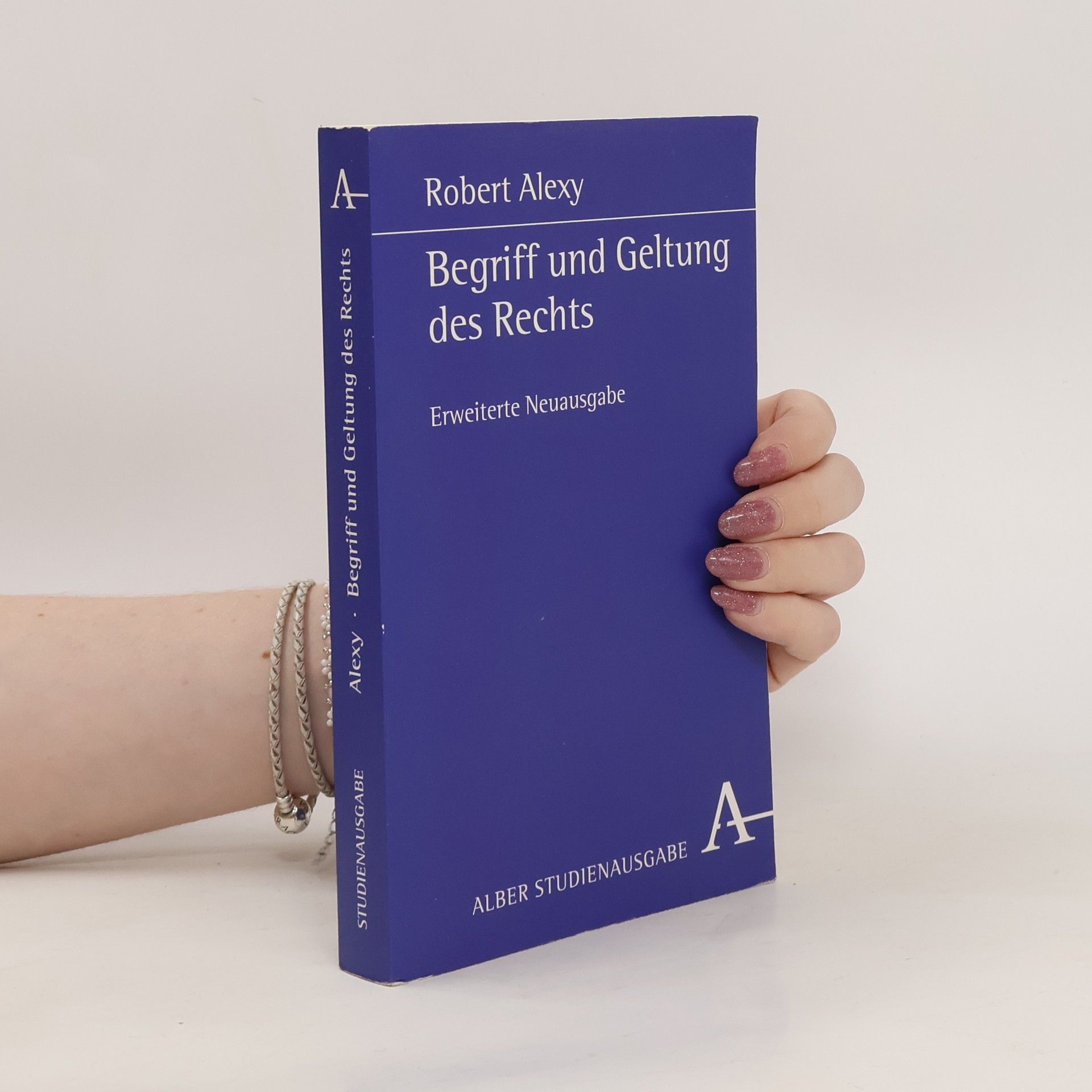Theorie der Grundrechte
- 548 Seiten
- 20 Lesestunden
Alexy unternimmt es, unter Berücksichtigung vor allem der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine allgemeine Theorie der Grundrechte des Grundgesetzes zu entwickeln. Ihre Kernstücke sind eine Prinzipientheorie und eine Theorie der Struktur subjektiver Rechte. Die Prinzipientheorie ist eine von unhaltbaren Annahmen gereinigte Werttheorie. Die Theorie der Struktur subjektiver Rechte macht die vielfältigen grundrechtlichen Verhältnisse exakt konstruierbar. Auf dieser Basis werden Hauptprobleme der Grundrechtsdogmatik behandelt. Das abschließende Kapitel gilt der Rolle der Grundrechte im Rechtssystem.