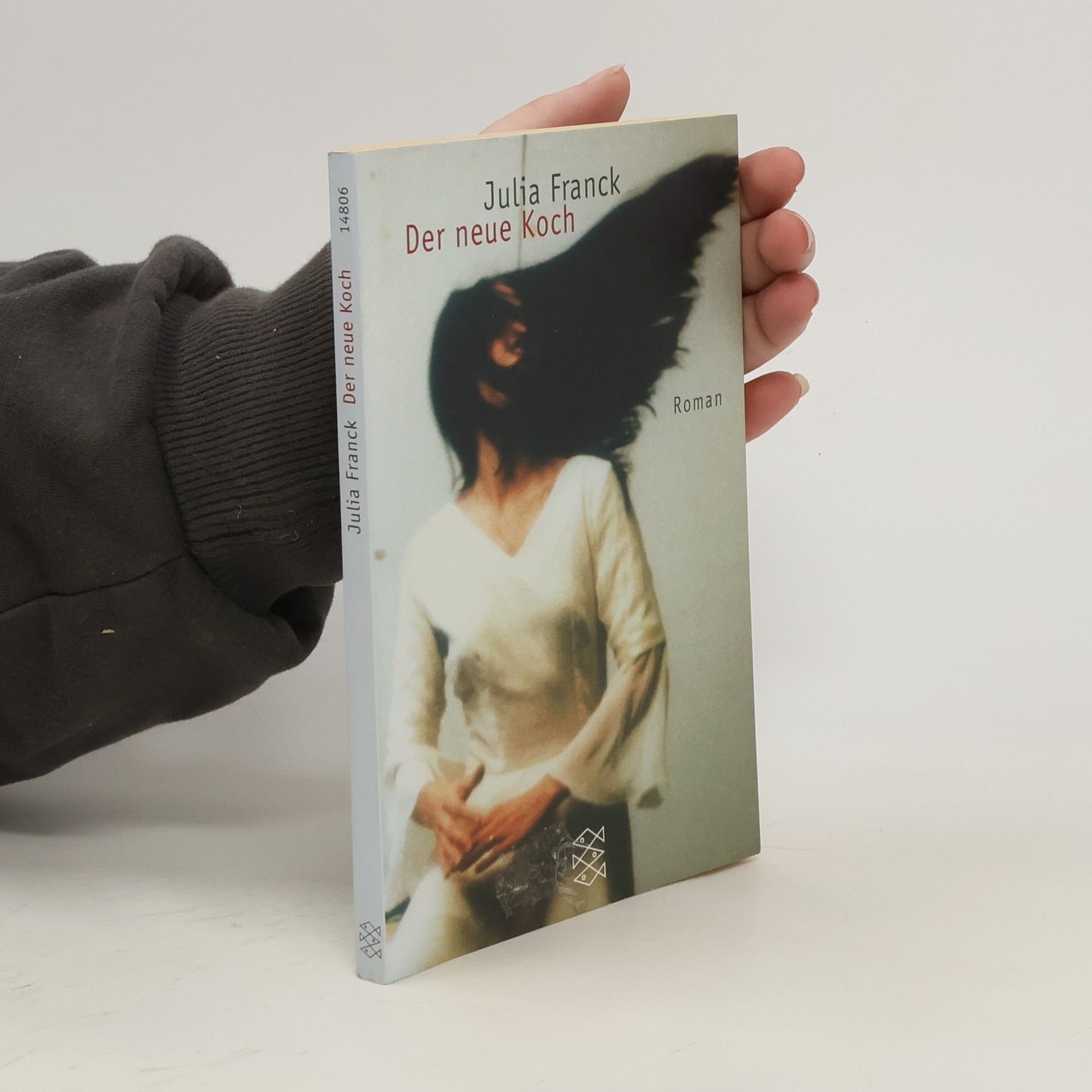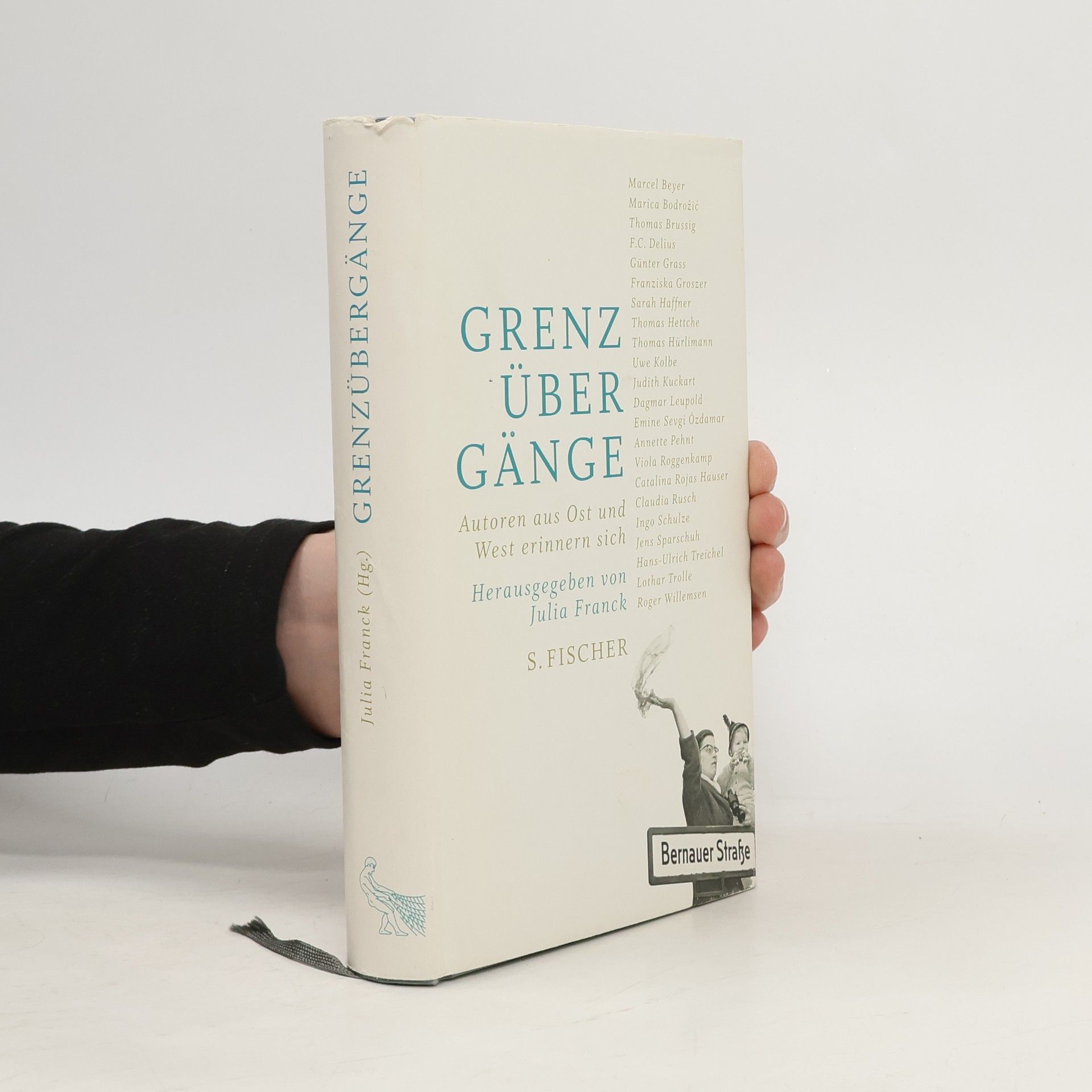8 raffinierte Geschichten von grossen Gefühlen und kleinen Niederträchtigkeiten, von Liebe und Lust, von Abscheu und Tod. (3sat-Preis 2000)
Julia Franck Bücher

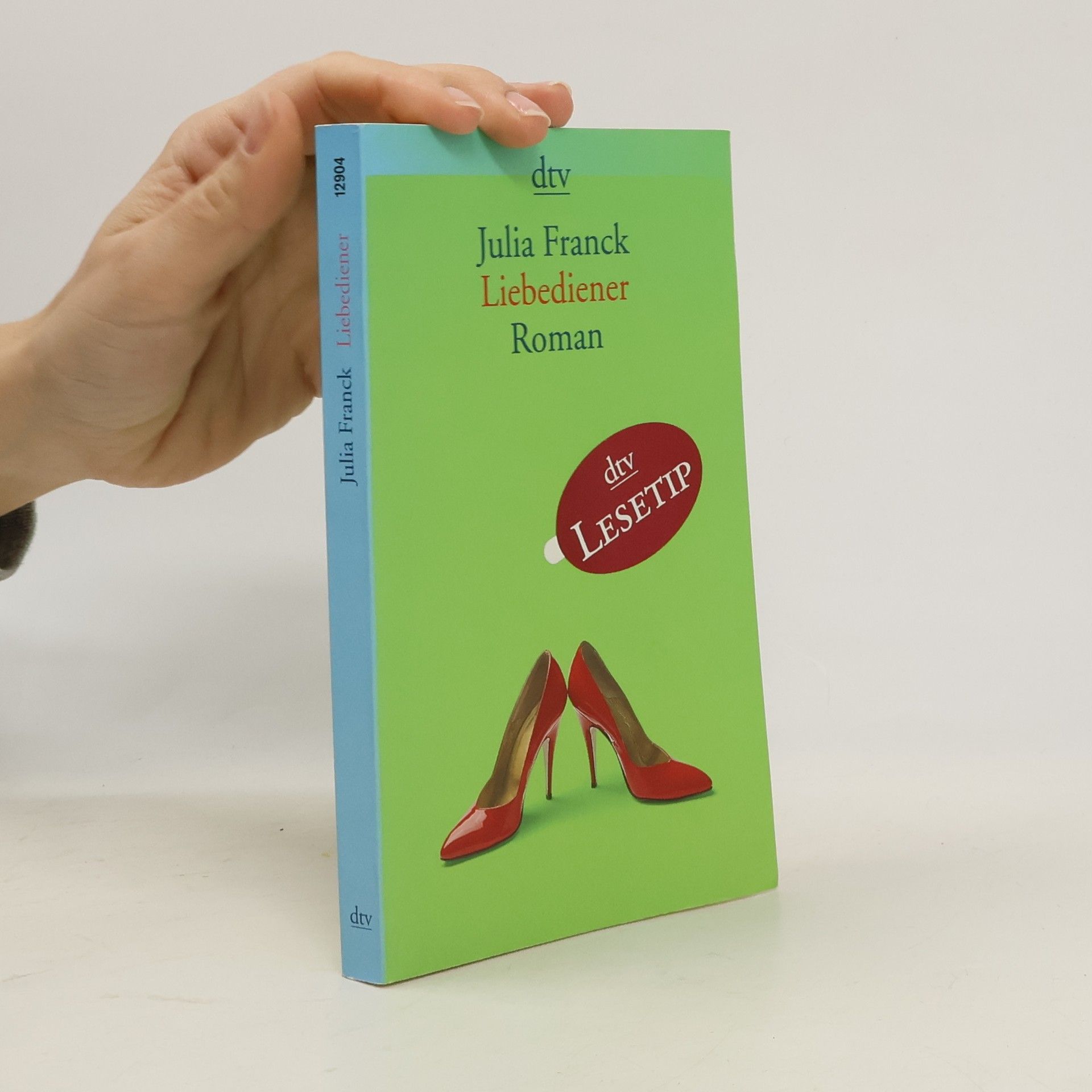

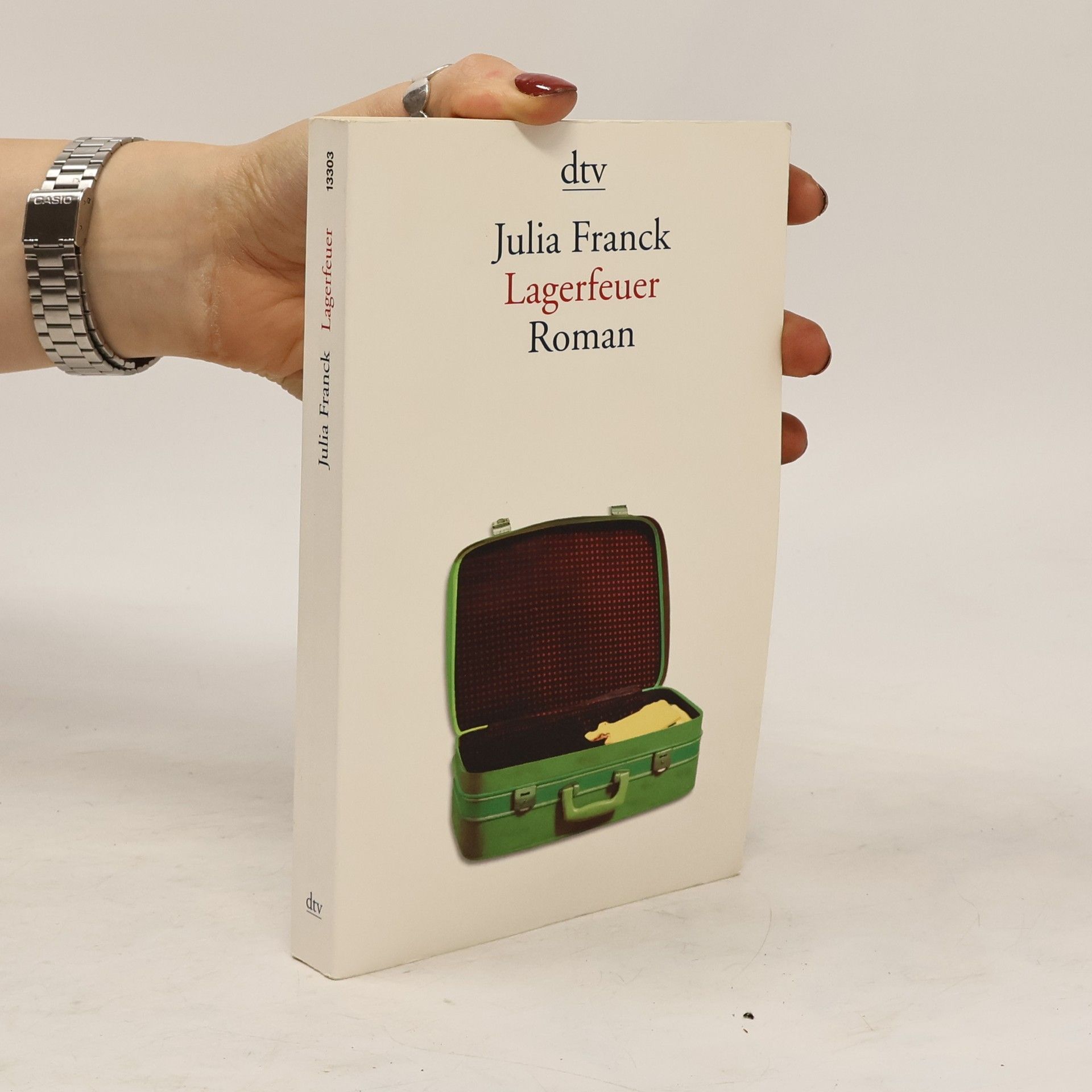



Welten auseinander
- 367 Seiten
- 13 Lesestunden
Das Mädchen wird in Ostberlin geboren. Julia ist acht, als ihre Mutter sie und die Schwestern in den Westen, erst ins Notaufnahmelager Marienfelde und dann nach Schleswig-Holstein mitnimmt. In dem chaotischen Bauernhaus kann die Dreizehnjährige nicht länger bleiben und zieht aus, nach Westberlin. Neben der Sozialhilfe verdient die Schülerin Geld mit Putzen, sie lernt ihren Vater kennen und verliert ihn unmittelbar, macht ihr Abitur und begegnet Stephan, ihrer großen Liebe. Wenn sie sich erinnert, ist es Gegenwart. »Welten auseinander« ist Julia Francks bewegende Erzählung einer ungewöhnlichen Jugend voller Brüche und Unsicherheiten; ein schmerzhaft-schönes Buch der Selbstbehauptung, das von Scham und Trauer so genau erzählt wie von Tod und Liebe. Schreiben und Literatur erweisen sich als Instrumente des Bleibens, vorerst.
Mir nichts, dir nichts
- 61 Seiten
- 3 Lesestunden
Julia Franck erzählt in ihren sinnlich aufgeladenen Geschichten von Wünschen und Fantasien. Eine junge Frau kümmert sich um ihre schlafende Schwester, während sie sich in Tagträumen verliert. Die Erzählungen zeigen das Zusammenspiel von Lust und Erzählkunst auf eindringliche Weise.
Lagerfeuer
- 330 Seiten
- 12 Lesestunden
4 Menschen berichten aus der Ich-Perspektive von ihrem Leben in und um ein Auffanglager in Westdeutschland: Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft verflüchtigt sich aber im Lageralltag.
Rücken an Rücken
- 380 Seiten
- 14 Lesestunden
Nach dem internationalen Erfolg von ›Die Mittagsfrau‹ erzählt Julia Franck in ihrem großen neuen Roman eine ergreifende Familiengeschichte im Deutschland der 50er und 60er Jahre. Ostberlin, Ende der 50er Jahre. Die Geschwister Ella und Thomas wachsen auf sich allein gestellt im Haus der Bildhauerin Käthe auf. Sie sind einander Liebe und Gedächtnis, Rücken an Rücken loten sie ihr Erwachsenwerden aus. Ihre Unschuld und das Leben selbst stehen dabei auf dem Spiel. Käthe, eine kraftvolle und schroffe Frau, hat sich für das kommunistische Deutschland entschieden. Leidenschaftlich vertritt sie die Erfindung einer neuen Gesellschaft, doch ihr Einsatz fordert Tribut. Im Schatten scheinbarer Liberalität setzen Kälte und Gewalt Ella zu. Während sie mal in Krankheit flieht und mal trotzig aufbegehrt, versucht Thomas sich zu fügen, doch nur schwer erträgt er die Erniedrigungen und flüchtet in die unglückliche Liebe zu Marie. Julia Franck zeichnet das Bild einer Epoche, die die Frage nach Aufrichtigkeit neu stellt. Sie erzählt von großer Liebe ohne Rückhalt und einer Utopie mit tragischem Ausgang – eine Familiengeschichte, die zum Gesellschaftsroman wird.
Liebediener
- 239 Seiten
- 9 Lesestunden
Beyla liebt es, in Kellerwohnungen zu wohnen, da sie von dort das Geschehen auf der Straße gut beobachten kann. Eines Tages sieht sie, wie ein rotes Auto mühsam aus einer Parklücke fährt. Plötzlich bemerkt sie eine Frau, die erschrocken ausweicht und unter die Straßenbahn gerät. Die Tote entpuppt sich als Charlotte, ihre Nachbarin. Niemand scheint das Auto bemerkt zu haben, und Beyla hütet sich, der Polizei etwas zu erzählen. Doch als Charlottes Tante ihr die Wohnung überlässt, zieht Beyla widerwillig in den dritten Stock des Mietshauses und findet sich im Leben der Verstorbenen wieder. Von ihrem Küchenfenster aus kann sie Albert beobachten, den mysteriösen Mann, den sie bereits auf Charlottes Beerdigung gesehen hat, und verliebt sich in ihn. Sie genießt die Zeit mit ihm und die Ausflüge in seinem roten Flitzer. Doch Albert weicht ihren Fragen über sich selbst aus und erzählt stattdessen erotische Geschichten. Zunächst ist Beyla damit zufrieden, doch bald will sie mehr über ihn erfahren. Stück für Stück fügt sich ein Puzzlestück zum anderen, und sie entdeckt, wer Albert wirklich ist und welche Rolle Charlotte in seinem Leben gespielt hat.
Draußen die weite Bucht, drinnen der Empfangstisch des engen Hotels: dazwischen spannt sich eine Bühne, auf der sich die Stammgäste jedes Jahr ihre Einsätze zuflüstern. Das Hotel gehört einer jungen Frau, die es von ihrer Mutter geerbt hat und keinen Sinn hat für „Tanztee“, und da ist der neue Koch, der Pikantes liebt und von der Küche aus den Laden übernehmen will. Die Stammgäste hat er schon auf seiner Seite ...
Grenzübergänge
- 281 Seiten
- 10 Lesestunden
Julia Franck, die achtjährig mit ihrer Familie die DDR verlassen hat, lädt zum zwanzigsten Jahrestag des Mauerfalls Autoren aus Ost und West ein, sich an die Grenze zu erinnern: Entstanden sind Geschichten, die an ehemalige Grenzorte erinnern, die von Angst und Wut erzählen, aber auch von Hoffnung und dem Triumph, diese Grenze überwinden zu können. Sie zeichnen ein Bild der konkreten Grenzorte, die heute vielfach nicht mehr sichtbar sind und sprechen von der Bedeutung des Eisernen Vorhangs als Hindernis, als Schwelle und als Verbindung zwischen Ost und West. „Die höchst unterschiedlichen Beiträge, die in diesem Band aufeinander treffen, öffnen jenen Raum, die Grenze – den Grenzraum, der trennend wirken sollte und zu dem doch beide Seiten gehören. Im Dazwischen, auf der Schwelle, hier befindet sich die Grenze; ihre Überwindung wie ihre Öffnung liegt im Erzählen.“ Julia Franck
Hydinové špeciality. 460 jedál z domácej hydiny a pernatej zveri
- 264 Seiten
- 10 Lesestunden
460 jedál z domácej hydiny (kura, sliepka, kačica, hus, morka, holuby, perlička) a pernatej zveri (divé kačice, bažanty).