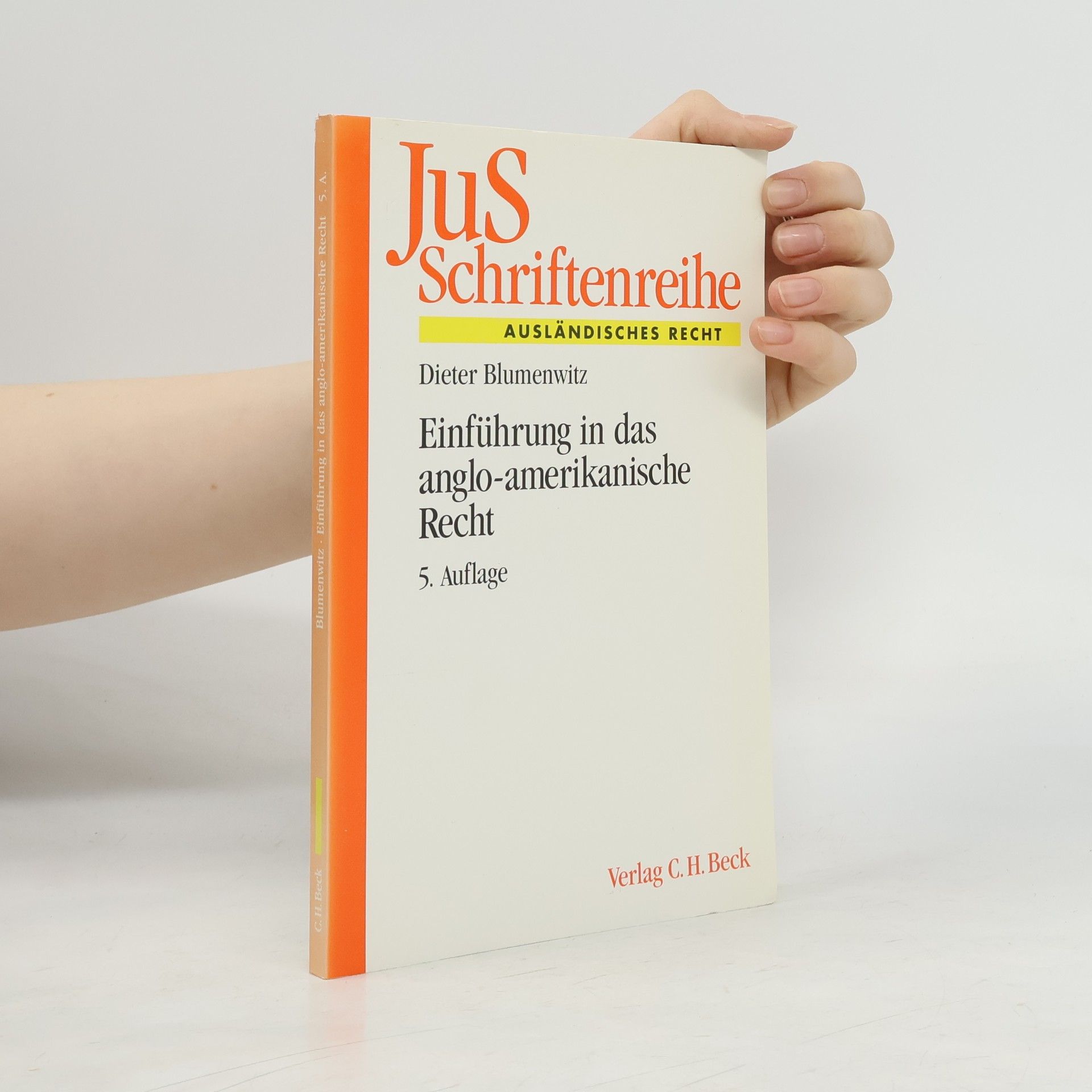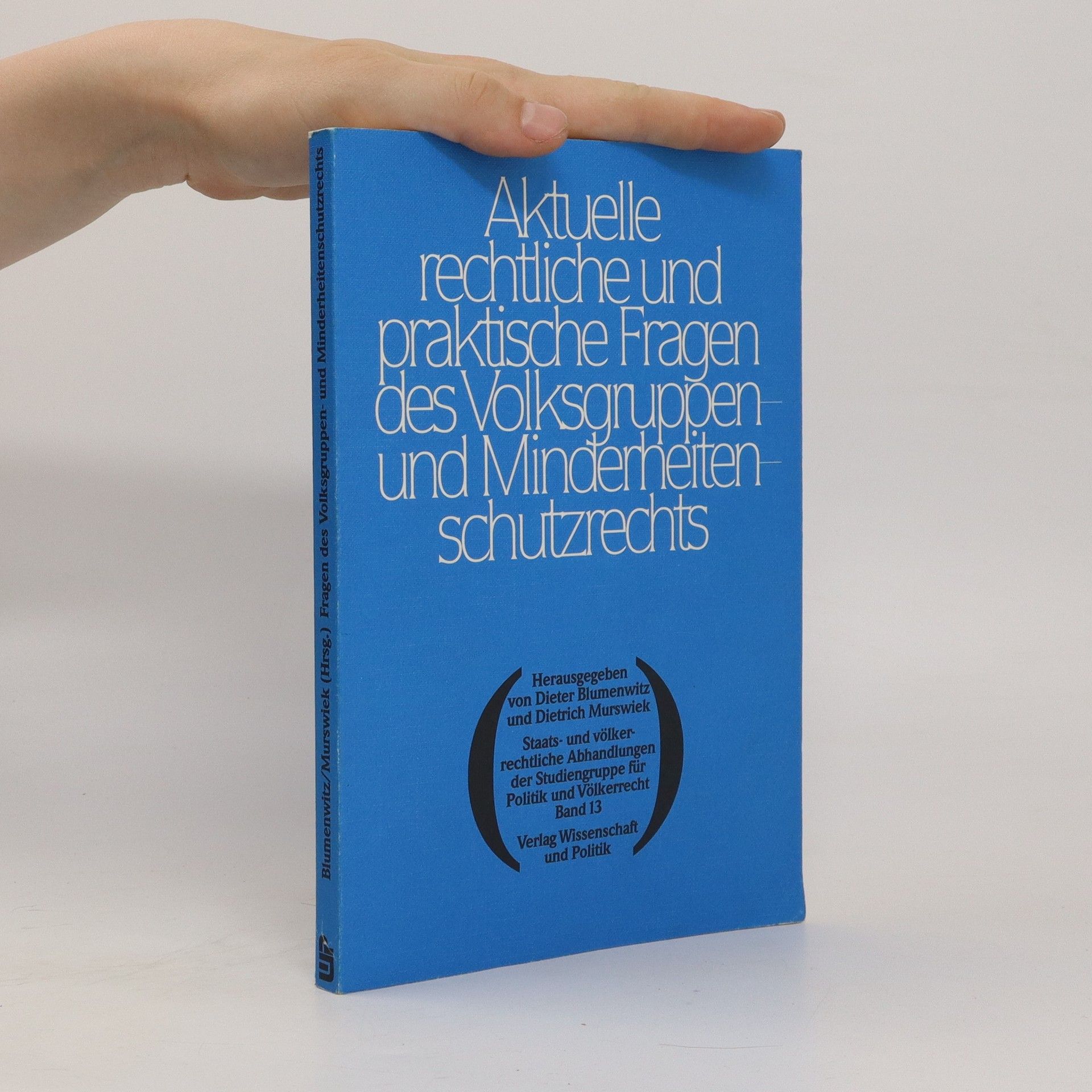Dieter Blumenwitz Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
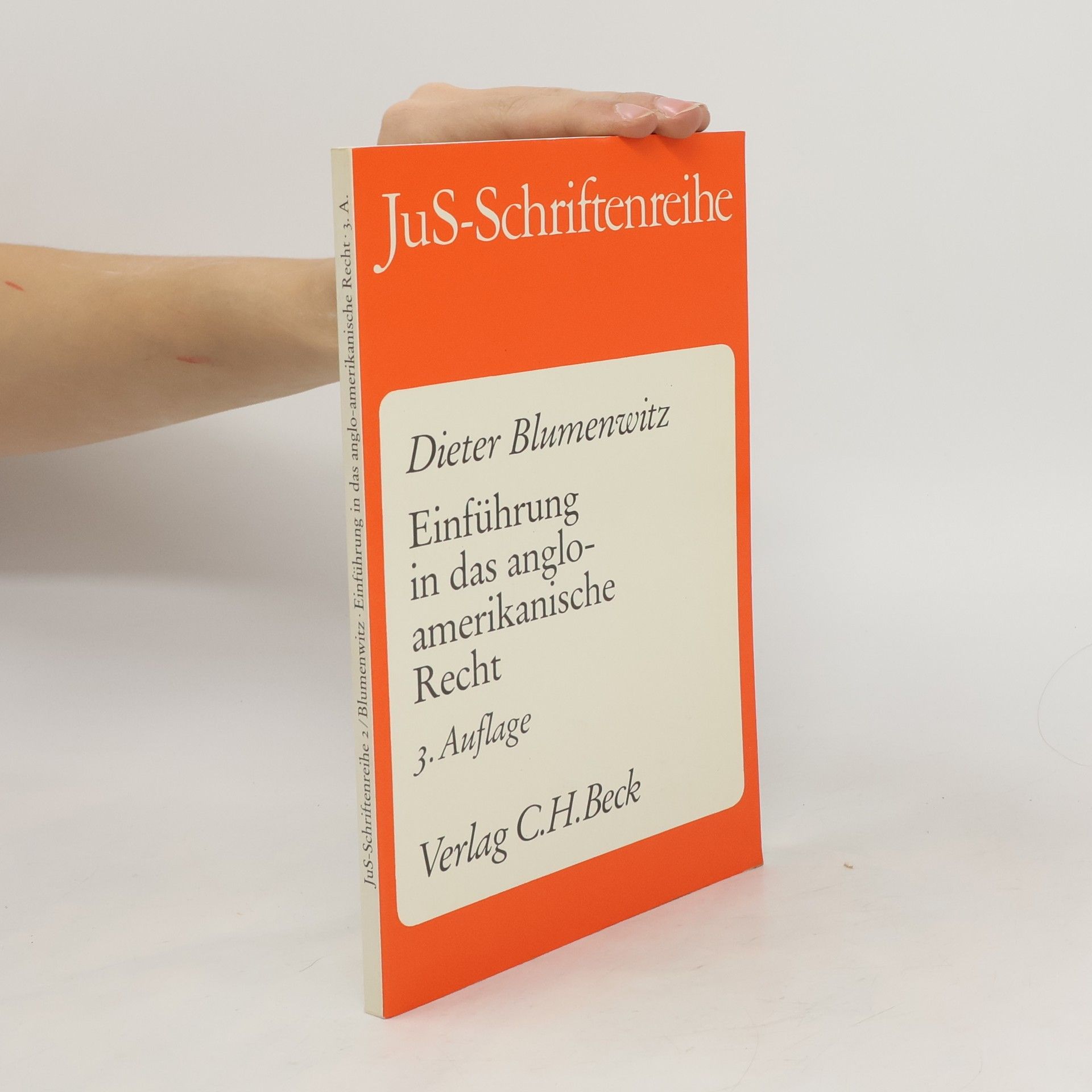
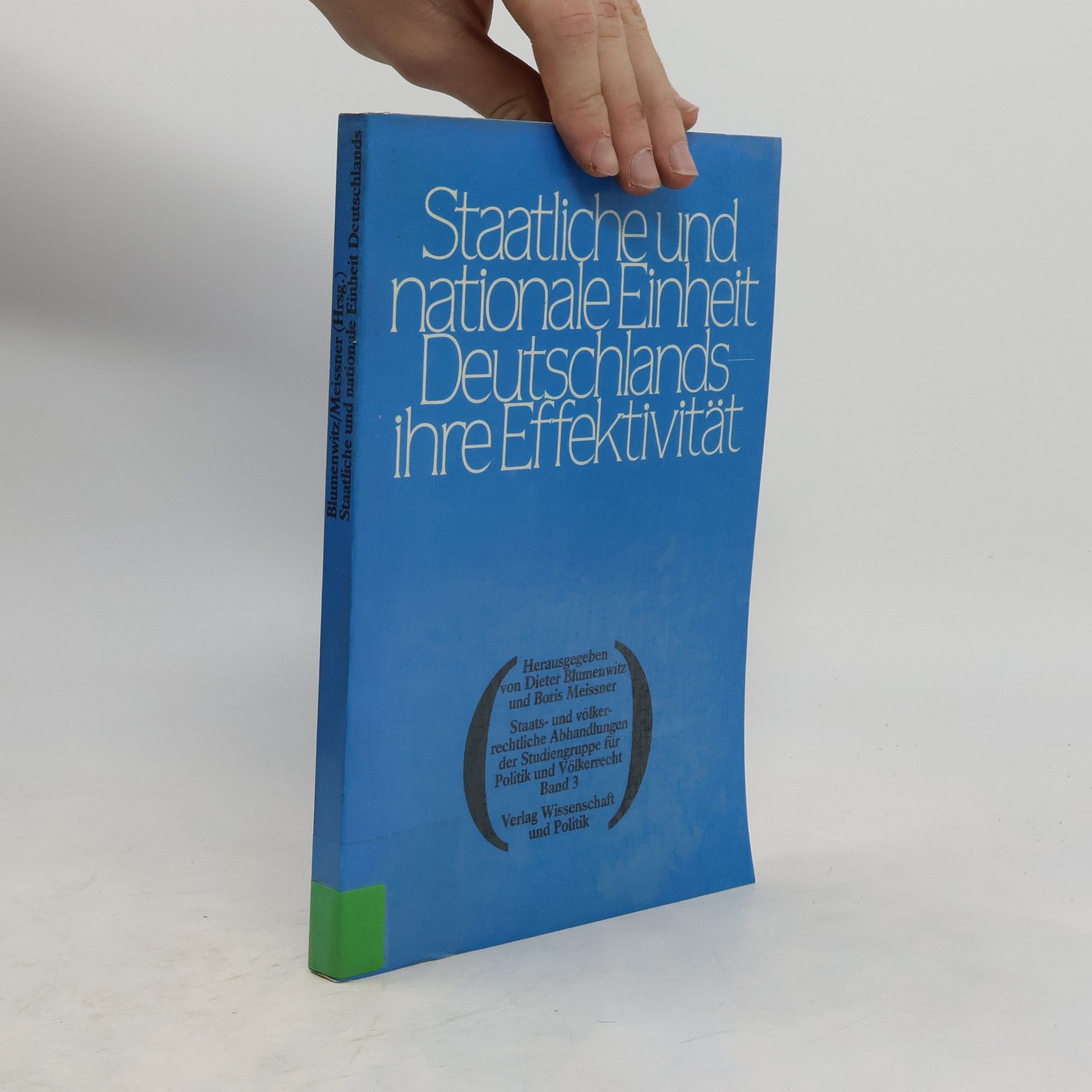
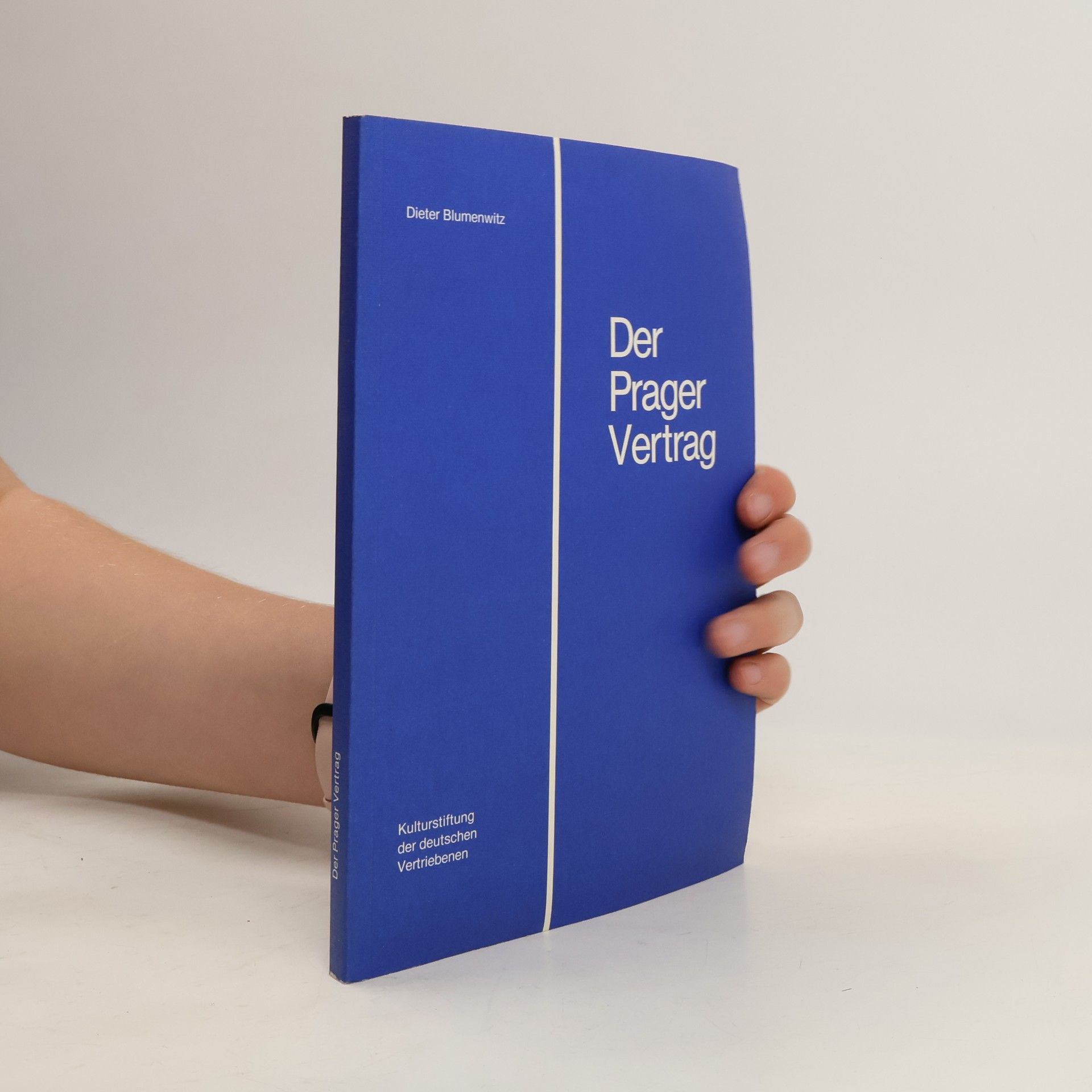
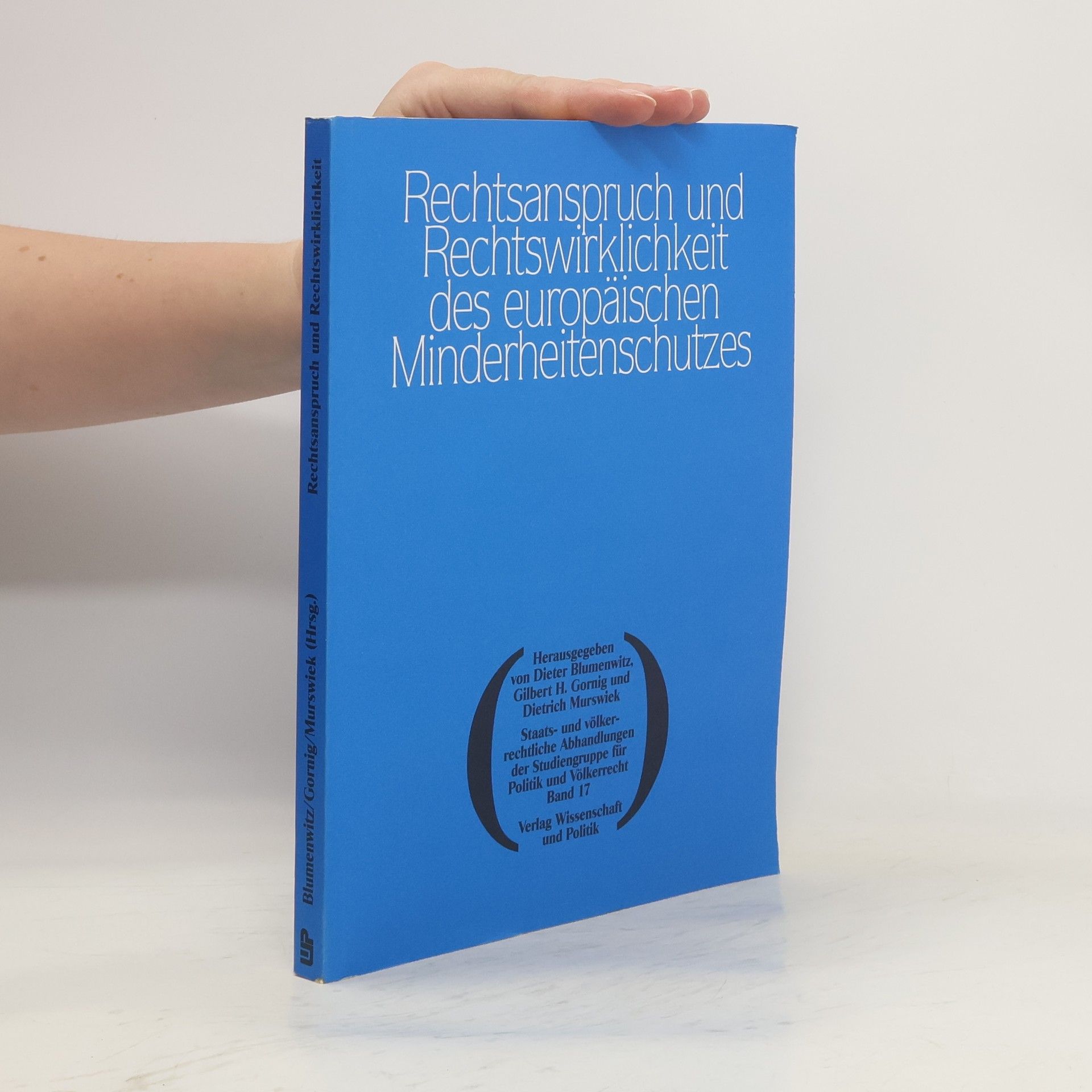


J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche/IPR Einleitung zum IPR, Art 3-6 EGBGB; Anhang zu Art 4 EGBGB: Länderberichte zum Renvoi und zur Unteranknüpfung bei Mehrrechtsstaaten; Anhang zu Art 5 EGBFB: Das internationale Flüchtlingsrecht; Anhang zu Art 6 EGBGB: Vergeltungsrecht
- 911 Seiten
- 32 Lesestunden
JuS Schriftenreihe: Ausländisches Recht: Einführung in das anglo-amerikanische Recht
5. Auflage
- 144 Seiten
- 6 Lesestunden
Papers Presented At The Fachtagung Of The Studiengruppe Für Politik Und Völkerrecht, Held In Bonn-bad Godesberg, February 23-25, 1994. Includes Bibliographical References And Index.
JuS-Schriftenreihe - 2: Einführung in das anglo-amerikanische Recht
Rechtsquellenlehre, Methode der Rechtsfindung, Arbeiten mit praktischen Rechtsfällen - 4. Auflage
- 133 Seiten
- 5 Lesestunden
Das Buch behandelt die Grundlagen des Common Law und die Arbeitsweise anglo-amerikanischer Juristen, die für deutsche Rechtsanwender aufgrund der Internationalisierung zunehmend relevant werden. Zu Beginn wird die Entwicklung und Methode des case law skizziert, gefolgt von einer kurzen Erörterung weiterer relevanter Rechtsquellen. Es bietet wichtige Hinweise zur Arbeit mit anglo-amerikanischer Rechtsliteratur und juristischen Datenbanken. Praktische Ratschläge zur Lösung anglo-amerikanischer Rechtsfragen werden gegeben, wobei die computergestützte Rechtssuche besonders betont wird. Der Anhang enthält grafische Darstellungen und ein wertvolles Entscheidungsregister. Dieses Werk ist ein hervorragendes Einstiegsbuch für alle, die sich mit anglo-amerikanischem Recht befassen. Die Neuauflage wurde grundlegend überarbeitet und berücksichtigt aktuelle Entwicklungen im Common Law sowie die zunehmende Bedeutung des Internets für die Arbeitsweise englischsprachiger Juristen. Die Zielgruppe umfasst Studierende, Referendare und Rechtsanwälte. Vorteile sind die prägnante Darstellung der Grundlagen des Common Law, die Expertise eines amerikanischen Hochschullehrers und die hilfreichen Tafelübersichten im Anhang.