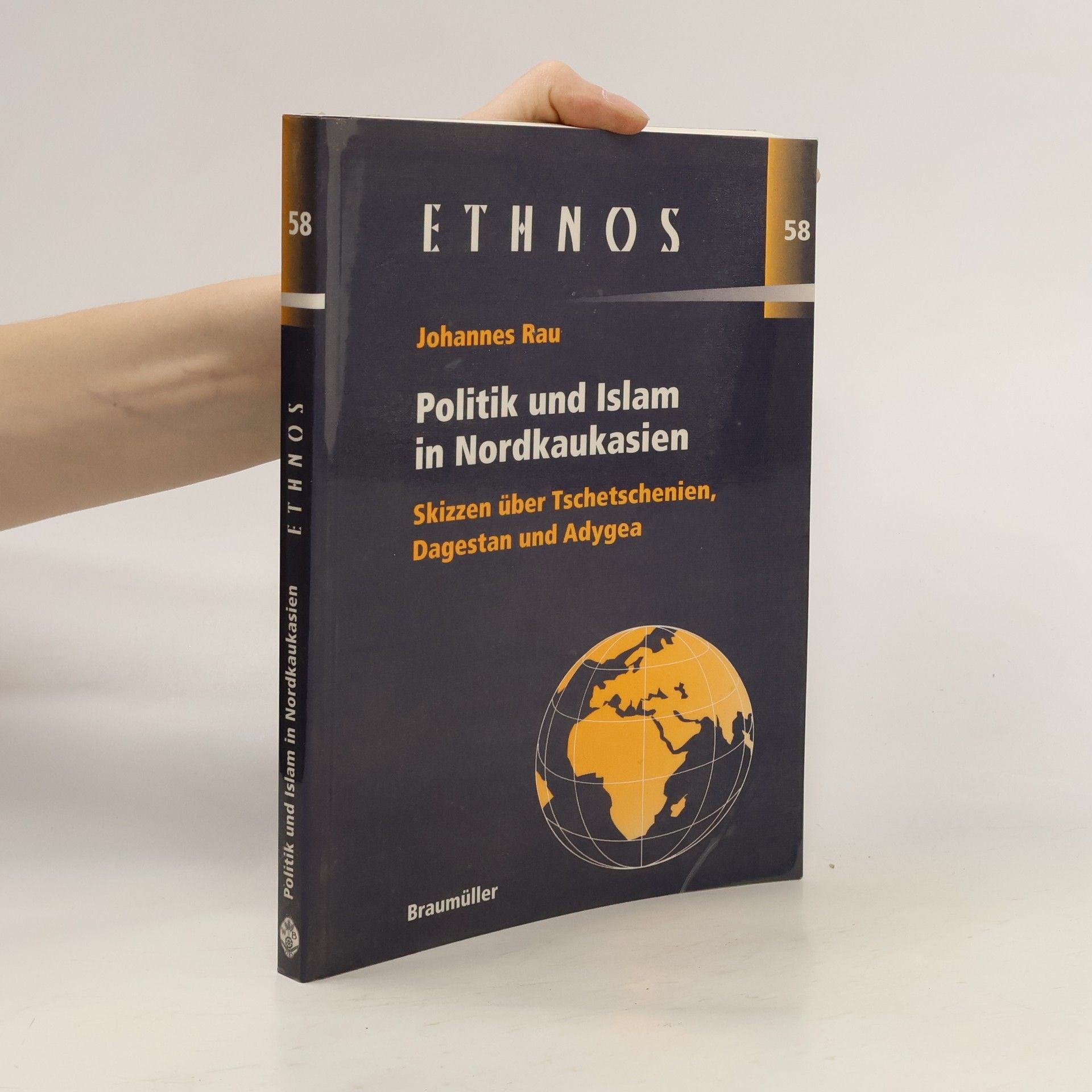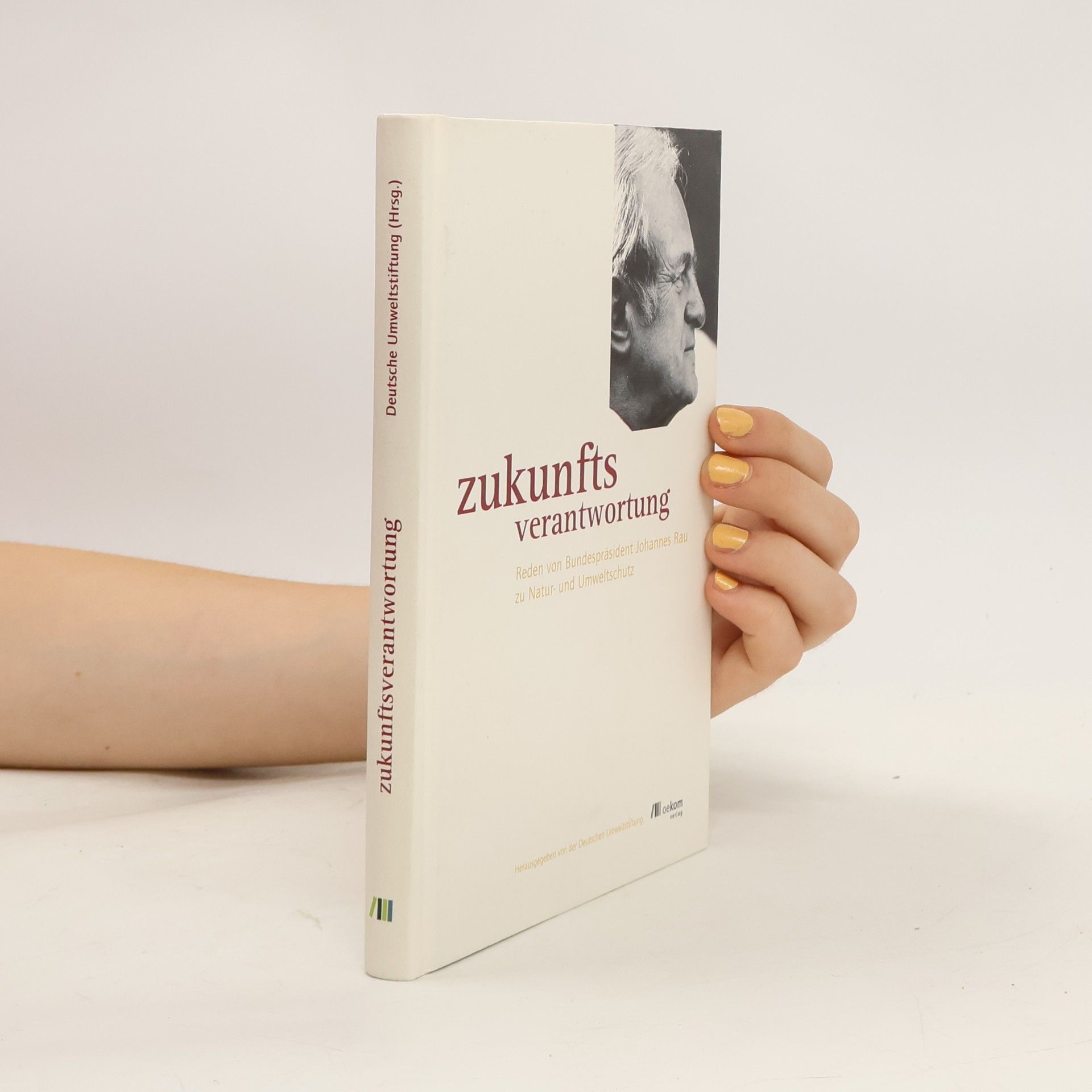Johannes Rau Bücher
Dieser Autor konzentriert sich auf politische und gesellschaftliche Themen und untersucht die Dynamik der Macht und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft. Sein Stil zeichnet sich durch analytische Tiefe und überzeugende Argumentation aus. Der Autor reflektiert häufig historische Ereignisse und deren langfristige Folgen. Die Werke richten sich an Leser, die eine aufschlussreiche Perspektive auf das politische Geschehen suchen.
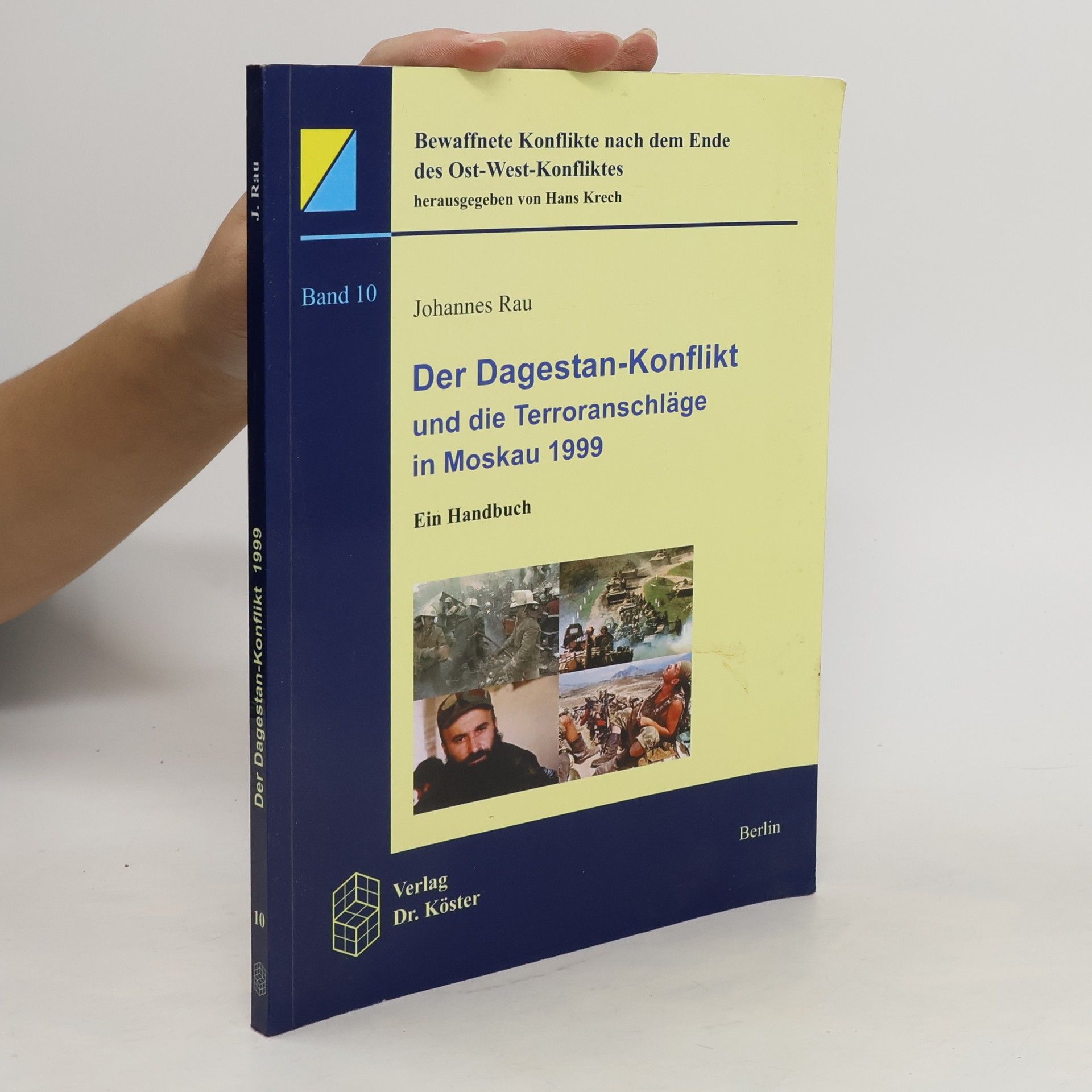


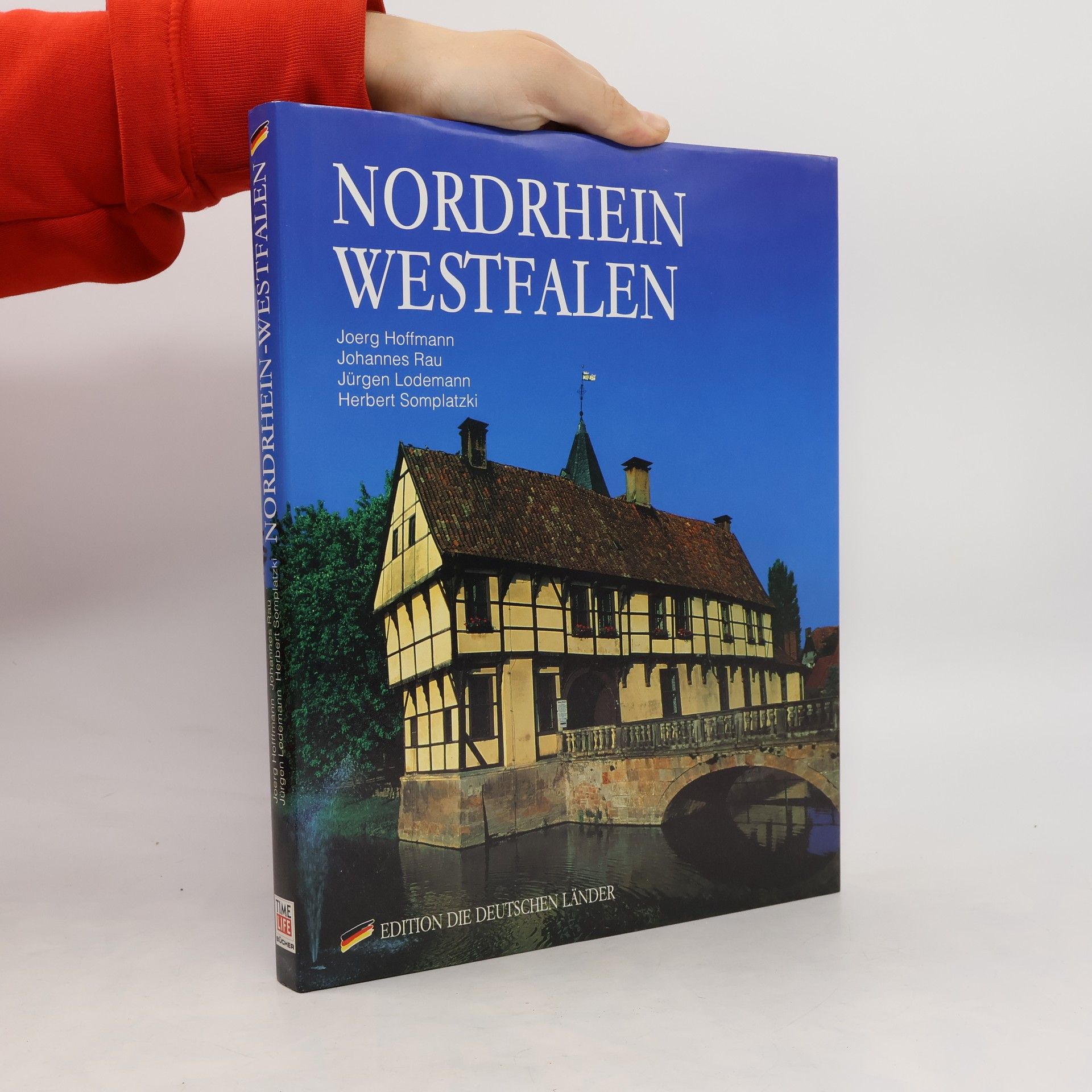
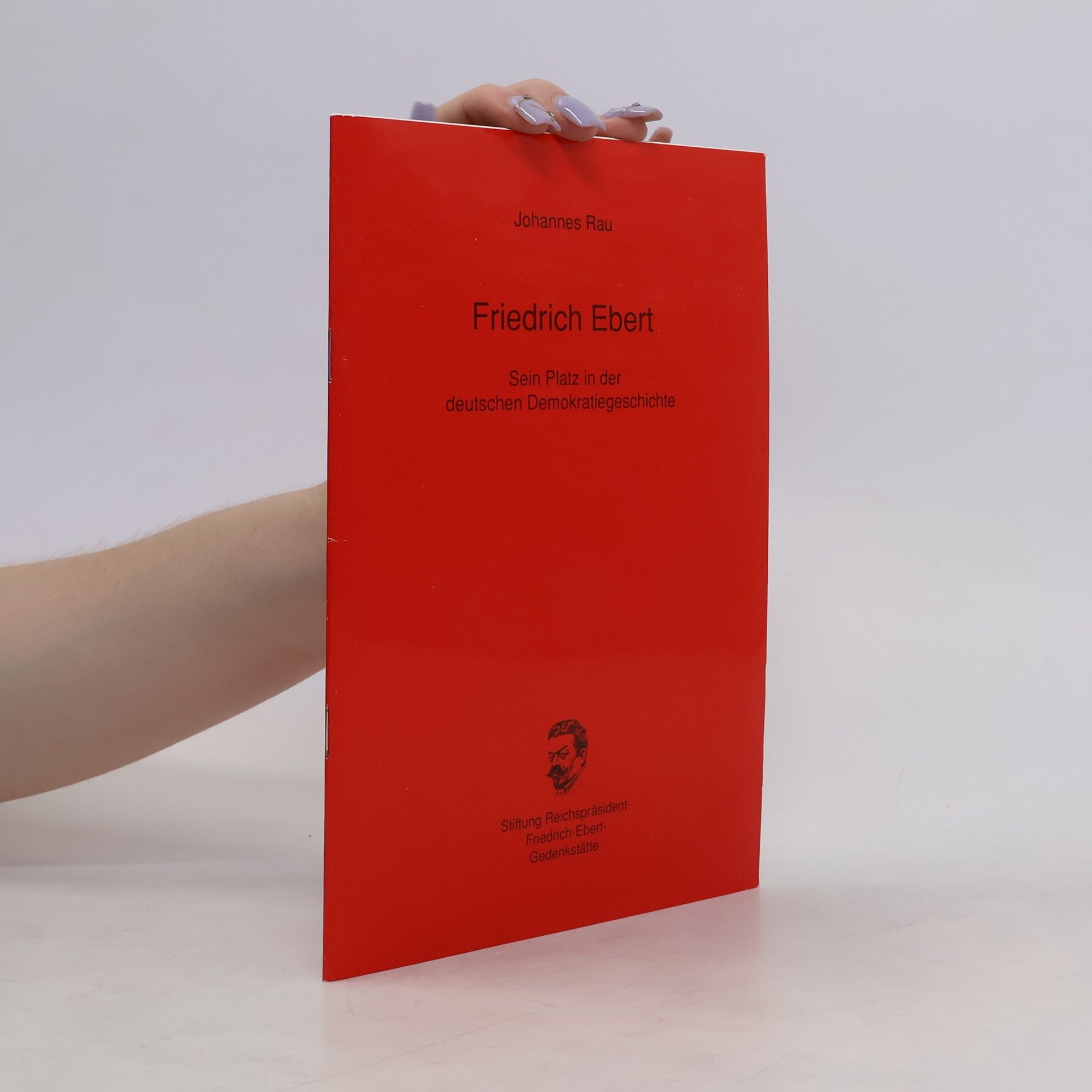

Friedrich Ebert
sein Platz in der deutschen Demokratiegeschichte ; [Festansprache ... am 11. Februar 1989 ... anläßlich der Eröffnung der Gedenkstätte]
- 19 Seiten
- 1 Lesestunde
Johannes Rau(1931-2006) zeichnet eindrückliche Bilder verschiedener Persönlichkeiten, die ihr Leben in Verantwortung vor Gott und vor ihren Mitmenschen geführt haben. Die einzelnen Porträts zeigen, wie der Glaube ins politische Handeln, in die politische Mitarbeit und Beteiligung führt.
Anfang August 1999 marschierte eine tschetschenisch-dagestanische Miliz unter Schamil Bassajew in Dagestan ein und rief zur Rebellion gegen Russland auf. Hauptziel war die Unterbrechung der Erdölpipeline von Baku nach Noworossisk, was Moskau in der geopolitischen Auseinandersetzung mit den USA um die Kontrolle der Erdölfelder in Mittelasien eine strategische Niederlage drohte. Bassajew wurde zurückgeschlagen, doch im September 1999 erschütterten Sprengstoffanschläge in Moskau und anderen Städten die Föderation, bei denen 300 Menschen starben. Die russische Regierung machte die tschetschenischen Mudjahedin verantwortlich. Der neue Ministerpräsident Putin, ein ehemaliger KGB-Offizier, nutzte die Terrorwelle für seine Wahlkampagne. Russische Truppen marschierten in Tschetschenien ein, was den Zweiten Tschetschenien-Krieg einleitete, der bis heute andauert. Prof. Dr. Johannes Rau, ein Kaukasusexperte, untersucht die Hintergründe des Machtkampfes um Dagestan. Wusste die russische Regierung von Bassajews Überfall? War der Inlandsgeheimdienst FSB in die Terroranschläge verwickelt? Wer provozierte Bassajew kurz vor den Wahlen? Warum kämpfte die Mehrheit der Bevölkerung Dagestans nicht auf Seiten der Mudjahedin, sondern unterstützte die russischen Truppen?
Einander ins Gespräch bringen, Vertrauen stärken, zum Engagement füreinander motivieren, das waren Herzensanliegen von Johannes Rau (1931–2006). Der langjährige Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen gewann insbesondere als Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland große Sympathie und Achtung über alle Parteigrenzen hinweg. Die vorliegende Auswahl von Einsichten und Überzeugungen gibt Einblick in das Denken eines Mannes, der im Wissen um seine eigenen Grenzen immer neu an der Botschaft Jesu Maß genommen hat. Ein Vermächtnis, das Mut macht.