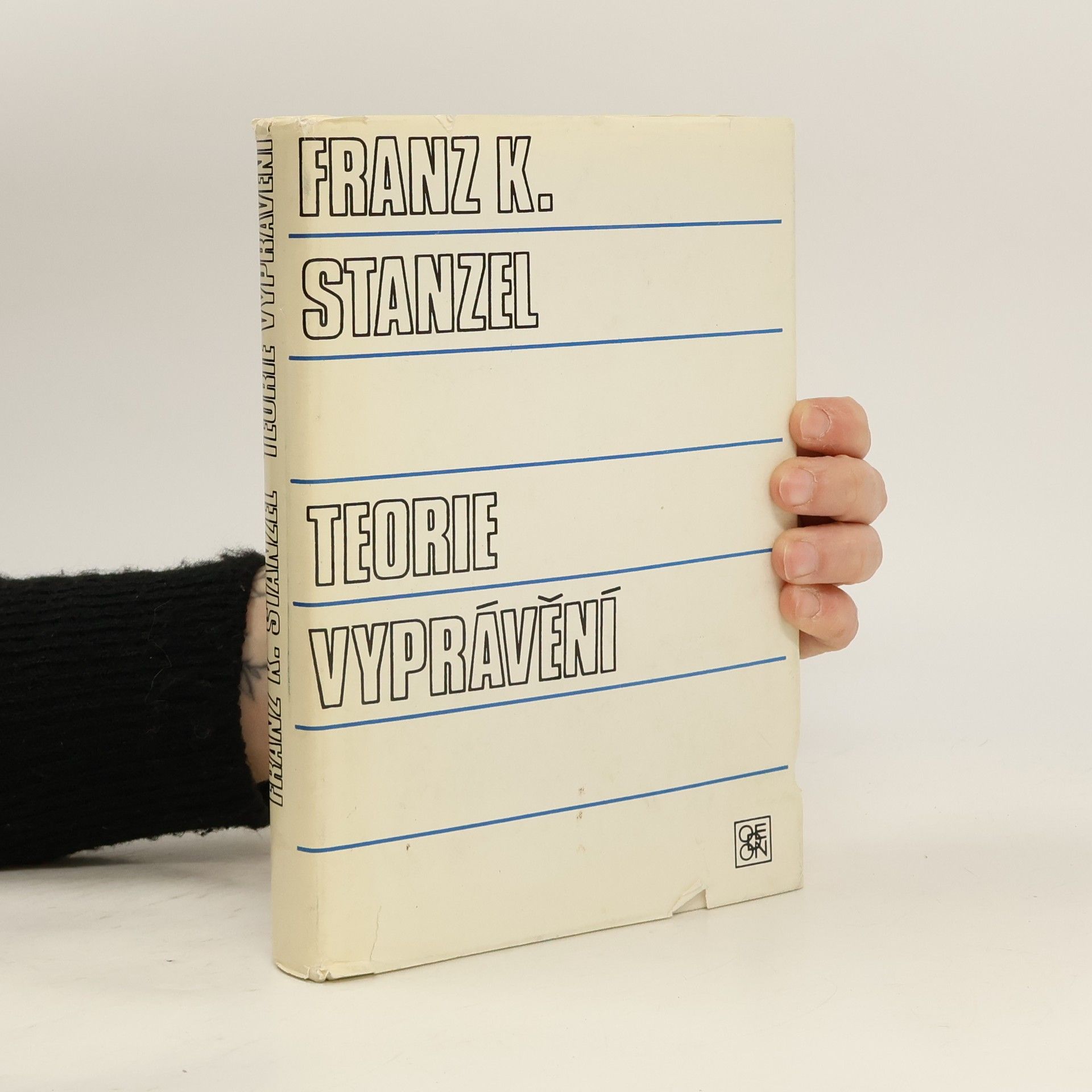,Literatur 99' blickt zurück auf die achtzigjährige Karriere des Verfassers als Anglist und Literaturwissenschafter. Der vorliegende Band soll die Reihe der literaturwissenschaftlichen Publikationen komplettieren, die 1955 mit den ,Typischen Erzählsituationen' eröffnet wurde. In den Fokus rücken Themen seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit, wie Gedanken zum Stilwandel vom Klassizismus zur Romantik, zum Imagologischen, das vor allem in der literarischen Beschreibung des Nationalcharakters von fiktionalen Personen sichtbar wird, sowie zur Kriegsliteratur und ihrer Literarizität. Was 1942 mit der Organisation eines Gastvortrags über den Dichter William Wordsworth in einem englischen Kriegsgefangenenlager begann und über entscheidende Impulse zum New Criticism und dem Strukturalismus, empfangen 1950/51 als Special Auditor an der Harvard Universität, 1955 zur Habilitation über Narratologie an der Universität Graz und anschließend zu Professuren in Göttingen und Erlangen sowie Gastprofessuren im anglophonen Ausland führte, findet mit diesem Buch seine Abrundung.
Franz Karl Stanzel Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
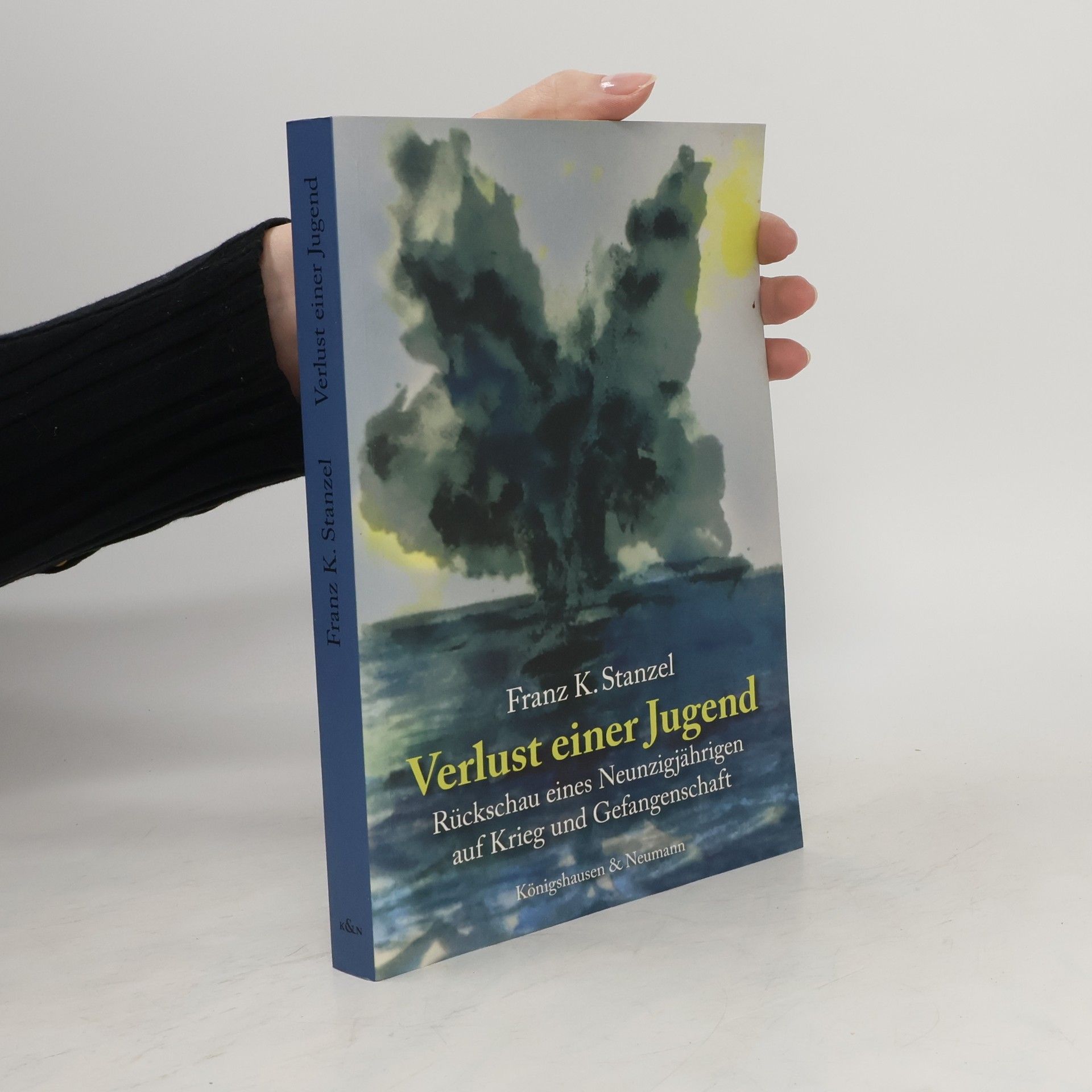



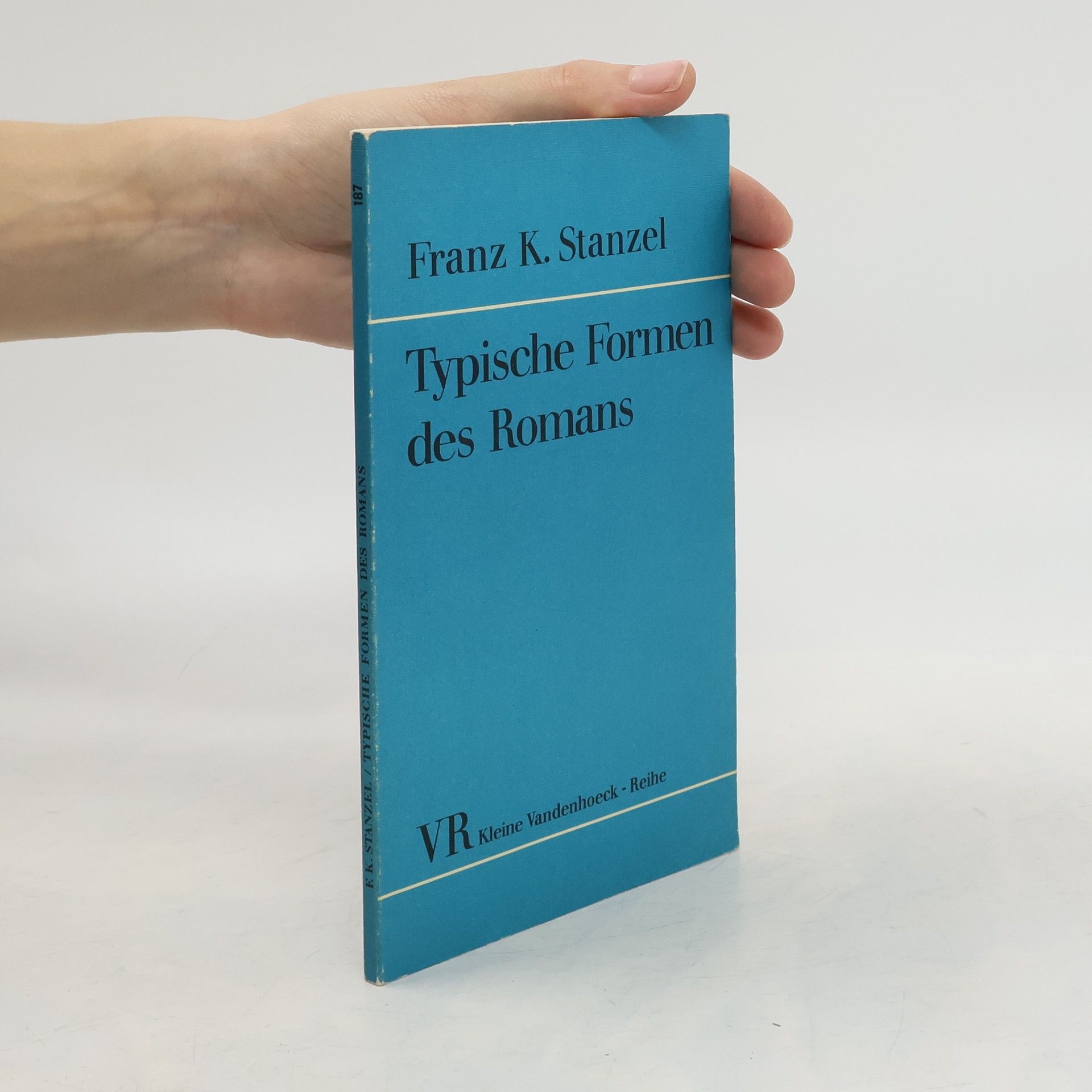

Die frühen Jahre des Verfassers wurden durch Kriegsdienst und Kriegsgefangenschaft geprägt, die entscheidend für seine Studienwahl nach dem Krieg waren. Zwischen 1947 und 1950 studierte er an der Universität Graz und 1950/51 als Fulbright-Stipendiat an der Harvard University Anglistik und Allgemeine Literaturwissenschaft. Sein Jahr in Harvard erlebte er als "intellektuelle Wiedergeburt", die seinen Zugang zur Literaturwissenschaft durch Strukturalismus und das textimmanente "New Criticism" prägte. In Übereinstimmung mit dem Nachkriegsinteresse am modernen, insbesondere amerikanischen Roman, widmete sich der Verfasser narratologischen Studien. Zwischen 1955 und 1979 entwickelte er eine Typologie der Erzählsituationen, die zu einem Diagramm eines vielbeachteten Typenkreises führte. Dieser unterscheidet sich von den dual-binären Systemen anderer Narratologen durch eine Triade von Achsen und fand breite Verbreitung sowie Übersetzungen in mehrere Sprachen, einschließlich Japanisch. Sein Vorteil liegt in der Liminalität und den fließenden Übergängen zwischen Erzählformen. Abschließend wird die historische Darstellung der verlustreichen Vernichtung der mächtigsten deutschen und englischen Schlachtschiffe des Zweiten Weltkriegs als umfassendes Narrativ interpretiert, was die Frage aufwirft, ob hier eine Art ausgleichende Nemesis am Werk war.
Verlust einer Jugend
- 262 Seiten
- 10 Lesestunden
U-Booterzählungen gibt es schon viele. Wenn aber ein Überlebender, nachdem er sich ein Leben lang mit Literatur, auch Kriegsliteratur, beschäftigt hat, auf seine eigene Erfahrung in Krieg und Gefangenschaft zurückblickt, dann stellen sich manche Fragen in einem neuen Licht: Was heißt Kapitulation in einer Situation, in der es nur mehr gilt, weitere Verluste an Leben zu vermeiden? Oder, wird einmal jemand glaubhaft zu schildern imstande sein, welchen qualvollen Tod die Männer eines Bootes erlitten, das spurlos in der Tiefe verschwand, ein Totalverlust wurde, wie es nüchtern hieß. Wer überlebte, geriet in Gefangenschaft, wurde hinter Stacheldraht seiner Jugend beraubt und alterte vorzeitig. Wie bewältigte man die langen Jahre ohne persönliche Freiheit und ohne die Liebe der Frauen, wesentliche Bildungserlebnisse junger Männer? Antworten darauf versucht diese Lebensabschnittgeschichte zu geben. Darin werden auch U-Bootschicksale, gestaltet in Roman, Film und TV, vom Verfasser unter die Lupe genommen. L.-G. Buchheims U-Boot Roman Das Boot und der BBC/ARD TV Zweiteiler „Laconia“ werden einer eingehenden kritischen Interpretation unterzogen. Nebenbei ergeben sich Beobachtungen des Philologen über Analogien und Unterschiede zwischen deutscher und englischer Marinesprache.
Europäer
- 113 Seiten
- 4 Lesestunden
Das Buch bietet eine umfassende Analyse der Formen des Erzählens. Ausgangspunkt sind die typischen Erzählsituationen im Roman; auf dieser Grundlage wird die Typologie der Erzählweisen weiterentwickelt und differenziert. Über die idealtypische Klassifikation hinausgehend werden die vielfältigen Zwischenformen und Kombinationen von Erzählweisen beschrieben und in einem Typenkreis erfasst. Ansatz und Intention sind theoretisch-systematisch, die Befunde werden jedoch fortlaufend auf Textbeispiele bezogen und an ihnen verdeutlicht, wiederholt auch mit der Interpretation einzelner Werke verbunden. Das Ergebnis ist gleichsam eine Grammatik der Erzählkunst, eine Darstellung der wichtigsten Elemente des Erzählens und ihrer strukturellen Zusammenhänge. Sie ist so angelegt, dass das Buch als wissenschaftliches Arbeitsbuch, ebenso jedoch als Nachschlagewerk zu Einzelproblemen der neueren Erzählforschung benutzt werden kann.