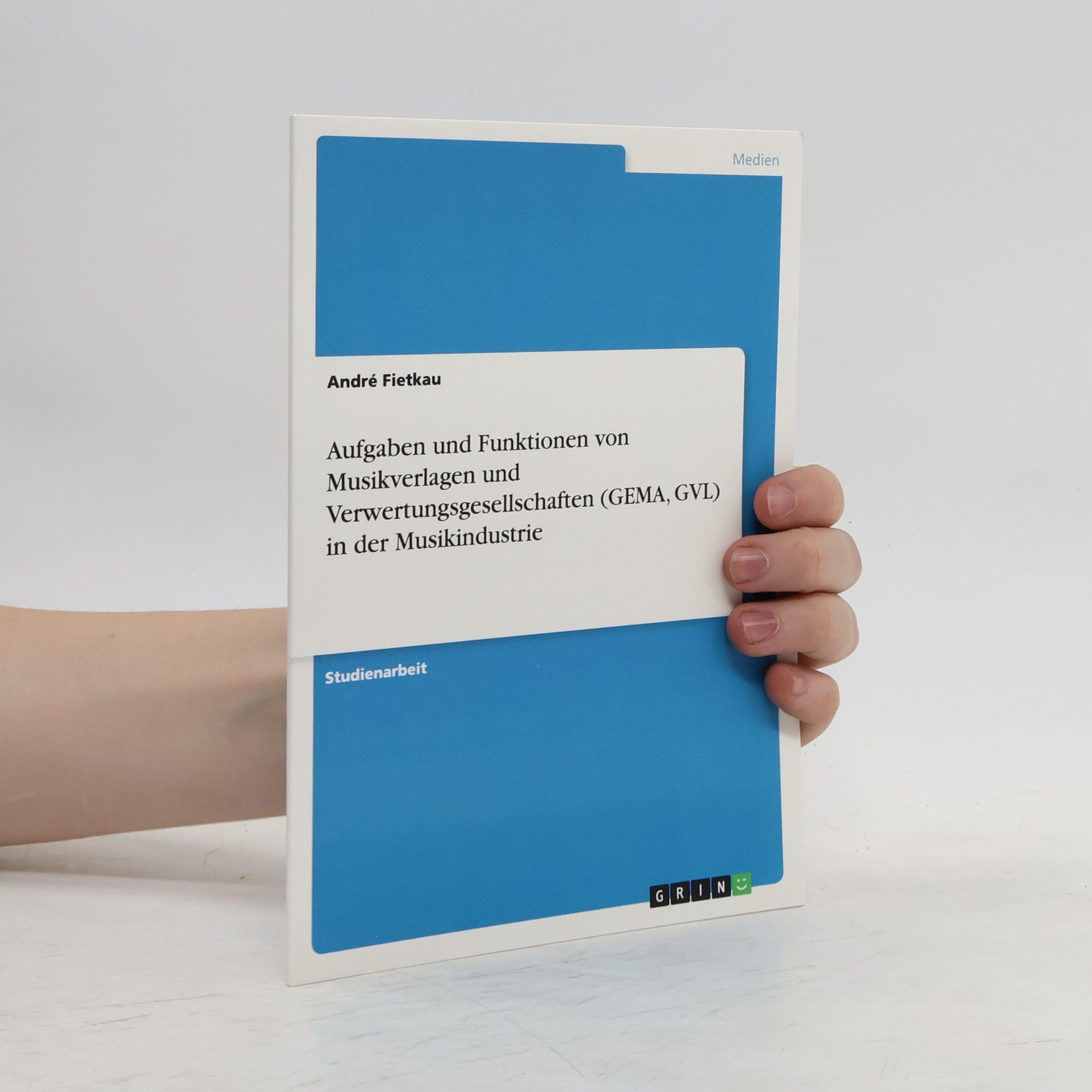Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Medienökonomie, -management, Note: 1,7, Universität Siegen (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Medienmanagement), Veranstaltung: Seminar Aufgaben, Probleme und neuere Entwicklungen des Medienmanagements in der Musikwirtschaft , Sprache: Deutsch, Abstract: Für Komponisten, Textdichter und Interpreten ist die Frage der Wahrung und Wahrnehmung ihrer Urheber- und Leistungsschutzrechte von entscheidender Bedeutung. Ohne effektiven Schutz und verbreitete Nutzung dieser Rechte wäre die professionelle Musikindustrie in ihrer heutigen Form nicht denkbar. Angesichts der nahezu unüberschaubaren Anzahl von potentiellen Nutzer der Rechte an den Werken der Musikschaffenden, von der Erstverwertung über die Zweitverwertung bis hin zur Drittverwertung, stellt sich die Frage, wie die angesprochene Wahrung und Wahrnehmung der Urheber- und Leistungsschutzrechte zu gestalten ist. In dem existierenden System wird diese Aufgabe von den Musikverlagen sowie den Verwertungsgesellschaften wahrgenommen. Mit der vorliegenden Arbeit sollen die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Arbeit der Musikverlage sowie der Verwertungsgesellschaften, ihre innere Organisation, der genaue Inhalt ihrer Aufgaben und Funktionen sowie die Umsetzung dieser Aufgaben und Funktionen in der Praxis dargestellt werden.
André Fietkau Bücher