Kampfkraft
Militärische Organisation und Leistung der deutschen und amerikanischen Armee 1939 – 1945
Martin van Creveld ist ein israelischer Militärhistoriker und Theoretiker, dessen Werk sich mit den Feinheiten von Kriegsführung, Strategie und Logistik befasst. Er untersucht kritisch die Entwicklung von Konflikten und die oft übersehene Bedeutung von Versorgungslinien für militärischen Erfolg. Van Crevelds Analysen bieten tiefgreifende Einblicke in Kommandostrukturen und die Entwicklung von Staaten durch eine historische militärische Brille. Seine umfangreichen Schriften vermitteln ein tiefes Verständnis der grundlegenden Mechanismen des Krieges.

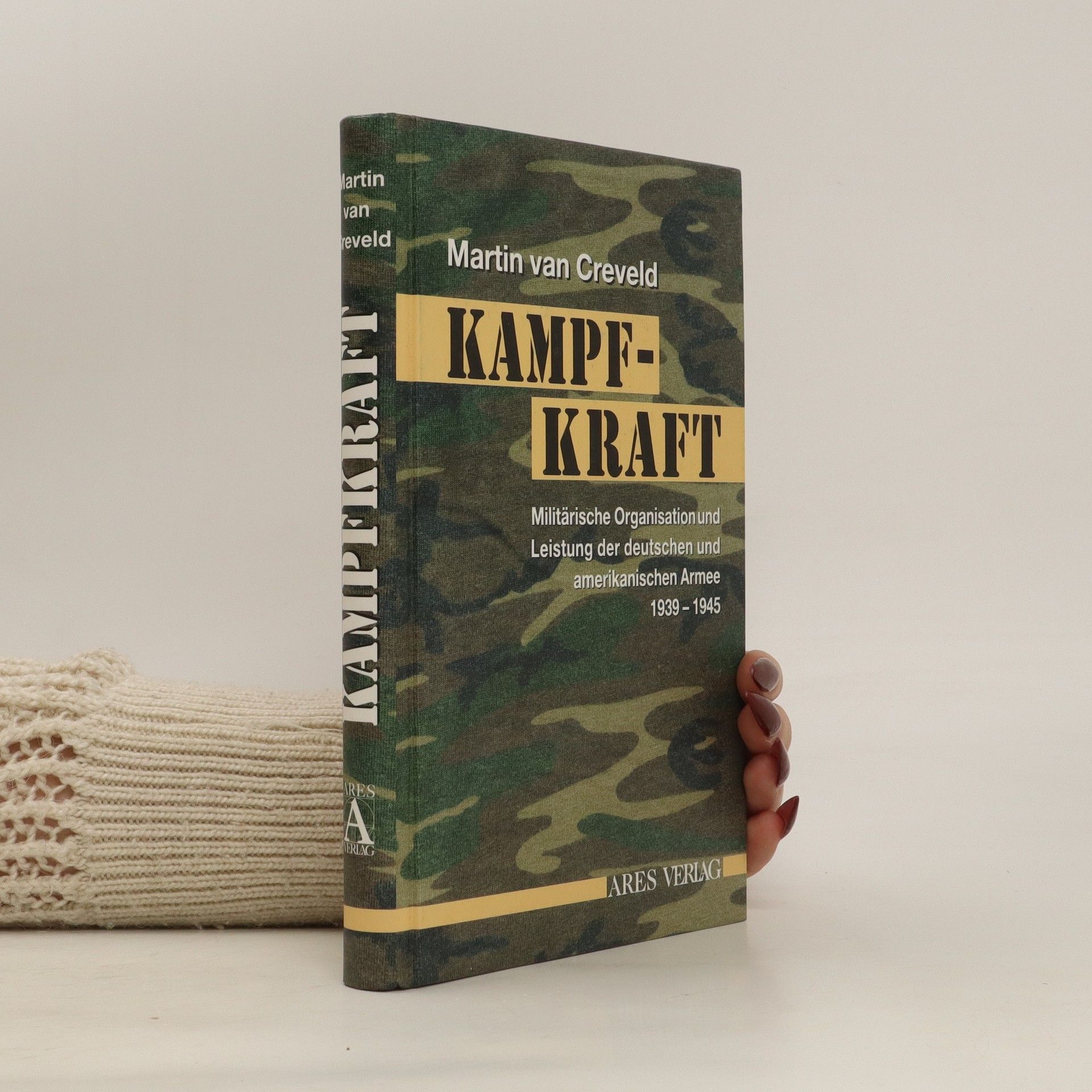
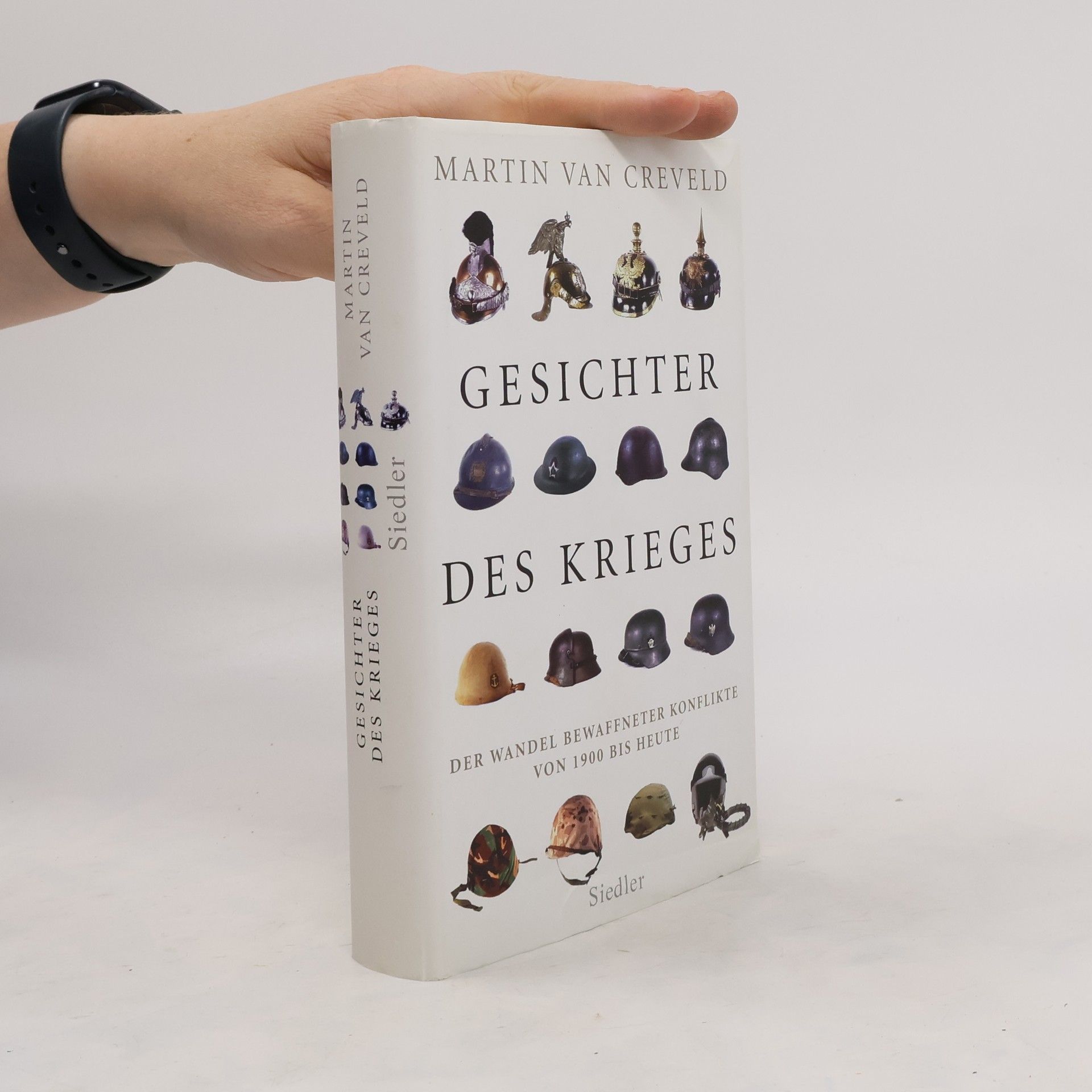
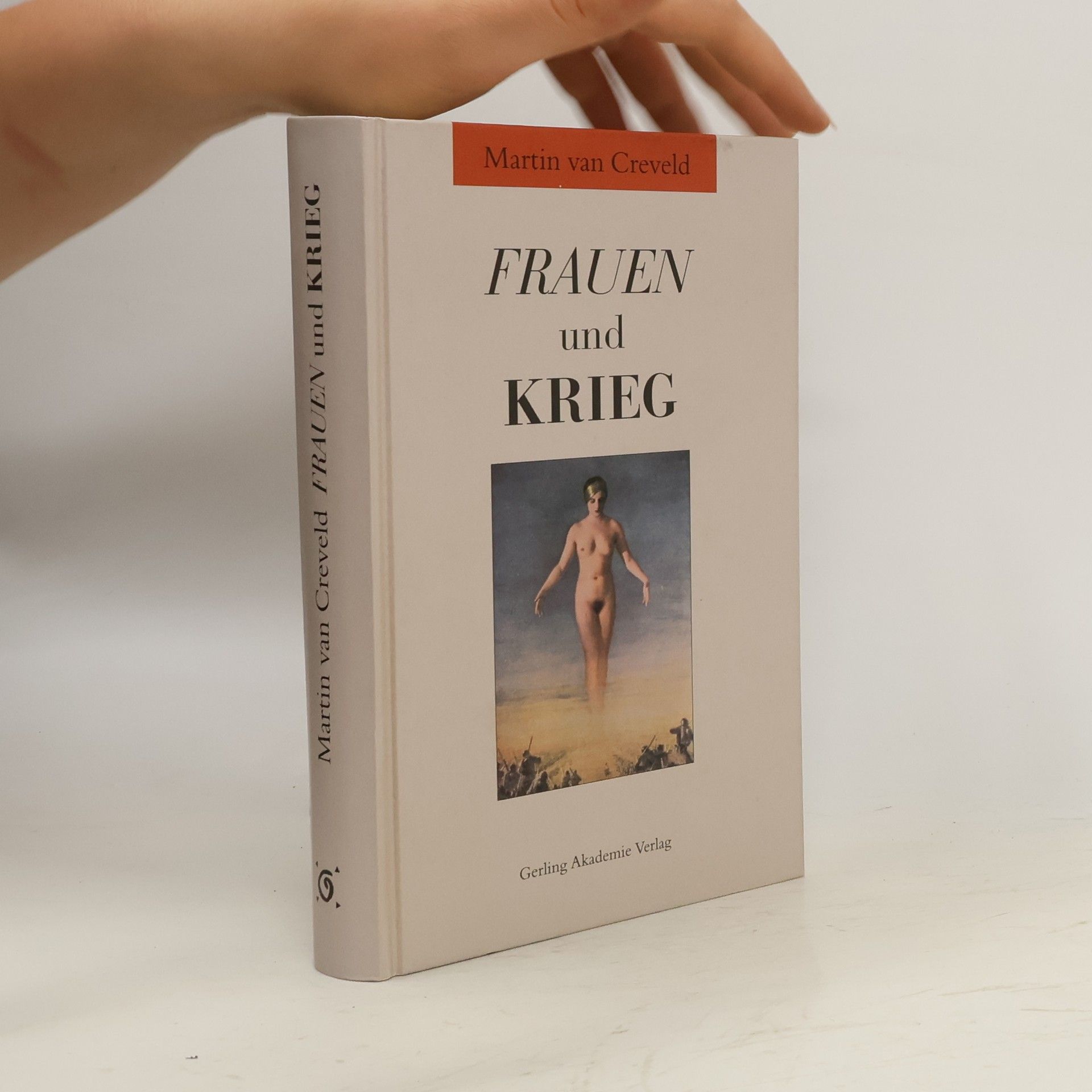

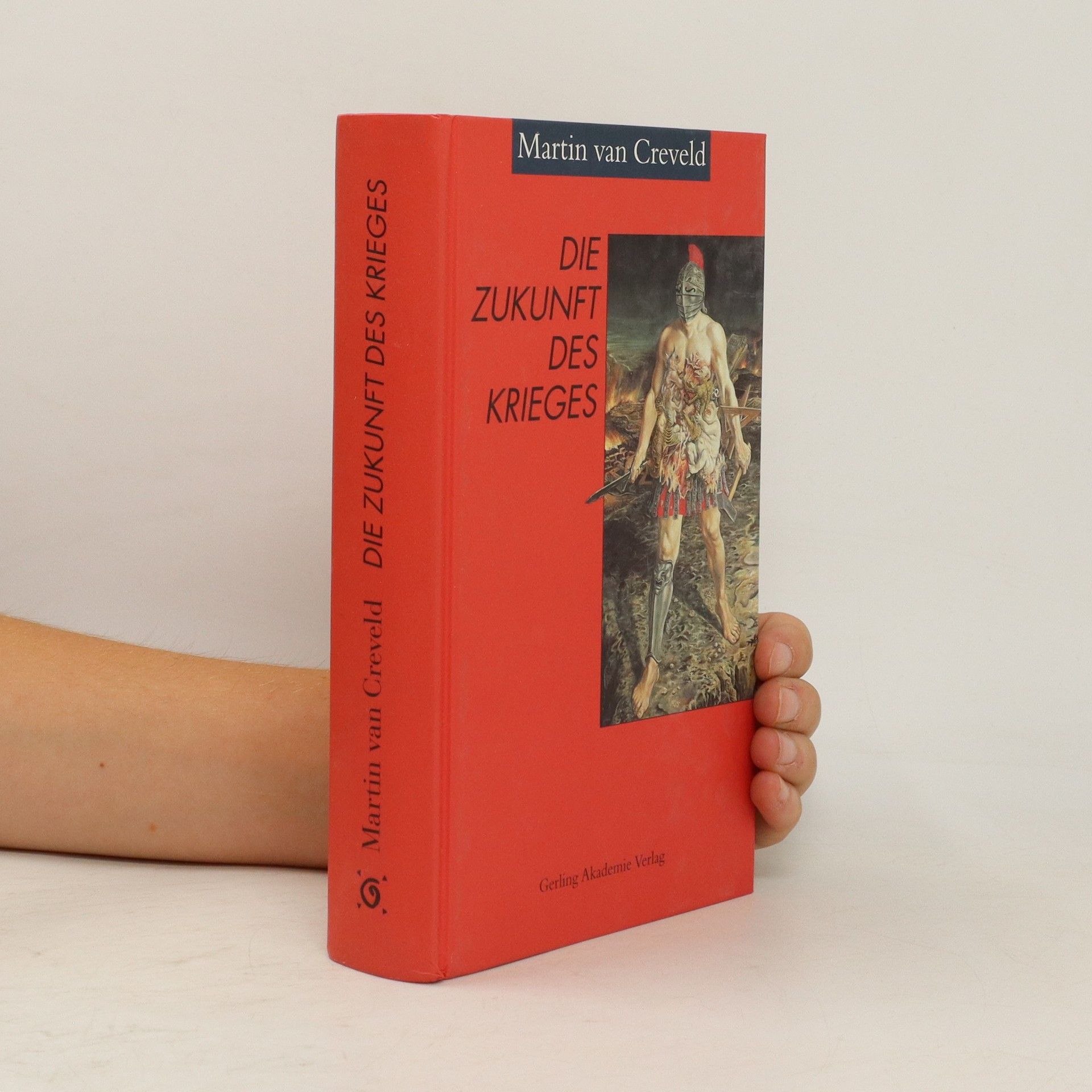
Militärische Organisation und Leistung der deutschen und amerikanischen Armee 1939 – 1945
A compelling guide to prediction, a subject that is vital to modern existence.
Warum wir uns nicht mehr wehren können und was dagegen zu tun ist
Der Terror hat Europa erreicht, und die Regierungen scheinen machtlos. Die grundlegende Aufgabe der Grenzsicherung gelingt der EU nicht, und es stellt sich die Frage, ob Europa sich militärisch verteidigen kann. Der Autor, ein Militärexperte, ist skeptisch und bezieht die gesamte westliche Welt in seine Analyse ein. Er kritisiert die Erziehung von Kindern und Jugendlichen, die stärker überwacht, aber weniger gefordert werden als früher. Auch Politik und Medien tragen zur Schwächung der Verteidigungsbereitschaft bei. Detailliert wird aufgezeigt, wie den Streitkräften schrittweise die Einsatzfähigkeit entzogen wurde. Zudem wird das Thema Frauen in Kampfeinheiten kritisch betrachtet, gestützt auf umfangreiche Dokumentationen. Besorgniserregend ist die Zunahme von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) unter westlichen Soldaten, ein Phänomen, das in den Weltkriegen kaum vorkam, obwohl die psychischen Belastungen damals höher waren. Der Autor zieht das Fazit, dass Europa unfähig zur Selbstverteidigung geworden ist, was negative Auswirkungen auf seine weltpolitische Stellung haben wird. Er warnt, dass die westliche Welt nur gerettet werden kann, wenn dringend notwendige Maßnahmen ergriffen werden. Solange jedoch die Rechte der Staatsbürger über deren Pflichten dominieren, bleiben diese Schritte unmöglich.
Martin van Creveld is a prominent military historian, and his work serves as a vital supplement to Clausewitz, especially in light of technological advancements since the Napoleonic era. While classic texts like The Art of War and On War are widely recognized, numerous lesser-known military writings have emerged over the past 2,327 years. Authors such as Vauban and Douhet focused on specific war aspects, while others like Onasander and Jomini addressed broader strategies, all aimed at enhancing military effectiveness. Dr. van Creveld, a Professor Emeritus at the Hebrew University in Jerusalem, is well-equipped to explore the history of military strategy, having authored over twenty influential works, including Technology and War and The Transformation of War. His concept of “nontrinitarian” warfare and contributions to 4GW literature underscore his expertise. This comprehensive history begins with Chinese military literature and progresses through Greek, Roman, and Byzantine texts, covering the Middle Ages and key figures from Machiavelli to Frederick the Great. The narrative continues with naval warfare literature and early 20th-century strategists like Moltke and Liddell Hart, concluding with modern concepts such as Mutually Assured Destruction and insurgency. This concise yet extensive overview serves as both an introduction for newcomers and a valuable summary for seasoned experts, illustrating the evolution of military th
Explores the history and development of wargames, and how they relate to real war and society in general.
Analiza porównawcza armii niemieckiej i amerykańskiej w latach 1939–1945 to wieloaspektowe badanie, które rzuca światło na różnice w kulturze wojennej obu narodów. Książka bada, która z armii była bardziej wojownicza, jak kształcono i nagradzano oficerów, oraz jak uzupełniano jednostki bojowe. Zawiera również refleksje na temat znaczenia medali dla morale oraz psychicznej odporności żołnierzy. Martin van Creveld, autor książki, kieruje swoje zainteresowanie nie tylko do miłośników historii wojskowości, ale także do osób zafascynowanych psychologią i socjologią, a także zarządzaniem w różnych organizacjach. Jego podejście do historii II wojny światowej koncentruje się na człowieku, analizując zarówno zalety, jak i wady systemów doboru i kształcenia kadr. Ta perspektywa prowokuje do głębszego zrozumienia konfliktu. Van Creveld, urodzony w Holandii i obecnie mieszkający w Izraelu, jest uznawanym naukowcem w dziedzinie strategii i historii wojskowości, autorem dwudziestu jeden książek. Publikacja ta inauguruje serię „Biblioteki Wojskowej”, mającą na celu przybliżenie polskiemu czytelnikowi dzieł wybitnych autorów wojskowych.
The definitive one-volume history of Israel by its most distinguished historian From its Zionist beginnings at the end of the nineteenth century through the past sixty, tumultuous years, the state of Israel has been, as van Creveld argues, "the greatest success story in the entire twentieth century." In this crisp volume, he skillfully relates the improbable story of a nationless people who, given a hot and arid patch of land and coping with every imaginable obstacle, founded a country that is now the envy of surrounding states. While most studies on Israel focus on the political, this encompassing history weaves together the nation's economic, social, cultural and religious narratives while also offering diplomatic solutions to help Israel achieve peace. Without question, this is the best one-volume history of Israel and its people.
A renowned military historian explores the concept of the culture of war that details the human fascination with the art of war, describing such facets of the phenomenon as war games, literature, ceremonies, customs, art, literature, and other examples. 15,000 first printing.
Martin van Creveld schildert, wie sich Krieg und Gewalt im 19. und 20. Jahrhundert dramatisch veränderten und untersucht, was wir den neuen Formen terroristischer Kriegsführung entgegensetzen können. Er bietet einen faszinierenden Blick in die Vergangenheit, um die kriegerischen Auseinandersetzungen von heute und morgen zu verstehen. Seit der Schlacht an der Marne 1914 hat sich das Gesicht der Kriegsführung grundlegend gewandelt. Van Creveld beschreibt den Übergang von den Massenbewegungen und Stellungsschlachten der Weltkriege über die Konflikte im Schatten des Kalten Kriegs bis zu den ungleichen Auseinandersetzungen zwischen regulären Armeen und irregulären Guerillatruppen in den letzten Jahrzehnten. Er thematisiert die wechselhaften Gesetze des Krieges, alte und neue Theorien der Kriegführung, technische Innovationen, das zunehmende Leiden der Zivilbevölkerung sowie die schwierigen Fragen nach Verantwortung und Kriegsschuld. Historische Betrachtungen verknüpft er mit einer eindringlichen Analyse aktueller Probleme und einem Ausblick auf mögliche Krisen: Was bedeutet es für die Zukunft bewaffneter Konflikte, wenn hochgerüstete Armeen wie die amerikanische im Irak oder die israelische in Gaza scheitern? Welche Art militärischer Auseinandersetzungen sind zu erwarten? Diese umfassende Geschichte der Kriegführung im 20. Jahrhundert hilft, aktuelle Kriege besser zu verstehen und einzuschätzen. Der Autor zählt zu den führenden
A second edition of this classic work, commenting on the role of logistics in warfare.