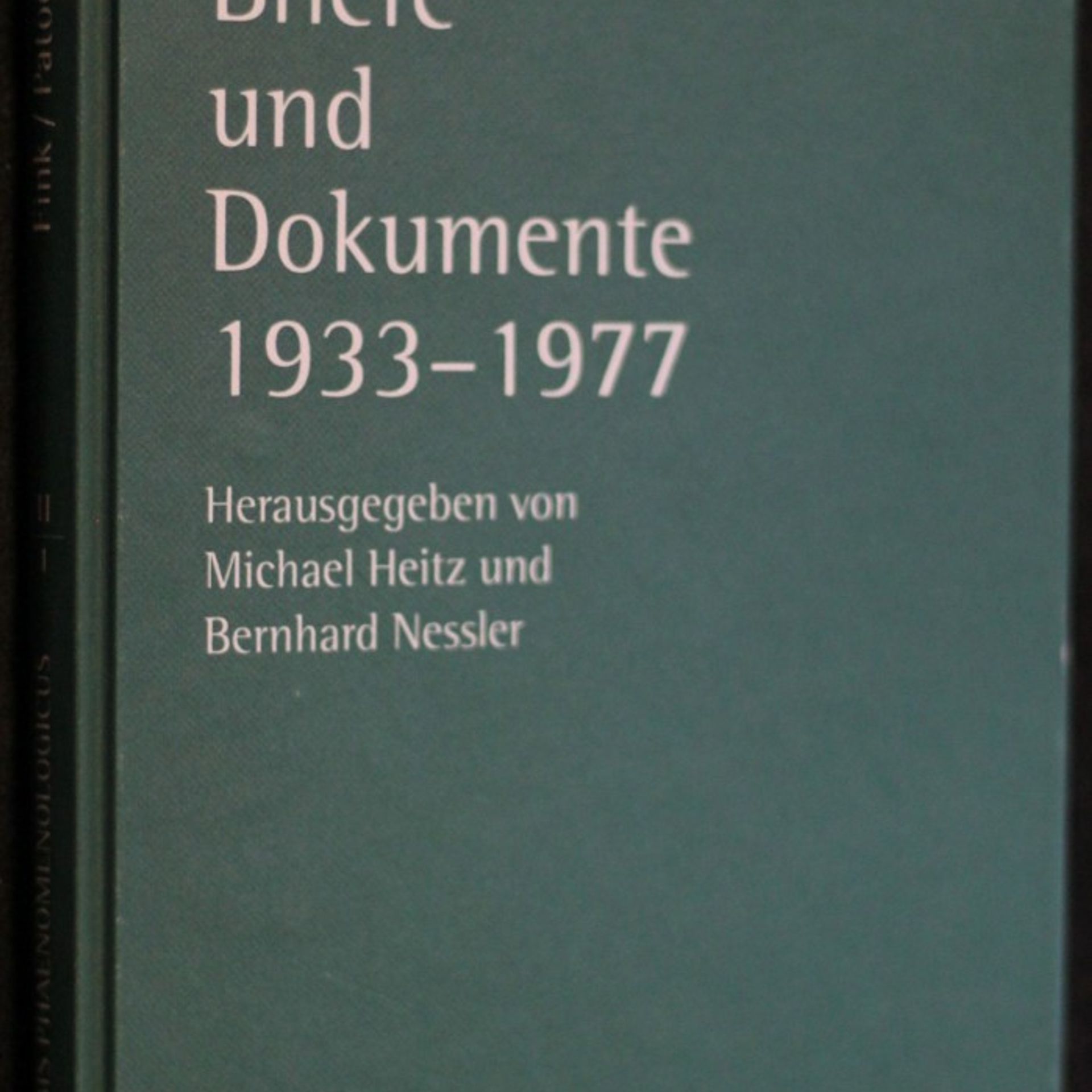Eugen Fink Bücher
Fink näherte sich dem Problem des Seins als einer Manifestation kosmischer Bewegung, an der der Mensch teilhat. Er bezeichnete philosophische Probleme als 'Vorfragen', die durch eine ontologische Praxis zur wahren Philosophie führen. Sein Ansatz betont die Verbundenheit der menschlichen Existenz mit der Dynamik des Kosmos.



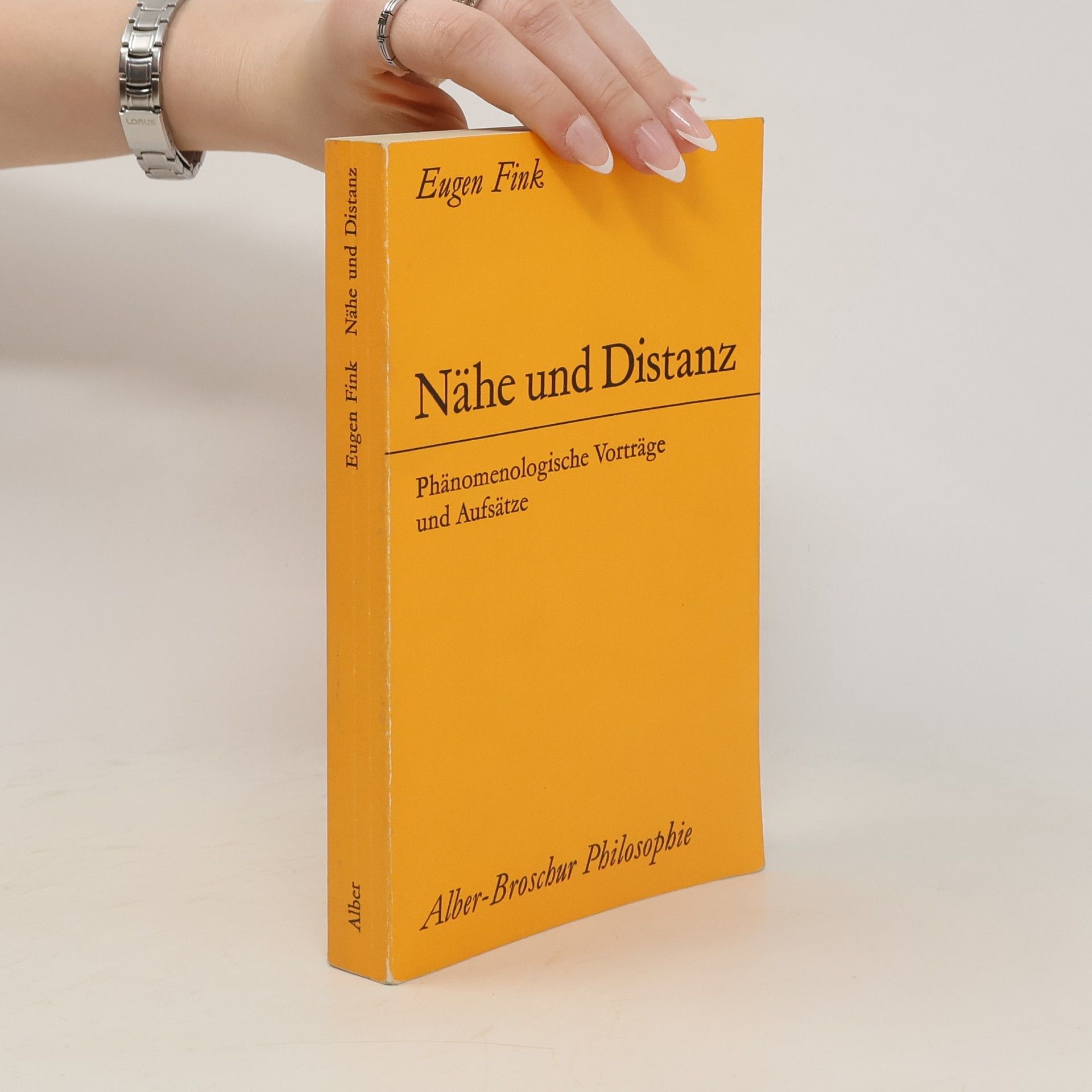


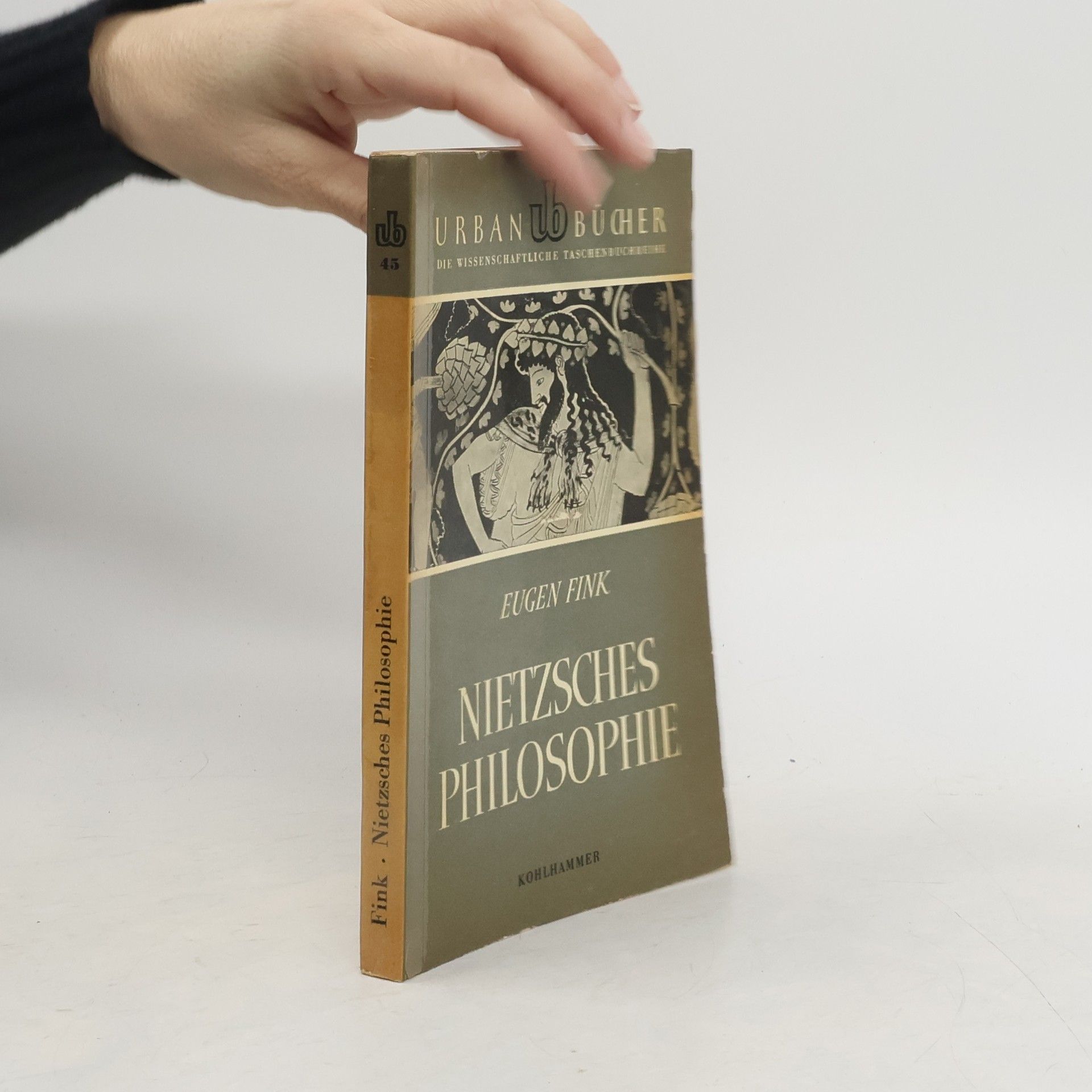
Band 11 der Eugen Fink Gesamtausgabe versammelt Beiträge Eugen Finks seit den 1940er Jahren zur antiken Philosophie: drei Haupttexte – die Vorlesung zu den „Grundfragen der antiken Philosophie“ (WS 1947/48), das Seminar zum „Satz vom Widerspruch“ (WS 1959/60) und das Seminar über Heraklit (WS 1966/67), das er gemeinsam mit Heidegger hielt –, zwei kleinere Arbeiten zu „Zeit und Zeitbegriff bei Aristoteles“ und „Asebeia und Techne im 10. Buch der Nomoi“ (1963 bzw. 1969) und Entwürfe im Umkreis mehrerer Seminarübungen zu Heraklit, Parmenides, Platon und Aristoteles. Der Band zeigt, welche bedeutende Rolle die Auseinandersetzung mit den antiken Philosophen für die Entwicklung der phänomenologischen Kosmologie Finks im Spannungsfeld zwischen Husserl und Heidegger spielt: Bei den frühen Denkern findet Fink die Spuren einer ursprünglichen Philosophie, die das Weltganze zum Zentrum und Leitfaden hat.
Nähe und Distanz
Studien zur Phänomenologie
Das kurz nach Eugen Finks Tod 1976 erschienene Buch Nähe und Distanz gilt als das phänomenologische Grundwerk seines Autors. Es versammelt phänomenologische Vorträge und Aufsätze, darunter bedeutende Texte wie „Zum Problem der ontologischen Erfahrung“ und „Operative Begriffe in Husserls Phänomenologie“. Diese Arbeiten erstrecken sich über mehr als 35 Jahre und stehen in Verbindung mit dem 1966 veröffentlichten, mittlerweile vergriffenen Band Studien zur Phänomenologie 1930-1939. Die Texte zeigen Finks Bemühungen, sich in zentralen Fragen des phänomenologischen Denkens von Edmund Husserl und Martin Heidegger abzugrenzen. Besonders die kritischen Fragen, die Fink an Husserls Transzendentalphänomenologie richtet – etwa zur operativen Verwendung des Seinsbegriffs, zur Konzeption von Welt und zur Rolle des Ich in der phänomenologischen Reduktion – sind weiterhin von großem Interesse. Der vorliegende Band enthält alle Beiträge der beiden früheren Publikationen in chronologischer Reihenfolge. Die Texte wurden an den Erstdrucken und erhaltenen Manuskriptfassungen überprüft und um weitere kleinere Schriften sowie Notizen aus dem Nachlass ergänzt. Ein Nachwort und ein editorischer Bericht runden die Edition ab.
German
Phänomenologische Werkstatt
Teilband 4: Finks phänomenologisches Philosophieren nach dem Tod Husserls
- 461 Seiten
- 17 Lesestunden
Die Entwürfe zu einer Schrift über "ontologische Erfahrung" aus dem Jahr 1939 markieren eine entscheidende Wendung in Finks philosophischem Denken und verbinden seine Vor- und Nachkriegsschriften. In seinen Kriegsschriften zeigt sich eine zunehmende kritische Distanz zur Phänomenologie Husserls und eine Hinwendung zu Heideggers Seinsdenken. Besonders in den "Elementen einer Husserl-Kritik" und den "Aphorismen aus einem Kriegstagebuch" wird Finks eigenständige phänomenologische Perspektive deutlich, die den Grundstein für sein späteres "Weltdenken" legt.
Phänomenologische Werkstatt
Teilband 3: Letzte phänomenologische Darstellung: die „Krisis“-Problematik
Der dritte Band der "Phänomenologischen Werkstatt" von Eugen Fink bietet eine umfassende Sammlung seiner Aufzeichnungen aus den späten dreißiger Jahren, die seine Zusammenarbeit mit Husserl dokumentieren. Er enthält Analysen zur Husserlschen Phänomenologie, Unterrichtsmaterialien sowie Notizen zu Gesprächen mit bedeutenden Philosophen.
Zu Eugen Finks wohl bedeutendsten Texten gehört „Oase des Glücks. Gedanken zu einer Ontologie des Spiels“. Vor dem Hintergrund eines breiten philosophischen sowie sozial- und kulturwissenschaftlichen Interesses am Phänomen des Spiels entwickelt der Freiburger Denker in diesem Buch einen eigenständigen und innovativen Zugang zum Spiel bzw. zum Spielen, der sich als Klassiker der Philosophie des 20. Jahrhunderts erweisen dürfte. Der vorliegende Band zu Finks „Oase des Glücks“ enthält diesen grundlegenden Text sowie zahlreiche Interpretationen aus der Feder führender Fink-Forscherinnen und -Forscher. Er führt nicht nur in Finks Überlegungen zum Spiel, sondern auch methodologisch in seinen genuinen phänomenologischen Ansatz ein und zeigt die breite internationale Rezeption wie auch die gegenwärtige Bedeutung dieses Philosophen, der manchmal zu Unrecht im Schatten seiner beiden Lehrer Husserl und Heidegger steht.
Eugen Fink hielt von 1948 bis zu seiner Emeritierung 1971 an der Universität Freiburg i. Br. Vorlesungen und Seminare zur Philosophie und Erziehungswissenschaft. Beider sachliche Einheit wurde durch das Wort „Erziehung“ (Paideia) angezeigt. Doch war für ihn die herkömmliche Erziehungswissenschaft von Grund auf fraglich, ließ sie doch die Frage nach dem ihr eigenen Wissen offen. Es galt, das Verhältnis beider zu klären, wobei die fundamentale Bedeutung der Philosophie nie außer Frage stand. Fink interpretierte Platons Politeia und die Nomoi, jene im Ausgang vom Höhlengleichnis und mit Blick auf die Techne und die Strukturierung der Paideia (Staatsgründung, Krieger, Archonten), diese namentlich unter dem Gesichtspunkt der Altersstufung als Staatsprinzip. Hauptthemen der Analyse der Nikomachischen Ethik und der Politik des Aristoteles waren die Phronesis und das Erziehungsziel des Eu Zen (des guten Lebens). Doch gerade die fundamentale Bedeutung beider Philosophen für die Metaphysik ließ auch ihre Grenzen erkennen: die Bevorzugung des Lichts und die Vernachlässigung des Unterschieds von Ding- und Weltmodellen.
Urban-Taschenbücher - 45: Nietzsches Philosophie
- 189 Seiten
- 7 Lesestunden