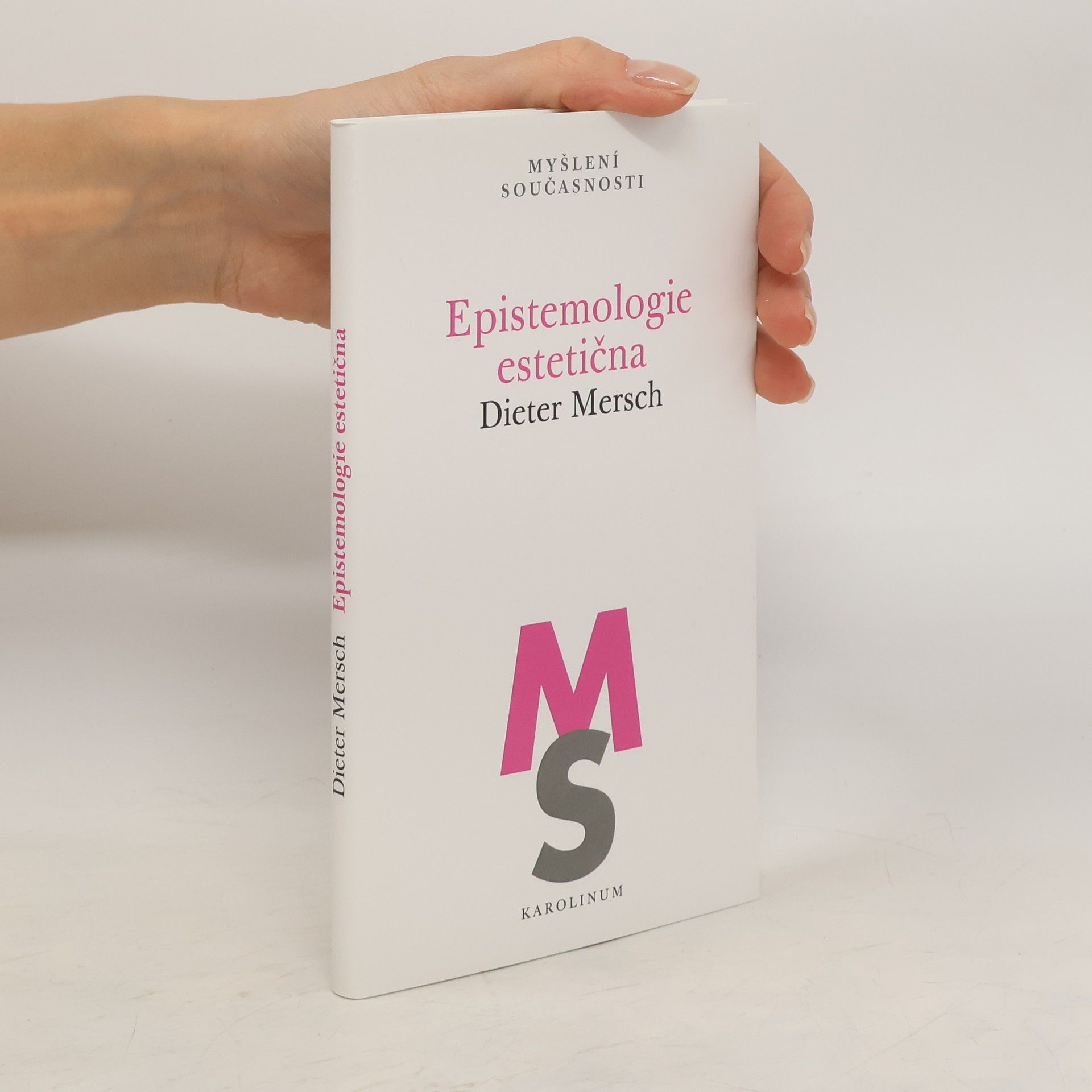Die Kunst unserer Zeit entzieht sich in weiten Teilen dem Zugriff einer klassischen, d. h. werkorientierten Ästhetik, die letztlich auf der Auffassung von Kunst als Sprache und Text beruht. Dieter Mersch setzt - im Rückgriff v. a. auf Benjamin und Lévinas - diesem Paradigma eine »performative Ästhetik« entgegen, die zwar auf zeitgenössische Phänomene der Kunst zugeschnitten ist, von dort aus aber den Bogen zurück zur »klassischen« Kunst schlägt und somit, im kritischen Dialog mit den avanciertesten Positionen der ästhetischen Theorie (Danto, Goodman), in nicht weniger als eine Theorie der Kunst von der Moderne her (mit den Exponenten Cage und Beuys) einmündet.
Dieter Mersch Bücher
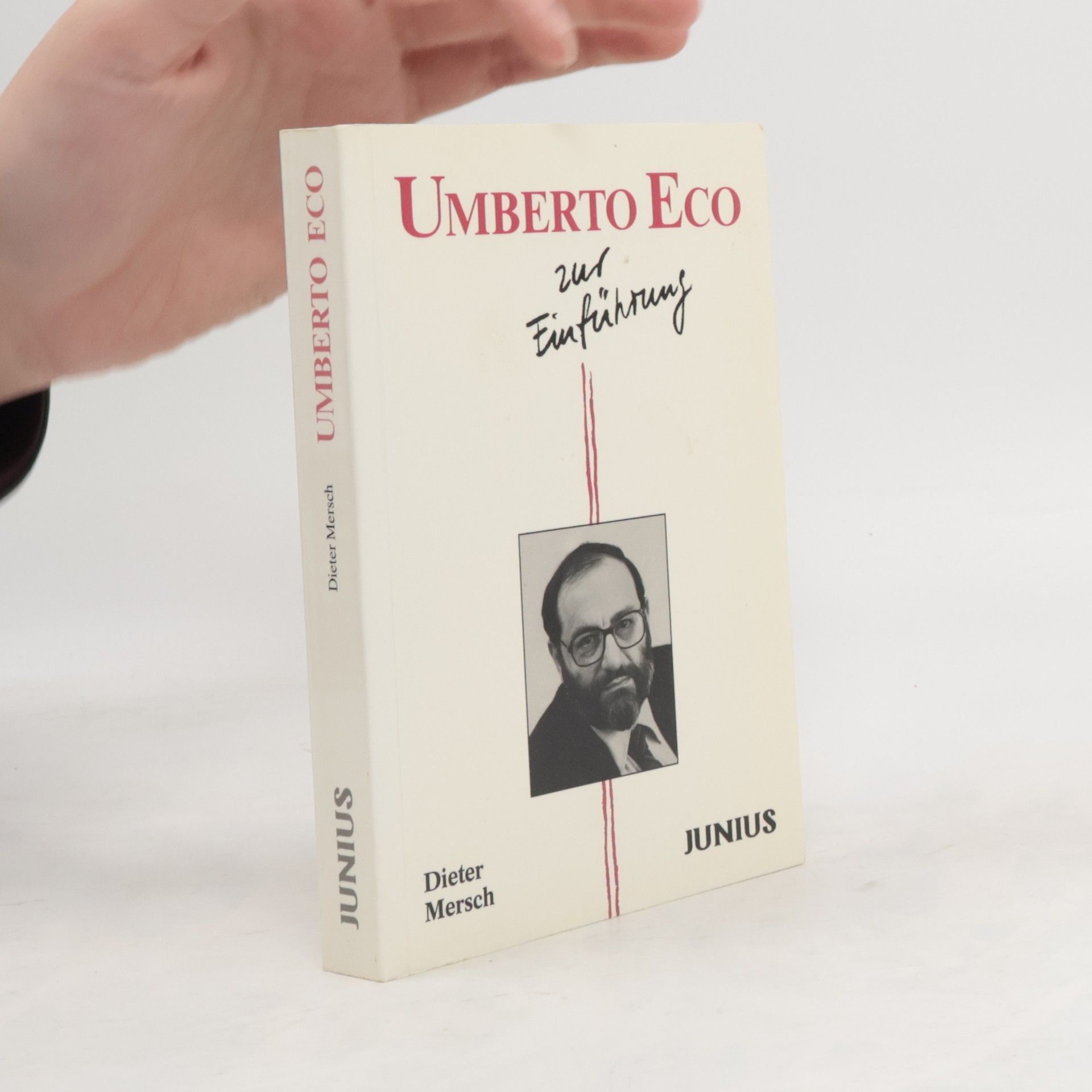


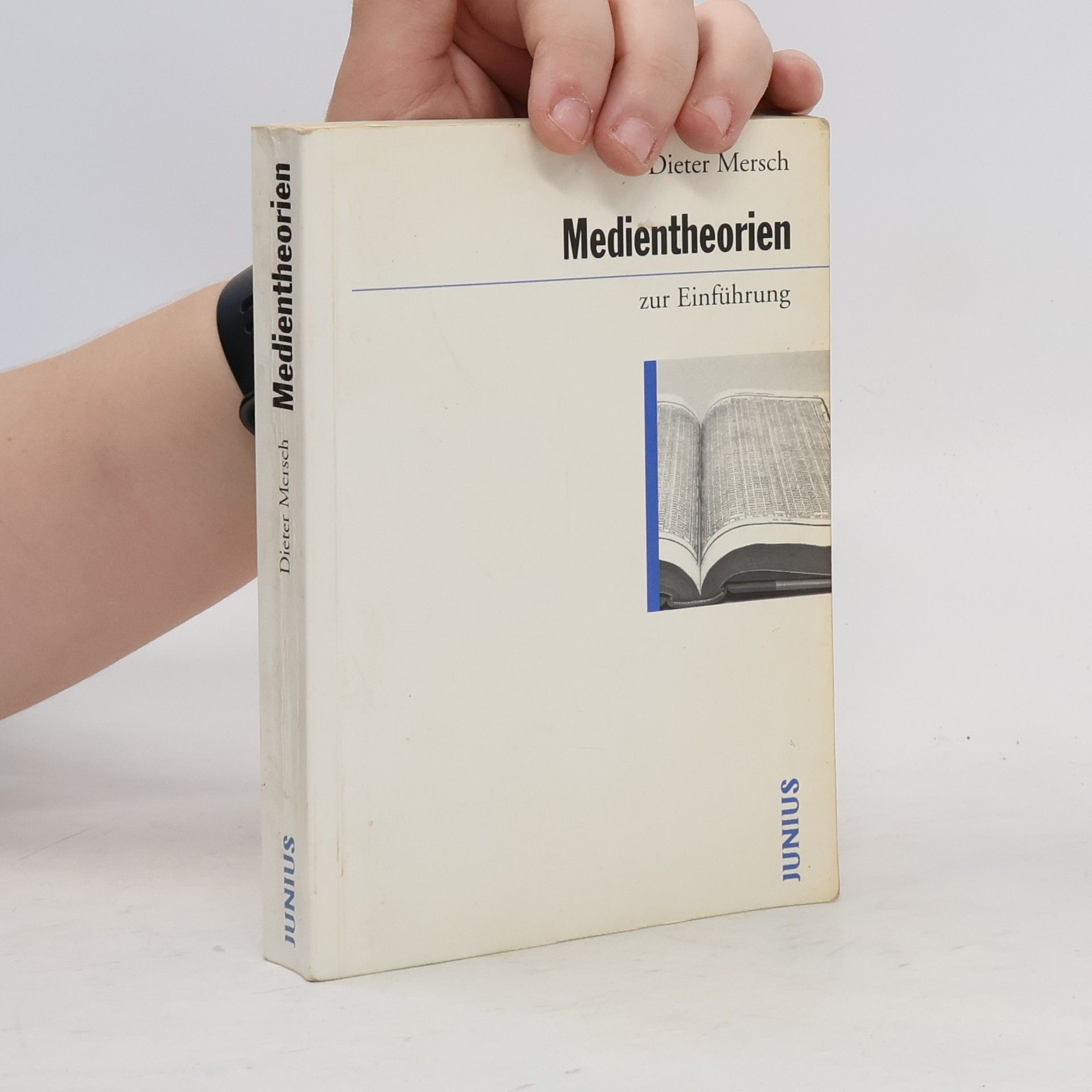


Medientheorien zur Einführung
- 250 Seiten
- 9 Lesestunden
Medientheorien reflektieren auf die Geschichte der Kulturen und ihrer Technologien. Als Zweig der Philosophie werfen sie die Frage nach den medialen Bedingungen von Bewusstsein, Erkenntnis, Handeln und Bedeutung auf. Im Anschluss an eine allgemeine Bestimmung des „Medialen“ und seiner Relevanz für Kulturtheorien geht der Band in seinem zweiten - geschichtlichen - Teil zunächst von einer „Archäologie“ des Medienbegriffs aus und stellt früheste Theoriebildungen bei Platon und in der antiken Stoa vor, um dann Spuren medientheoretischer Reflexion von Herder bis Nietzsche aufzulesen. Desweiteren werden die „Klassiker“ der Medientheorie in den 20er und 30er Jahren (Freud, Brecht, Benjamin, Parsons, Dewey) sowie die anthropologisch orientierte Medientheorie der Kanadische Schule in den 50er und 60er Jahren (Innis, Goody, McLuhan) dargestellt. Sie bilden in einem weiteren Teil die Grundlage der Rekonstruktuion systematischer Medientheorien jüngeren Datums (Baudrillard, Virilio, Flusser, Kittler). In einem vierten Teil widmet sich der Band schließlich den eigentlichen Medienphilosophien, wie sie sich von Wittgenstein, Heidegger, Luhmann und Derrida her ausbuchstabieren lassen, und stellt am Ende das Konzept einer „negativen Medientheorie“ vor.
Manifest der Künstlerischen Forschung
Eine Verteidigung gegen ihre Verfechter
Das Buch untersucht die Entwicklung der künstlerischen Forschung seit den 1990er Jahren und deren Einfluss auf verschiedene Kunstfelder. Es verteidigt die Eigenständigkeit dieser Forschung gegen akademische Ansprüche und beleuchtet die Potenziale und Radikalität ästhetischen Forschens. Die Publikation enthält auch künstlerische Collagen von Sabine Hertig.
Humanismen und Antihumanismen
Kritische Studien zur Gegenwartsphilosophie
Actor & Avatar
A Scientific and Artistic Catalog
What kind of relationship do we have with artificial beings (avatars, puppets, robots, etc.)? What does it mean to mirror ourselves in them, to perform them or to play trial identity games with them? Actor & Avatar addresses these questions from artistic and scholarly angles. Contributions on the making of »technical others« and philosophical reflections on artificial alterity are flanked by neuroscientific studies on different ways of perceiving living persons and artificial counterparts. The contributors have achieved a successful artistic-scientific collaboration with extensive visual material.
Epistemologie estetična
- 134 Seiten
- 5 Lesestunden
Představa vzájemné metodologické provázanosti výzkumu a umění, která se objevila koncem minulého století, odkrývá nové možnosti bádání a umožňuje nám pojmově uchopit takový výzkum, který by byl na umění založený. Dieter Mersch, profesor Vysoké školy umělecké v Curychu, ve své pronikavé studii dekonstruuje terminologii spojenou s otázkami vztahu estetična a vědecké pravdy, přičemž jeho snahou je odkrýt v uměleckých praktikách způsob myšlení, který nepoužívá jazyk a jehož výpovědi nejsou přeložitelné do diskurzivních forem vědy. Obhajuje tak svébytné estetické myšlení stranou lingvistického obratu, které se nedá ničím jiným nahradit.