Draculas Vermächtnis
- 259 Seiten
- 10 Lesestunden
Friedrich Kittler war ein einflussreicher Literaturwissenschaftler und Medientheoretiker, dessen Werk ab den 1980er Jahren die Medientheorie neu definierte. Kittler konzentrierte sich auf die autonome Logik von Technologien und argumentierte, dass Medien keine bloßen Erweiterungen des Menschen seien, sondern einer eigenen Entwicklungslogik folgten. Seine provokanten Thesen, die technologische Bedingungen mit Erkenntnistheorie und Ontologie verbanden, betonten oft, dass das Wesen der Existenz an das Gebundene geknüpft ist, was schaltbar ist. Mit einer Mischung aus Polemik, Gelehrsamkeit und Humor stellte er dar, dass Technologie die grundlegende Basis für menschliches Wissen und Sein bildet.


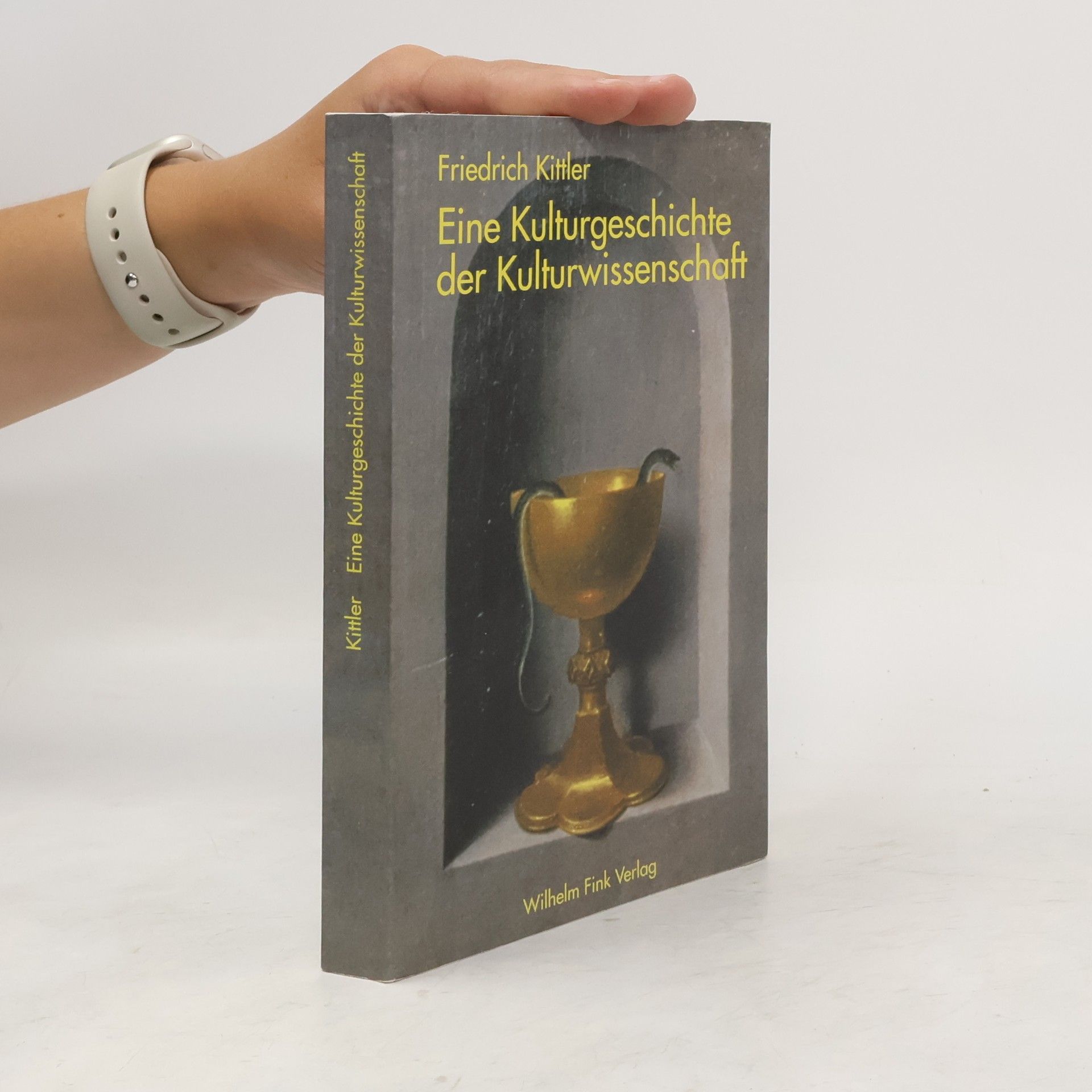


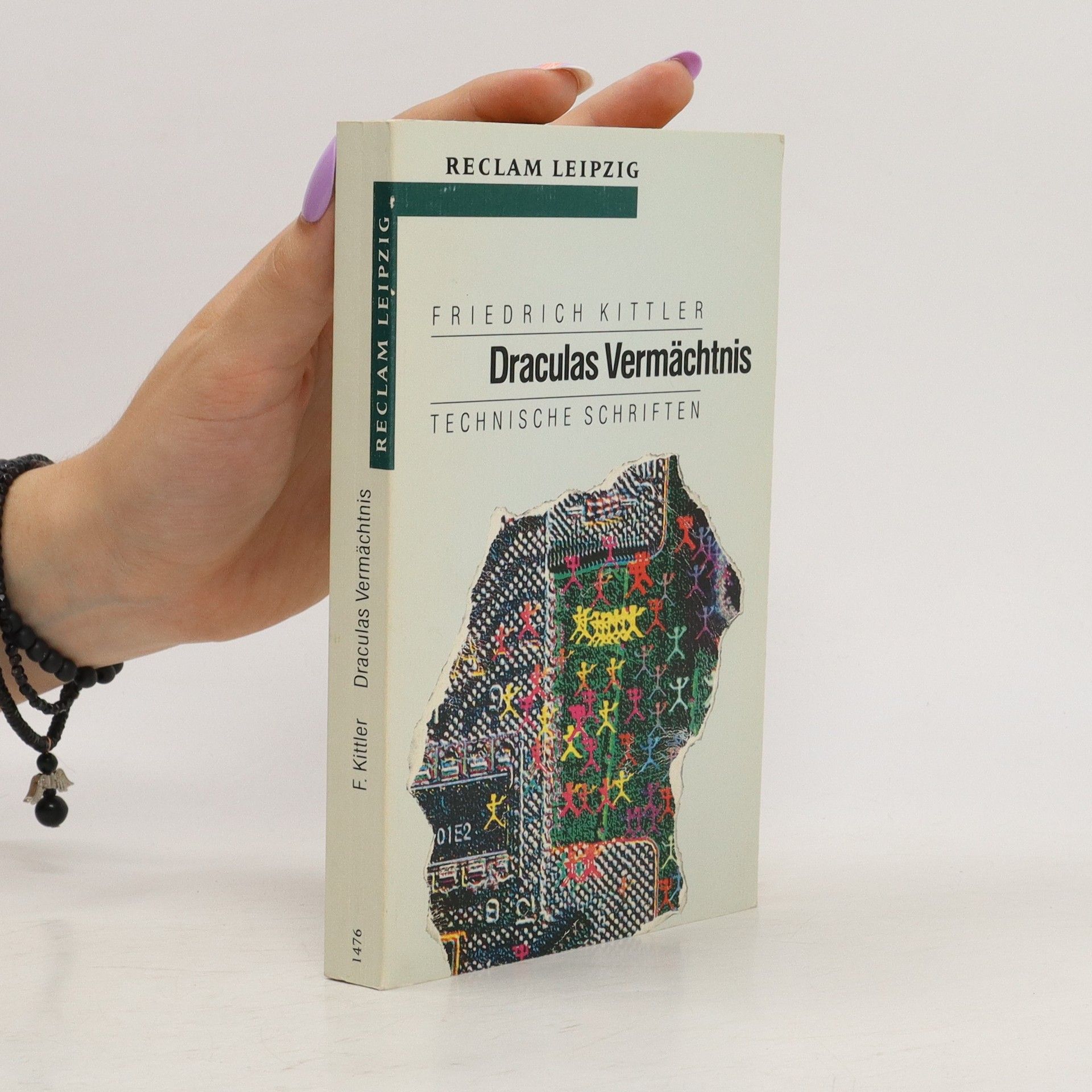
Dieses Buch hat Epoche gemacht und einen grundlegenden Paradigmenwechsel der Literaturwissenschaft eingeleitet. Nicht mehr „das sprachliche Kunstwerk“ bildet deren Gegenstand, sondern Diskurse und Medien, deren Effekte die Texte und Genres sind. Indem die „Aufschreibesysteme“ Diskursanalysen als Mediengeschichte betreiben, geben sie zugleich den Untersuchungen Michel Foucaults eine völlig neue Richtung und der Medientheorie ein neues Fundament.
Friedrich Kittlers Kultbuch von 1986 ist eine Theorie der Medien, eine Archäologie von Grammophon, Film und Schreibmaschine, in einer Situation geschrieben, in der die Industrie zur digitalen Standardisierung und Vernetzung sämtlicher Nachrichtenflüsse ausholte. An der Zeit schien ein Blick zurück: "Speichertechnik 1914 bis 1918 hieß festgefahrener Stellungskrieg; Übertragungstechnik mit UKW-Panzerfunk und Radarbildern, der militärischen Parallelentwicklung zum Fernsehen, hieß Totalmobilmachung, Blitzkrieg von 1939 bis 1945. Das größte Computerprogramm heißt SDI. Speichern, berechnen, übertragen. Weltkriege von 1 bis n-, ein Jahrhundert genügte, Leben in eine Allmacht von Schaltkreisen zu überführen.
Um der Kulturwissenschaft im Kulturmanagement eine Zukunft zu sichern, ist ein Rückblick auf die eigene Geschichte unerlässlich. Fünf Kapitel verfolgen den zweihundertjährigen Weg von Giambattista Vico bis Martin Heidegger mit kulturwissenschaftlicher Methode. Dabei werden die Gründerhelden der Kulturwissenschaft als Professoren, Beamte und Kolonisten kulturhistorisch eingeordnet. Das erste Kapitel zeigt, wie Vico die Kulturwissenschaft als Gegenpol zur cartesischen Mathematik der Natur etablierte und damit die Geschichtsphilosophie bis zu Herder, Volney und Hegel prägte. Im zweiten Kapitel werden Schriftsteller wie Flaubert und Kulturwissenschaftler wie Victor Hehn vorgestellt, die aus den Überresten des Deutschen Idealismus unser Verständnis von Alltagskultur entwickelten. Das dritte Kapitel widmet sich Nietzsche und der Tragödie eines Denkens, das die kulturwissenschaftliche Historisierung in Philosophie und schließlich in große Politik umwandeln wollte. Die letzten beiden Kapitel beleuchten die Folgen dieser Tragödie im zwanzigsten Jahrhundert, wobei Freuds Psychoanalyse und Frazers Ethnologie für den Versuch stehen, Nietzsches Ideen in empirische Kulturwissenschaften zu überführen. Heideggers Denken hingegen zielt darauf ab, die große Kulturpolitik als Gigantomachie des Seins zu vollenden. Heute wissen wir, dass Kulturen existieren, ohne grundlose Gründe zu haben, was die Kulturwissenschaften unter den Bedingungen von Tec
'Wir möchten euch Musik und Mathematik erzählen: das Schönste nach der Liebe, das Schwerste nach der Treue.' Diese beiden Worte, Musik und Mathematik, stehen für die Wurzeln von Kunst und Wissen: musikè, die Lust des Singens, Tanzens, Spielens heißt nach der Muse, die im Herzen alles aufbewahrt und daher davon sagen kann. Aus fast dem selben Ursprung stammt mathesis, das Lehren im Allgemeinen, und Mathematik, das Denken über Zahlen im Besonderen. Unter den wenigen Reimen, die in Griechenohren widerhallen, blieb der alte Spruch von pathein/mathein, leiden und lernen unverloren. Auf 'Aphrodite' und die Welt des Homeros folgen nun 'Eros' und die Polis der Athener. Das misogyne Athen des Euripides, Sokrates und Platon verdrängt Aphrodite (nach Sparta) und huldigt dem Eros, Mathesis trennt sich von Musik und wird zum Flottenbau, aus Nomos, dem archaischen Musikgesetz, wird Numismatik. Timetheos tritt in 'Konzerten', wörtlich also Musikwettkampfspielen, nicht mehr für frische Blumenkränze auf; er singt und spielt für harte Silbermünzen. Wir Sterblichen aber sind blind geworden, als eine Sonne namens Eidos – Sinn, Begriff oder Bedeutung – die Netzhäute verstrahlte von Athen bis Nagasaki. 'Musik und Mathematik', dieser Erinnerung an das homerische Ereignis des griechischen Vokalalphabets, bleibt es auferlegt, Erleuchtungen, die die Göttinnen und Götter sind, vor Platons Höhlengleichnis zu erretten.
Wir möchten euch Musik und Mathematik erzählen: das Schönste nach der Liebe, das Schwerste nach der Treue. Diese beiden Begriffe bilden die Wurzeln von Kunst und Wissen: musikè, die Lust des Singens, Tanzens und Spielens, und mathesis, das Lehren im Allgemeinen sowie Mathematik, das Denken über Zahlen im Besonderen. Bei Homer bedeutet mathein nicht einfach zählen oder rechnen, sondern bezeichnet ein dunkles Wissen, das Helden erst nach Jahren des Erfahrens erlangen. Der alte Spruch von pathein/mathein, leiden und lernen, bleibt in den Ohren der Griechen lebendig. Friedrich Kittlers Lektüren folgen Odysseus und den Sirenen, denen er eine beeindruckende Neudeutung widmet. In den Bänden begegnet er Aphrodite Eros in den Sphärenharmonien Platons und dem Spiel von lógos und phonè bei Aristoteles. Der zweite Band thematisiert das heidnische und christliche Rom, während der dritte Band die Minne und die Liebe behandelt. Der vierte Band schließlich widmet sich der Turing-Galaxis und Heideggers Gestell. Die Inhalte umfassen Themen wie Odysseus’ Leiden und Lernen, die Göttin Kirke, die Entwicklung von Musik von Geräusch zur Fuge und die Verbindung zwischen Singen und Schreiben.
I.B.4 (Zu Lebzeiten Veröffentlichtes | Aufsätze, Artikel, Rezensionen, Miszellen | 1981–1983)
Ein Gedankenreigen, der mit einer Lektüre der Lykaon- Episode aus Ovids „Metamorphosen“ anhebt, über einen Kommentar des Prozesses gegen Phryne sich zu dem aus der Katerstimmung geborenen Liebesdiskurs in Platons „Symposion“ aufschwingt, um von einer Poetik der Gewandstudie getragen unsanft in Goethes und Hegels Griechenland zu landen, aus dem sich zu befreien es einer neuen Physik bedurfte.
Frühe Schriften aus dem Nachlass
Baggersee versammelt frühe, unveröffentlichte Texte aus dem Nachlass Friedrich Kittlers. Die zwischen Mitte der 60er und Mitte der 70er Jahre verfassten Essays entstanden im Kontext neuer Freiräume. Am titelgebenden Baggersee, einer Kiesgrube bei Niederrimsingen in der Nähe Freiburgs, verbrachte Friedrich Kittler lange Sommer mit Schwimmen, Sonnen, Denken, Lesen, Diskutieren, Lieben und Grenzerfahrungen machen. Die Themenvielfalt der hier versammelten frühen Texte verdankt sich nicht zuletzt den Sommertagen am Baggersee. Die Essays kreisen um Gegenstände des Alltags, Lektüren, Reisebeobachtungen, Naturphänomene, Sinneswahrnehmungen, Körperfunktionen, Wiedergänger, Natur und Kultur, Tod und Leben. Friedrich Kittler schreibt über Haare, Tiere, Filme, Spielautomaten, Kreuzworträtsel, Spiegel, Popmusik, Technik, Rauchen, Rausch und Mode. Am Ende der Studentenbewegung war auch in Freiburg der Aufbruch zu einem neuen Denken spürbar. Das Bewusstsein einer Veränderung oder Krise eröffnete Raum für ein Schreiben, in dem Gedankengespinste, Beobachtungen, systematische Erörterungen und solitäre Einfälle zusammentreten.
Tristans Narrheit als Wahrheitsereignis. Mit einer Übersetzung der "Folie Tristan" aus dem Altfranzösischen von Friedrich Kittler
Nichts für politisch Korrekte, was sich am Ende dieses seinsgeschichtlichen Freilegens zeigt – und wohl auch nichts für die »Literaturgeschichte«. Im Zentrum des dritten Mittelalter-Bandes von »Musik und Mathematik« steht die Liebe von Tristan und Isolde. Glücklicherweise haben wir einen Text aus Friedrich Kittlers Nachlass, der die Richtung des Buches weist. Aus der Vielzahl der um 1200 zirkulierenden Erzählungen wählte Kittler die »Folie Tristan« in der Oxforder Version, da sie den Status einer in sich geschlossenen textuellen Komposition hat. Seine präzise Übersetzung in deutsche Blankverse sucht eine eigene Sprache und meidet sowohl Archaismen als auch moderne Wendungen. Diese Freilegung zeigt sich in Kittlers Analyse: Während im Hof Nausikaas das Zusammensein von Göttern als Frevel besungen wird, wird es in der »Folie Tristan« zur Heldentat. Wer solche Übertretungen den Ketzerlehren der Katharer gleichstellt, hat untertrieben. Hans Ulrich Gumbrecht, selbst romanistischer Mediävist, führt unter dem Titel »Tristans Narrheit als Wahrheitsereignis« in diese Übersetzung und in »Isolde als Sirene« ein und beleuchtet exemplarisch das Gesamtwerk des späten Kittlers. Dieser Band ist unüberlesbar: ein Buch der Freunde.