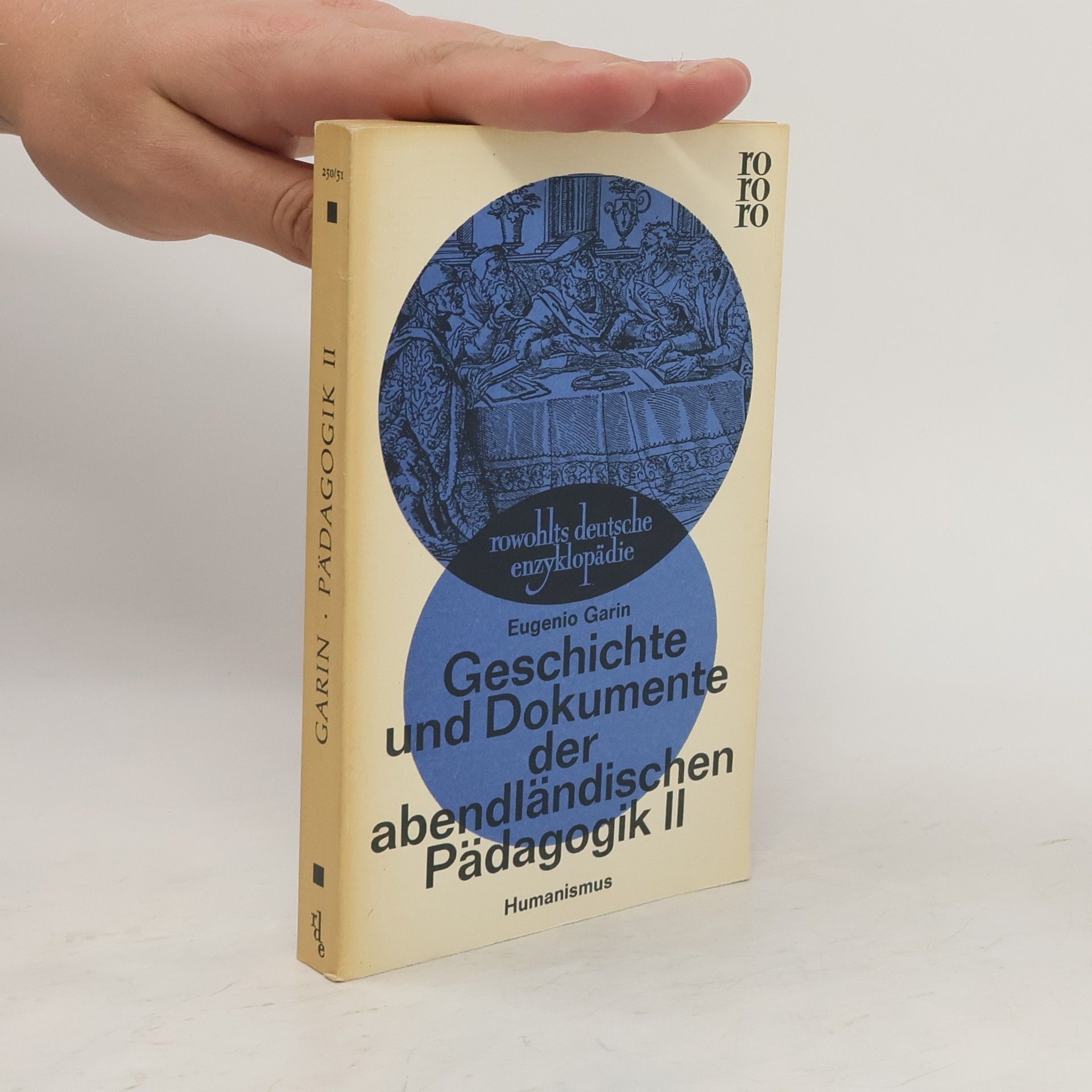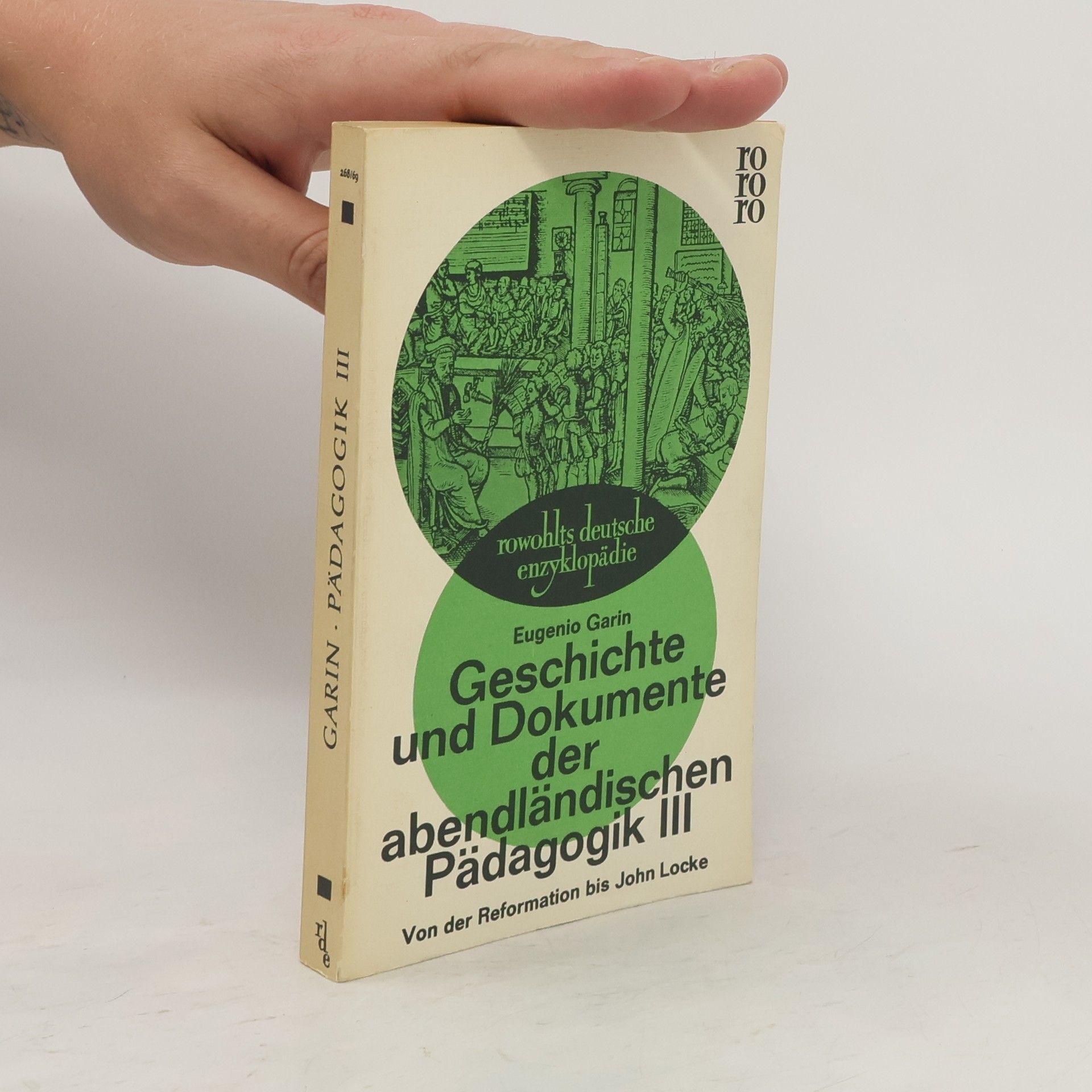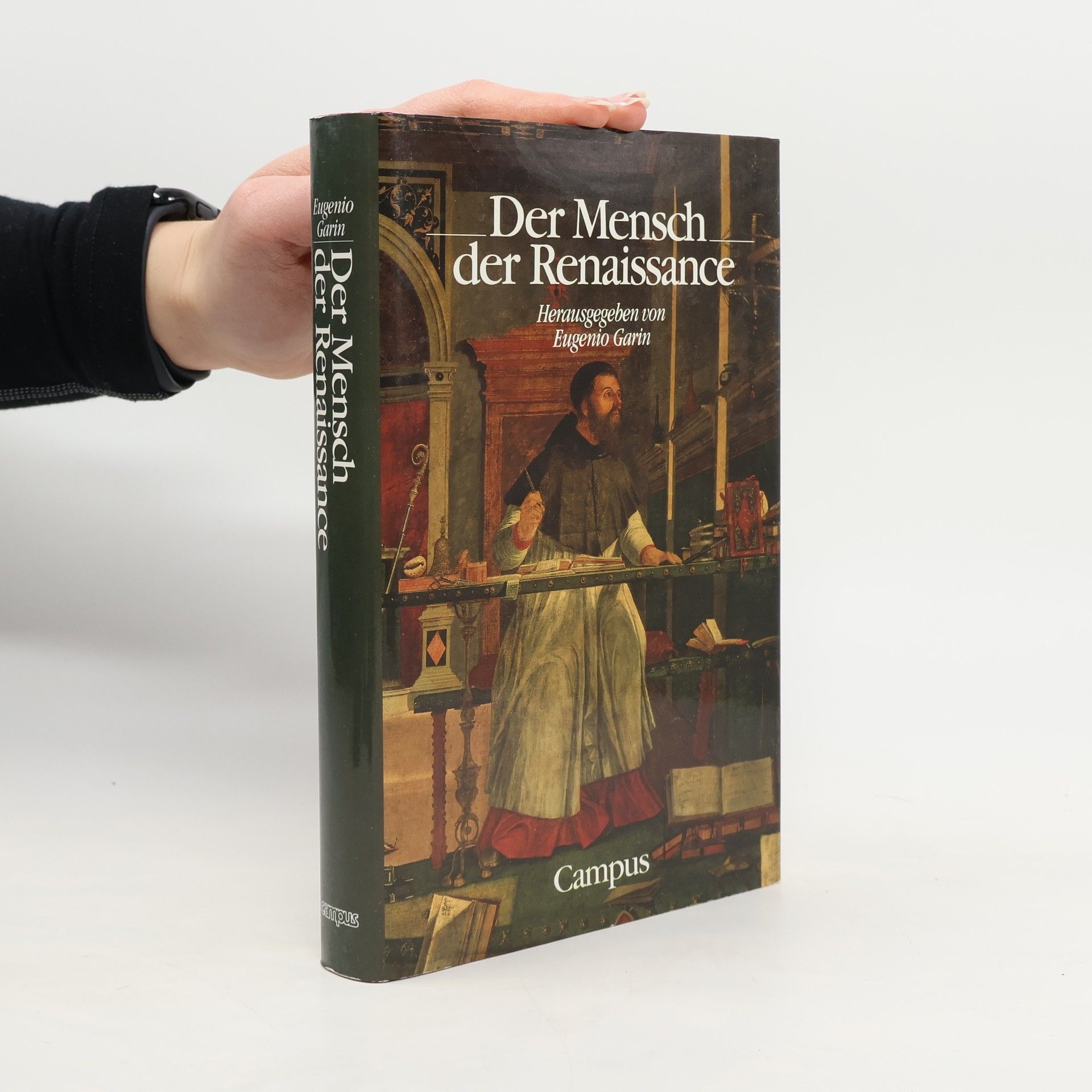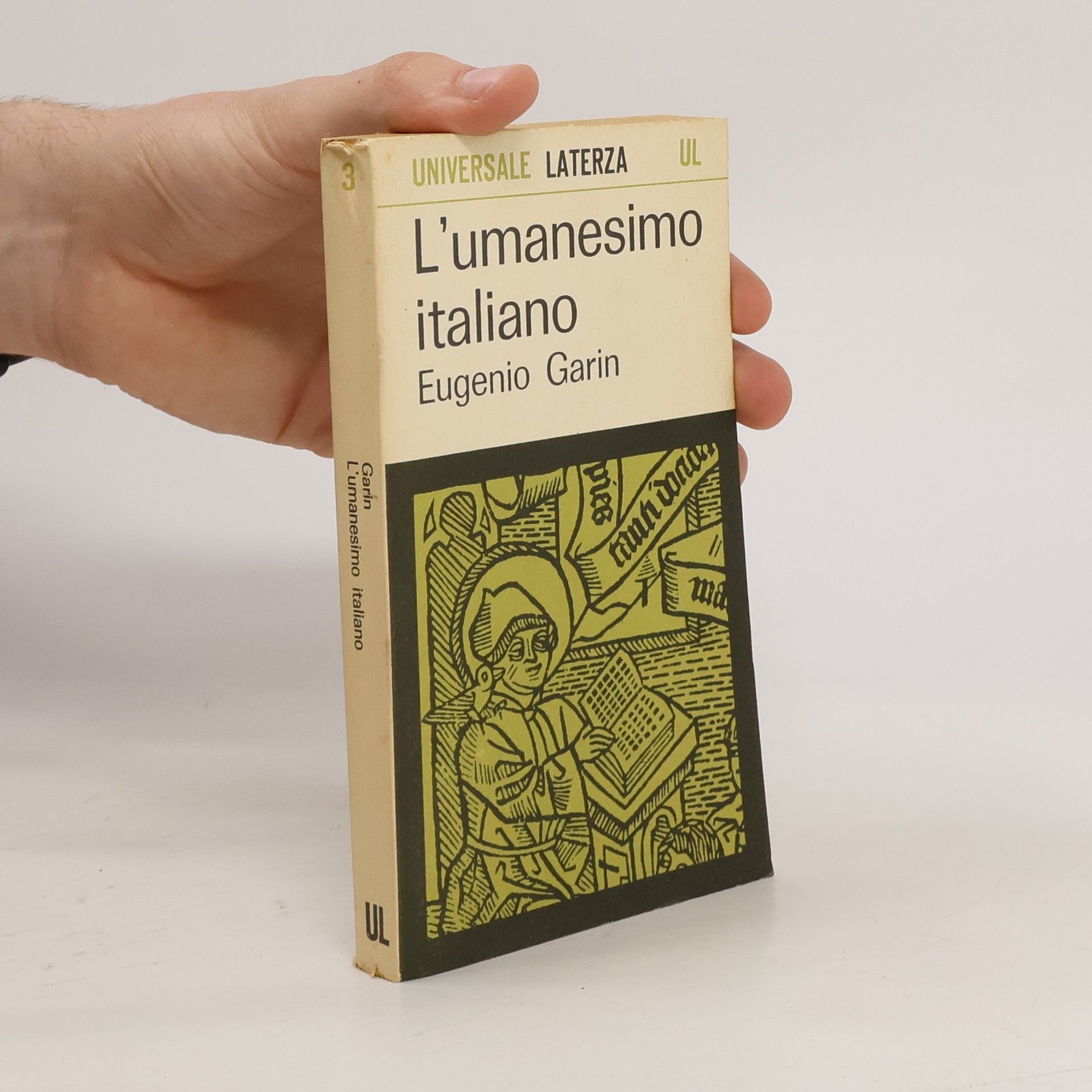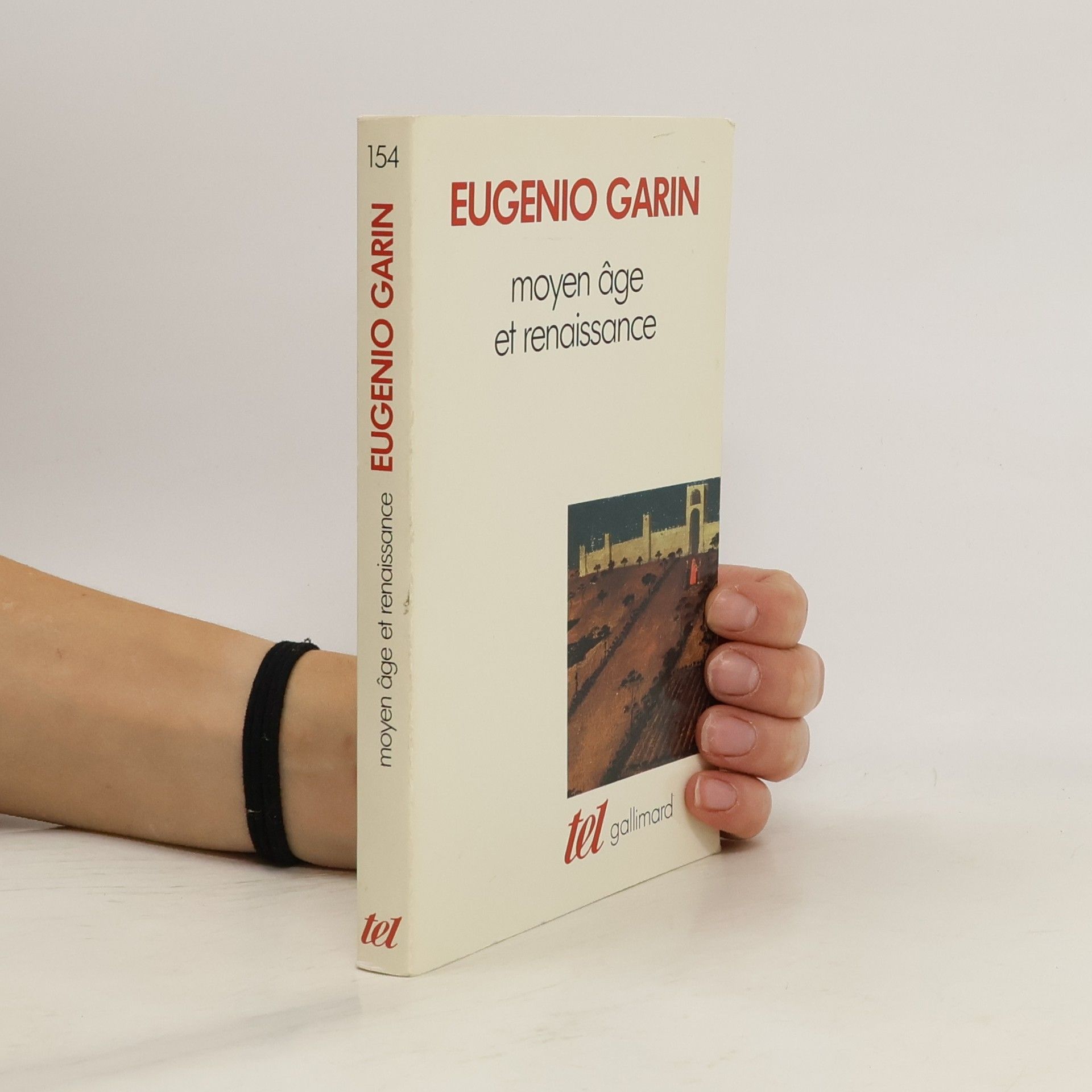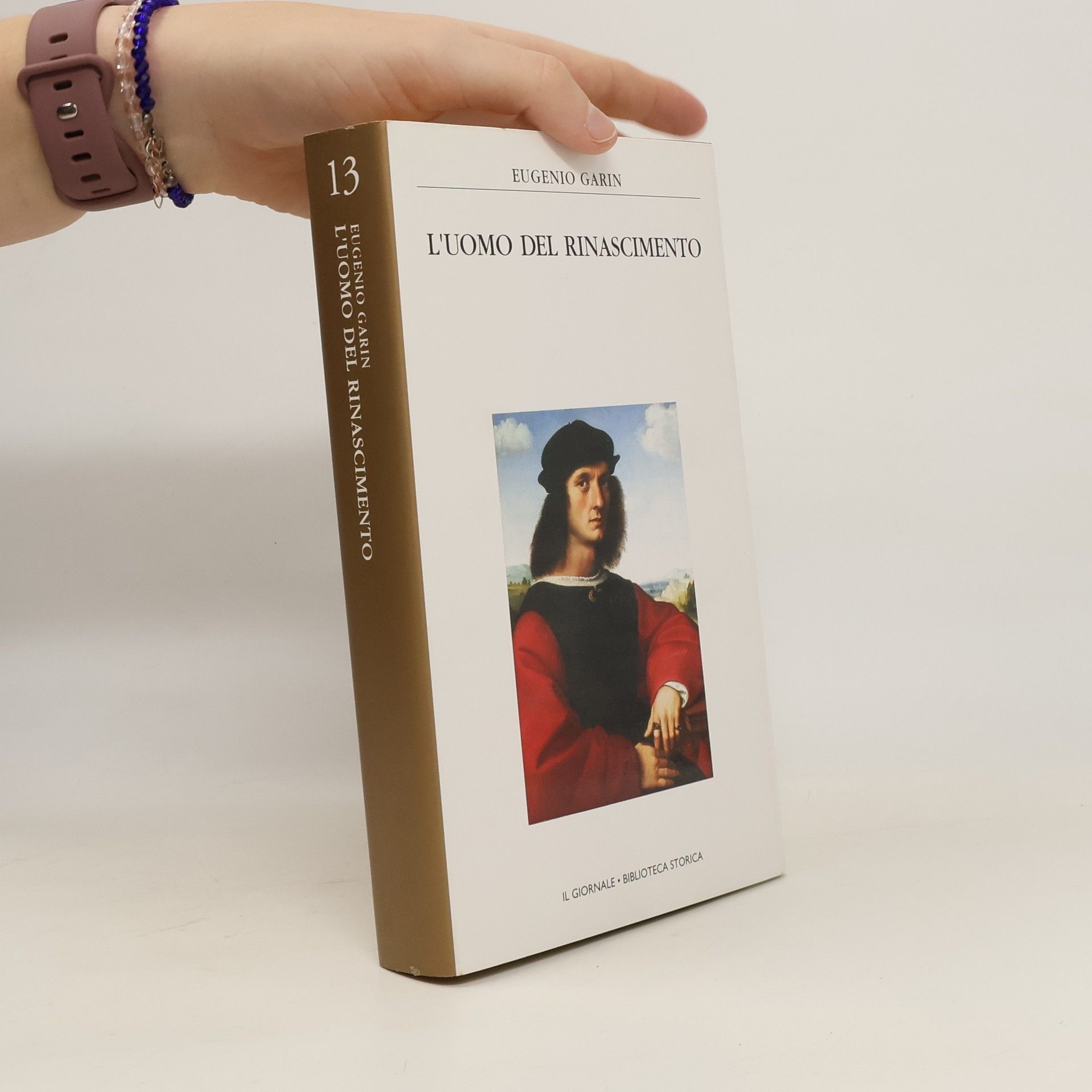Der Mensch der Renaissance
- 403 Seiten
- 15 Lesestunden
1990. Gr.-8°. 403 S., Orig.-Pappband mit Orig.-Schutzumschlag. - Enthä Der Mensch der Renaissance; John Der Früst; Michael Der Condottiere; Massimo Der Kardinal; Peter Der Höfling; Eugenio Der Philosoph und der Magier; Alberto Der Kaufmann und der Bankier; André Der Künstler; Margaret L. Die Frau; Tzvetan Der Reisende und der Eingeborene.