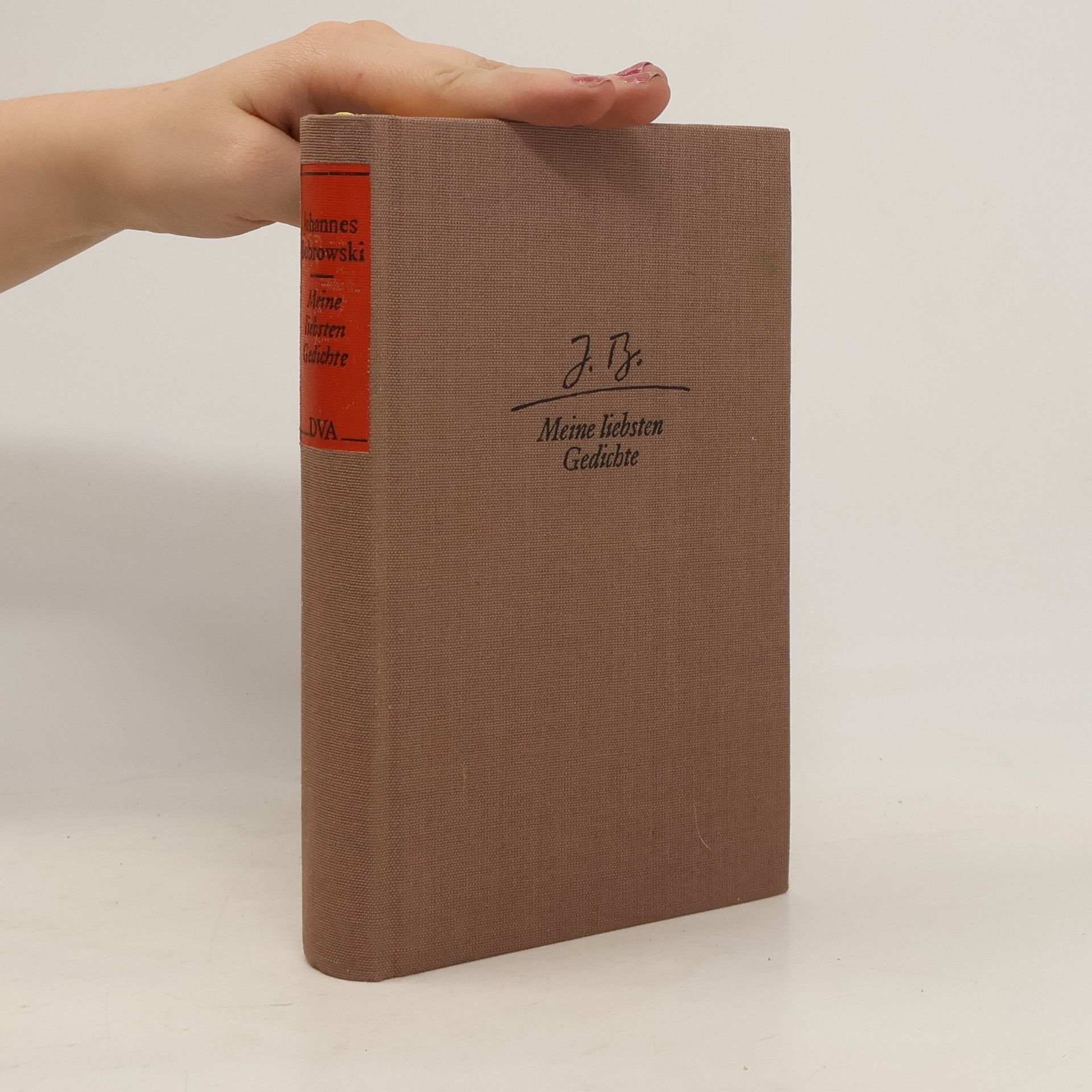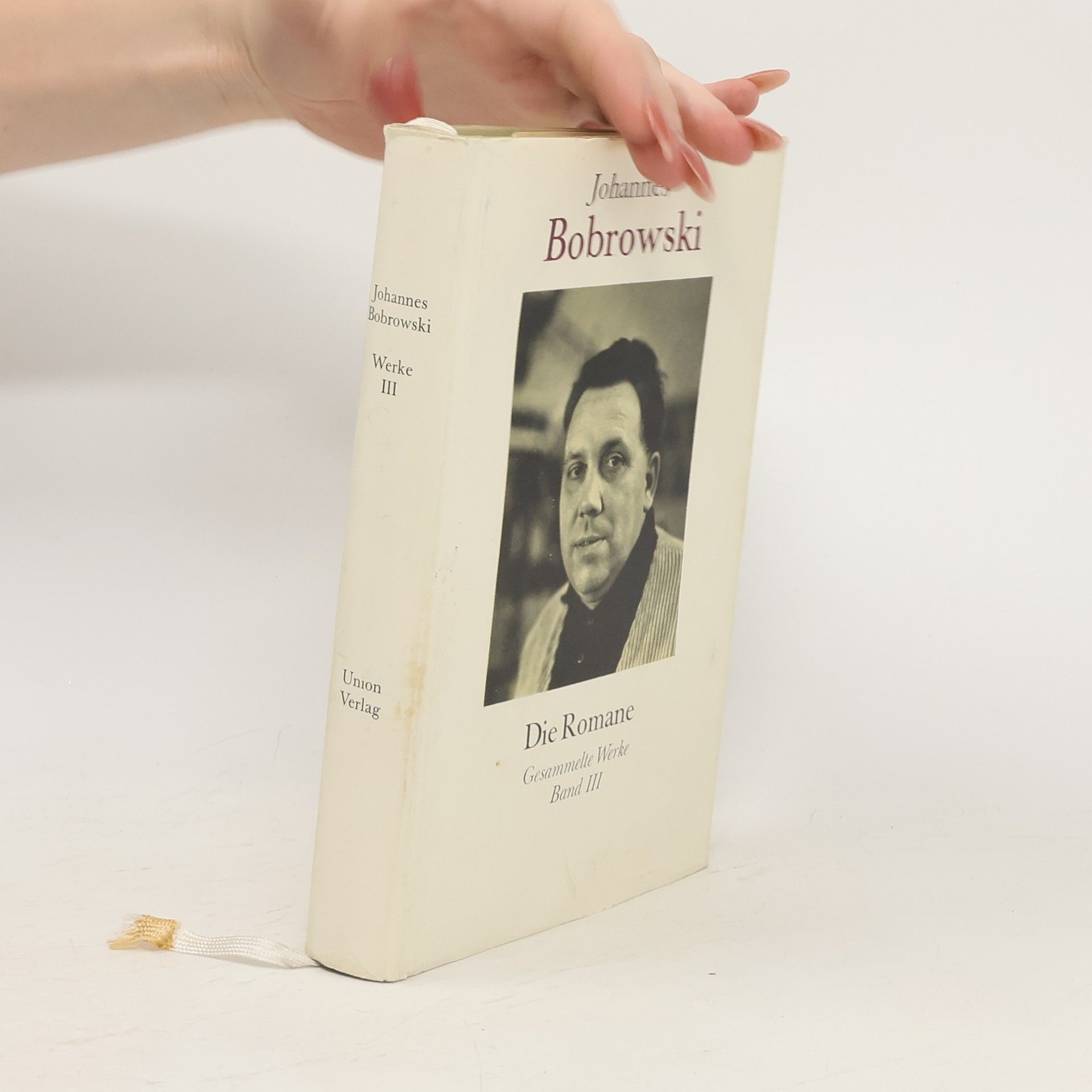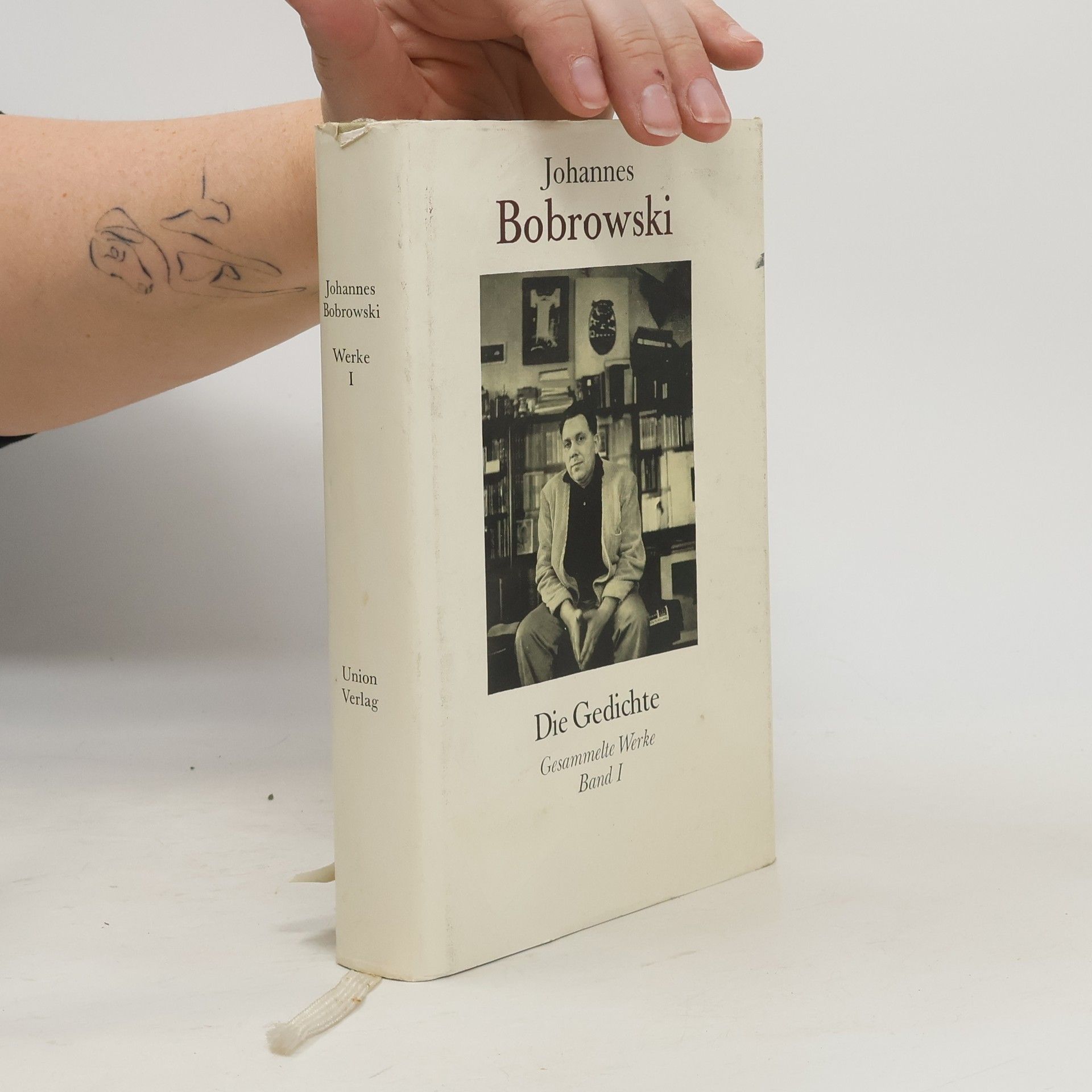„Der schafft Sprachbilder, wie ich sie sonst nirgends gelesen habe.“ Herta Müller Als im Februar 1961 Johannes Bobrowskis erster Gedichtband „Sarmatische Zeit“ erschien, hatte der Schriftsteller nur noch wenige Jahre zu leben. Doch die knappe Zeit reichte ihm aus, um sich bis zu seinem Tod 1965 als einer der suggestivsten und bildkräftigsten Lyriker der deutschen Nachkriegsjahrzehnte zu etablieren. Obwohl in der DDR lebend, stießen seine Texte in beiden Teilen Deutschlands auf Anerkennung: Man machte in ihnen eine neue Art aus, sich zur Welt zu verhalten; seine Themen und Sprachgesten fanden in Lyrik und Prosa anderer Autoren ein vielfältiges Echo. Inzwischen ist sein Werk weltweit verbreitet und in fast alle europäischen Sprachen übersetzt. Am 9. April 2017 jährt sich der Geburtstag des Schriftstellers zum 100. Mal. Zu diesem Anlass bringt die DVA die Gedichte Johannes Bobrowskis neu in einem Band heraus, ergänzt durch ein Nachwort des vielfach preisgekrönten Literaturkritikers Helmut Böttiger.
Johannes Bobrowski Bücher
Johannes Bobrowski war ein deutscher Lyriker, Erzähler und Essayist, dessen Werk tief in seiner Kenntnis osteuropäischer Landschaften und der Verbindung deutscher und slawischer Kulturen wurzelte. Seine Gedichte und Prosa erforschen Themen wie Erinnerung, Schuld und Identität, oft unter Einbeziehung antiker Mythen und sprachlicher Vielfalt. Bobrowskis charakteristischer Stil zeichnet sich durch eindringliche Bilder und eine melancholische Atmosphäre aus, die die komplexe Geschichte der Region und seine eigenen Erfahrungen widerspiegeln. Seine literarische Bedeutung liegt in seiner tiefgreifenden Fähigkeit, die Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz und die komplexen Verbindungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart einzufangen.

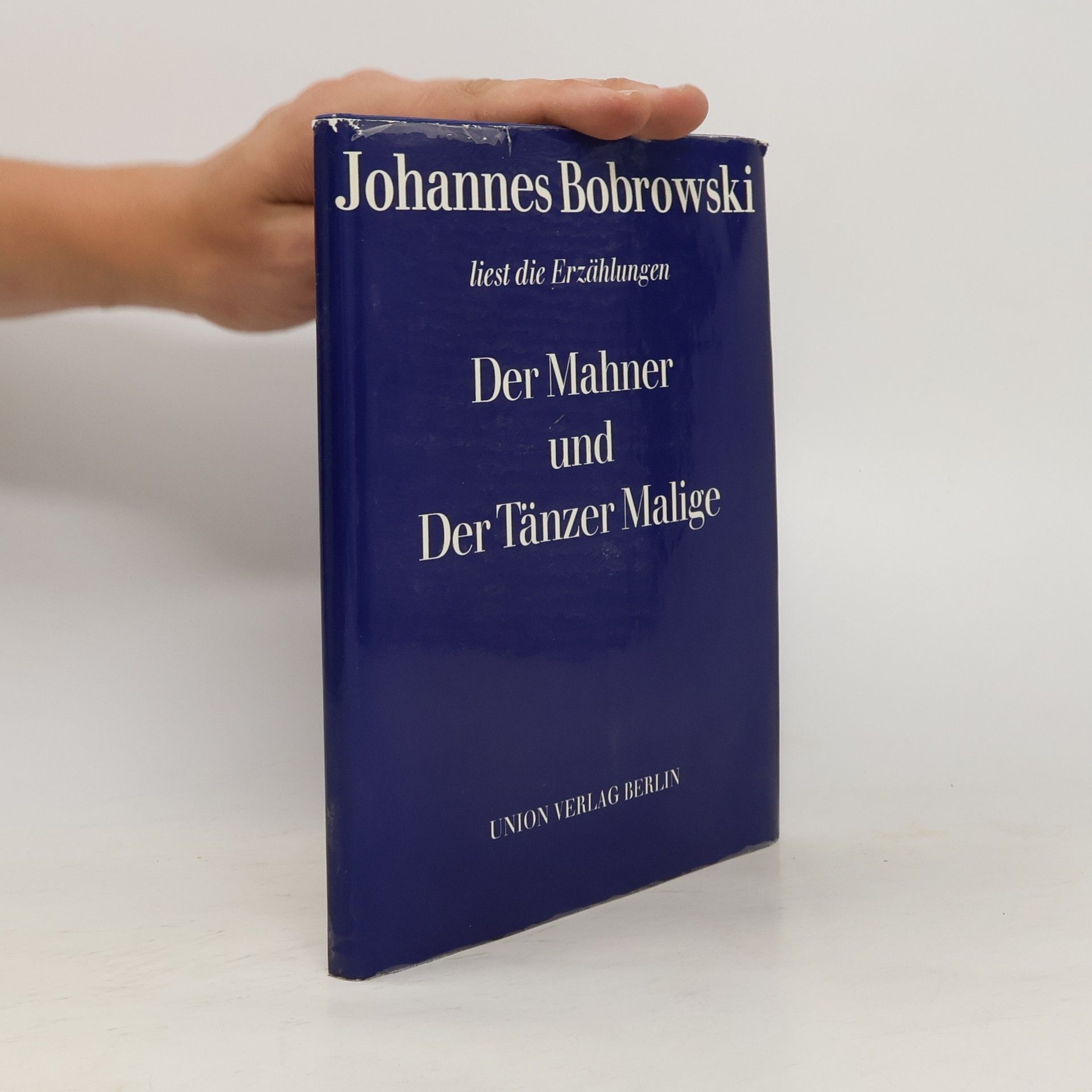
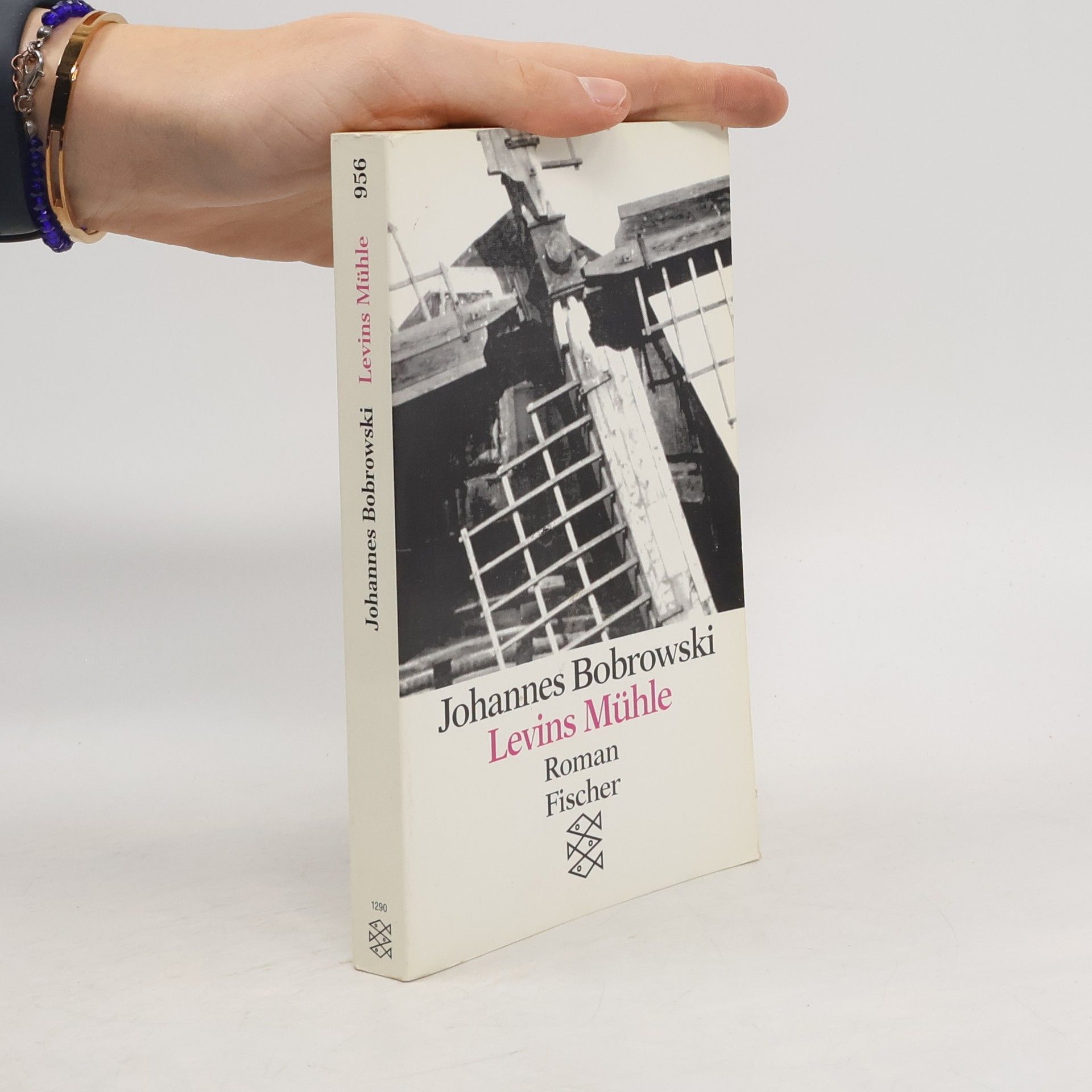




Der dritte Band der Gesammelten Werke enthält die Romane »Levins Mühle« und »Litauische Claviere«. »Levins Mühle« behandelt einen historischen Kriminalfall von 1874 und reflektiert über den Verlust von Heimat in der deutschen Vergangenheit. »Litauische Claviere« thematisiert das Verhältnis der Deutschen zu ihren östlichen Nachbarn.
Litauische Claviere ist Bobrowskis zweiter Roman, den er kurz vor seinem frühen Tod 1965 abschloss: Die Geschichte, die 1936 im Memelgebiet spielt, erzählt vom Gymnasiallehrer Voigt und dem Konzertmeister Gawehn, die eine Oper über den litauischen Nationaldichter Kristijonas Donelaitis schreiben wollen. Bei ihren Recherchen geraten sie in die blutigen Wirren der Feierlichkeiten der nationalen Vereine von Deutschen und Litauern. Das neue, ausführliche Nachwort erhellt die historischen Bezüge.
Levins Mühle
- 294 Seiten
- 11 Lesestunden
Bobrowski hat seinen Roman im Westpreußen von 1874, im Kaiserreich, nicht weit von Thorn, angesiedelt. Er erzählt uns von der sehr besonderen Landschaft, von den Wiesen, den Wäldern und den Flüssen; er erzählt von den Tieren dort, den Pferden, den Schweinen und den Vögeln, die allein in unzähligen Arten vorkommen, seien es zarte Schwalben oder fette Gänse. Und er erzählt von den Menschen. Da sind die katholischen Polen, Juden, Zigeuner mit Geige, Vaganten, Kossäten, und natürlich die Deutschen, Baptisten, Adventisten, Methodisten. Ein lebhaftes Durcheinander. Die Geschichte, um die es geht, ist einfach: Der Großvater des Erzählers, Mühlenbesitzer und Deutscher, von dem es heißt, er leide an der Galle, hat das Wasser gestaut und dann die Mühle seines Konkurrenten, des Juden Levin, der wiederum am Herzen leidet, weggespült. Und weil sich der Levin das nicht gefallen lassen will, klagt er vor Gericht in der Stadt. In gemütlichem Tonfall erfahren wir diese spannungsgeladene Geschichte. Schnell sind wir mittendrin, hören den Leuten zu, so wie sie eben reden, maulfaul und redselig zugleich, hören ihren Dialekt und unbekannte, klingende Worte. Vor uns tut sich ein Reichtum an Sprache und Geschichten auf, wie er uns selten begegnet.
Meine liebsten Gedichte
- 432 Seiten
- 16 Lesestunden
Die Romane
Gesammelte Werke III.