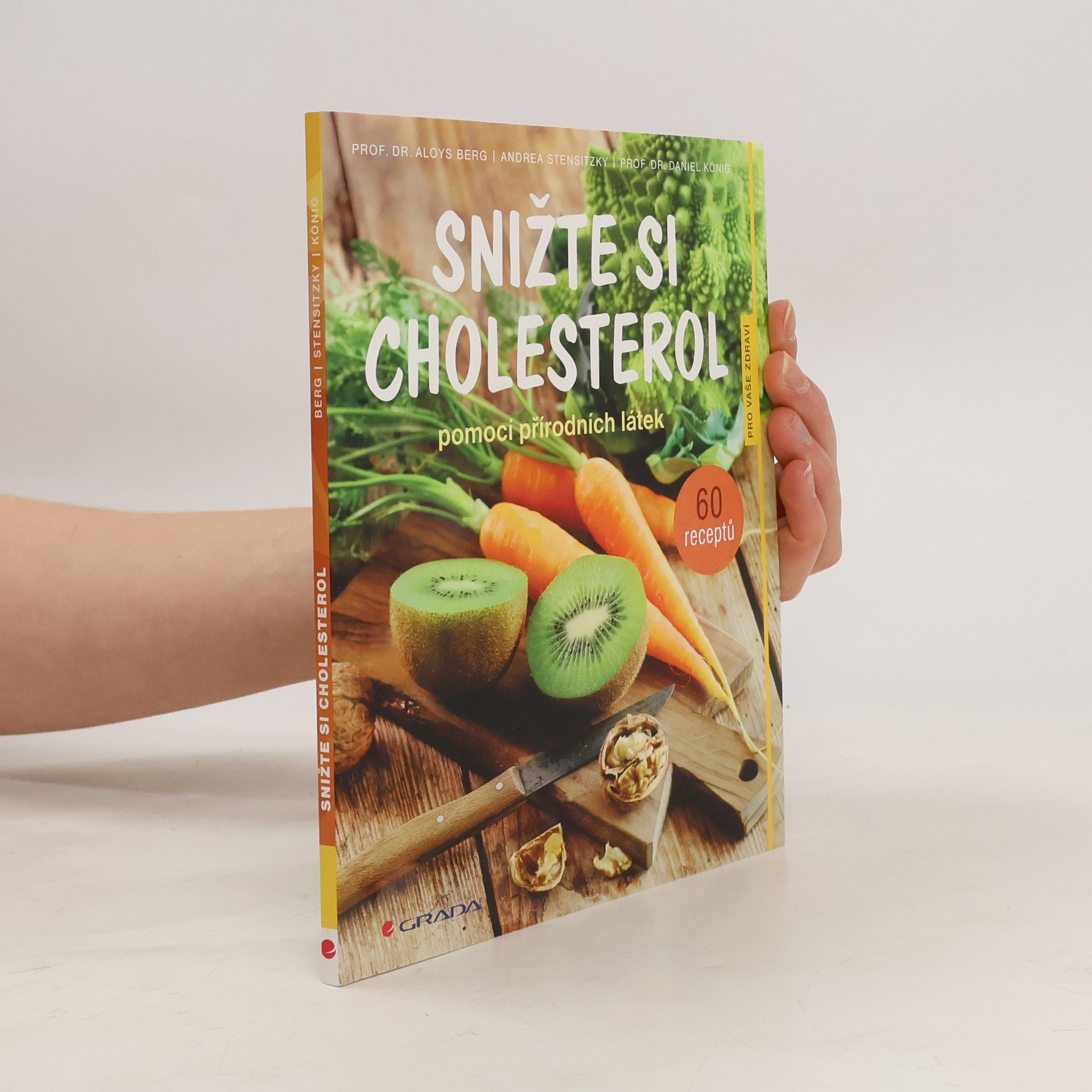Echt jetzt, das war's?
Erkenntnisse einer Nahtoderfahrung
Dezember 2007: Daniel König verunglückt in den Schweizer Bergen und stirbt. Im »Jenseits« erlebt er die Erde als Hologramm und unfassbares Energiefeld. Auf der Erde glauben wir, vieles als schicksalhaft hinnehmen zu müssen. Doch das ist nicht so. Wir können es direkt beeinflussen. Von den Engeln erhält Daniel einen besonderen Auftrag und darf dafür zurückkehren auf die Erde. Doch hier erweist es sich als schwierig, die Erkenntnisse aus der Welt der Engel im Alltag umzusetzen. Da trifft er auf Evelyne, die ihn mitnimmt auf die nächste spannende Reise. Motiviert und gestärkt erhält er prompt die schwierigste Aufgabe seines Lebens: Seine Schwester Carmen, die ihn 2007 vor dem Tod in den Bergen rettete, erkrankt lebensbedrohlich. Wird er ihr helfen können? Und wird er endlich den Auftrag der Engel erfüllen können? Sein Tod hat Daniel gezeigt, dass wir alle in ein himmlisches Konzept eingebunden sind, unser Dasein energetisch beeinflussen und zum Positiven wenden können. Das Universum folgt einem Plan und wir sind alle teil dessen. Angst und Krankheit können gewandelt werden, in Glück und Liebe. Doch dazu müssen wir genau hinhören. Wie das geht, erklärt Daniel König in seinem Betriebshandbuch zur himmlischen Mechanik.