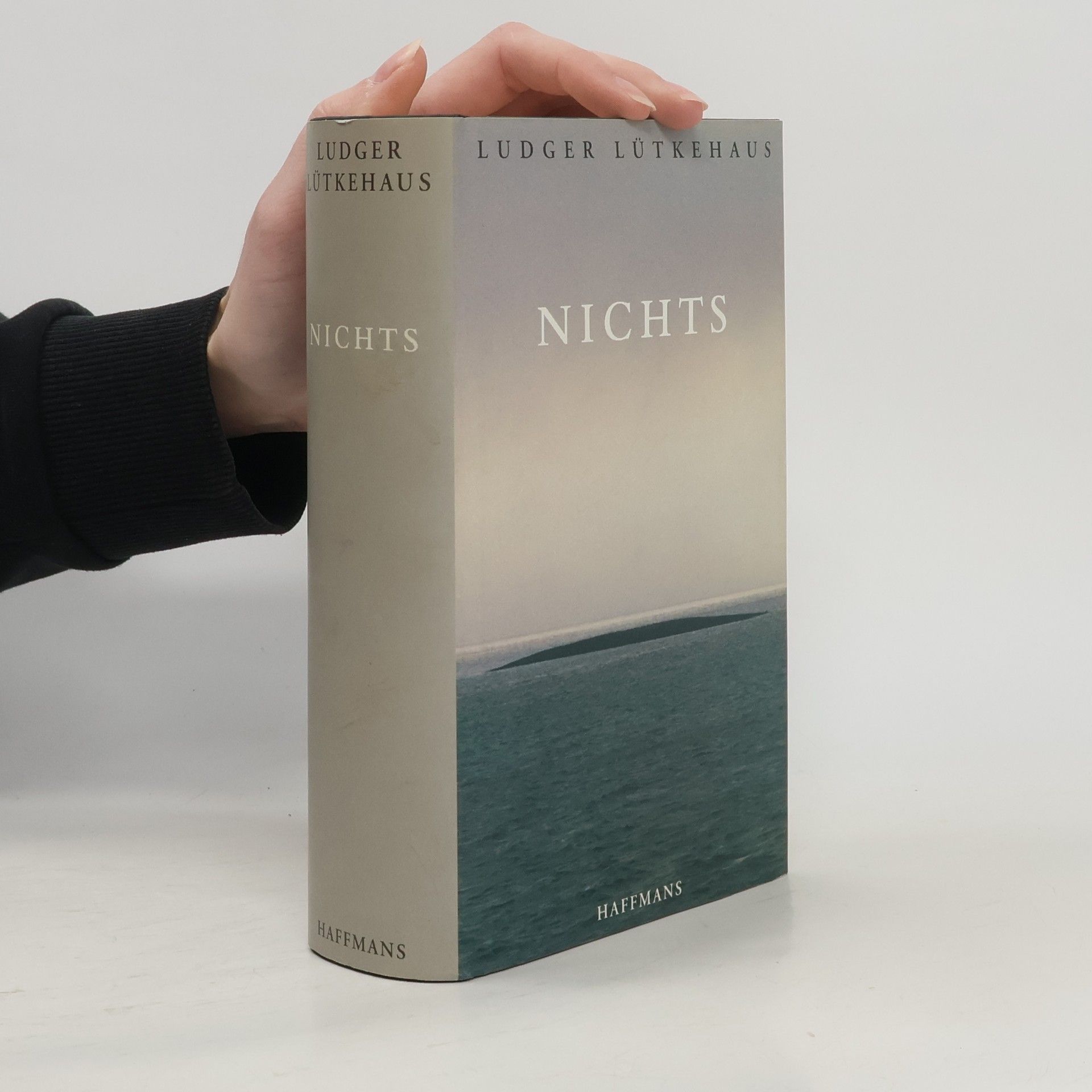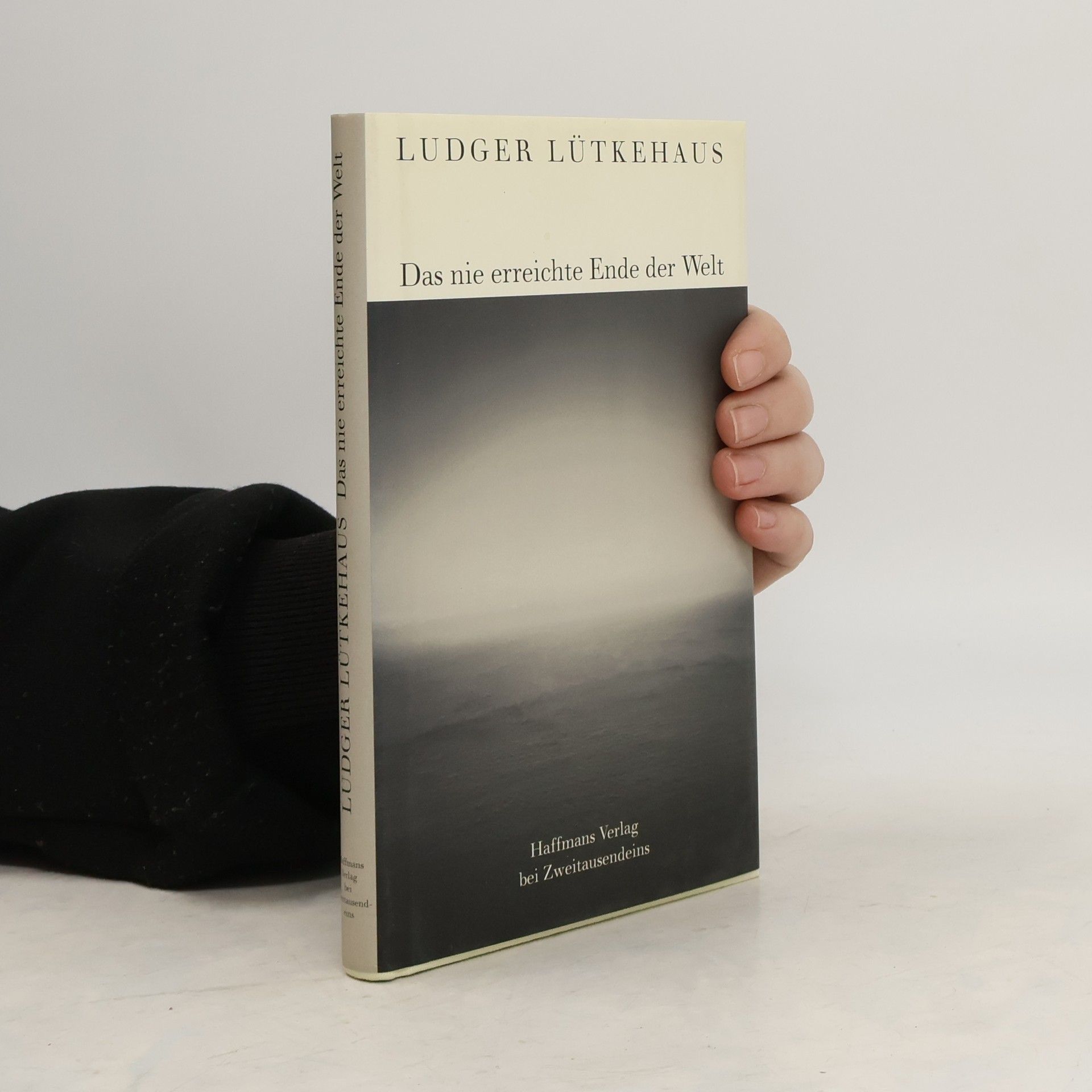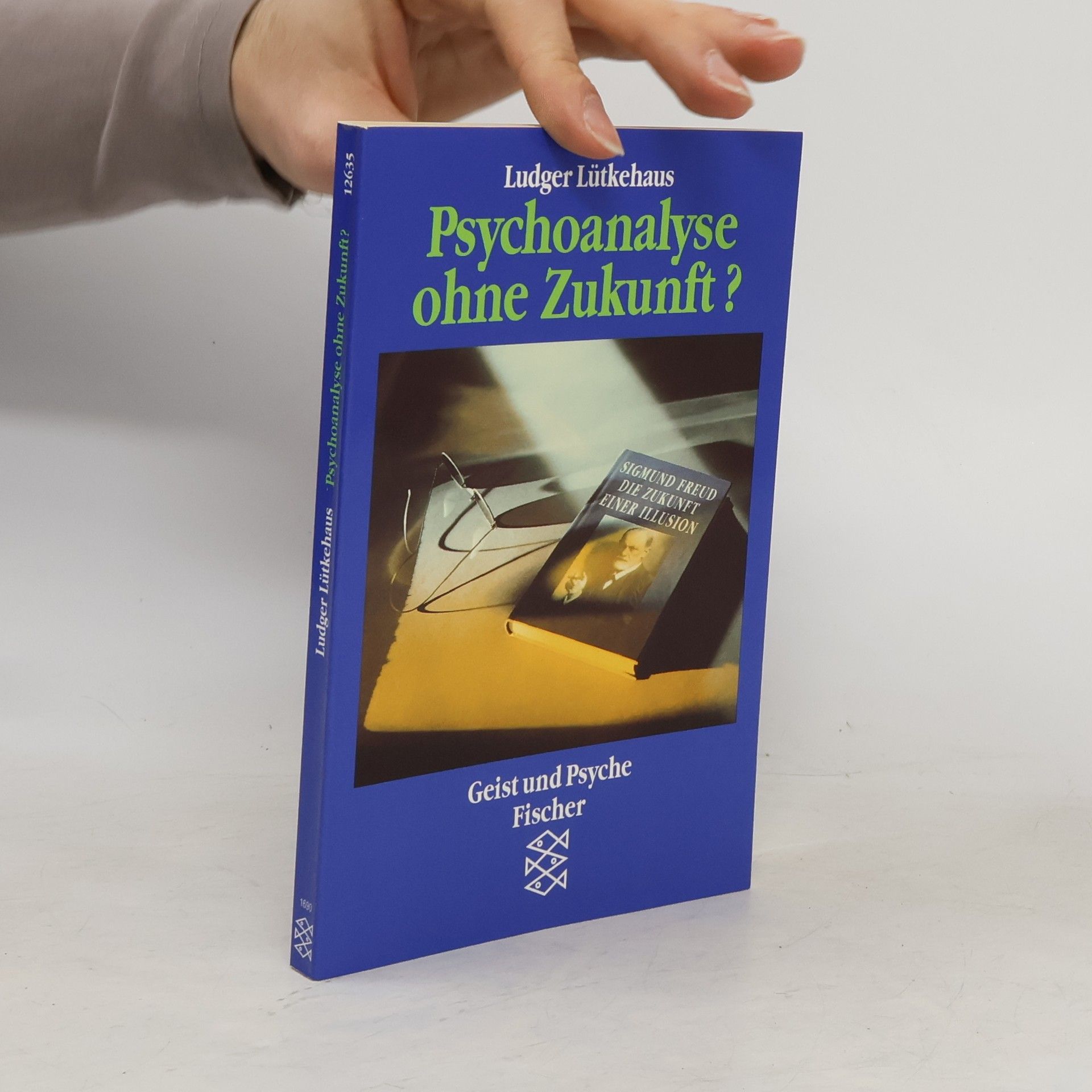Nach den Ausgaben letzter Hand. Mit Abb. 676 S.
Ludger Lütkehaus Bücher
- Gerd Groothus
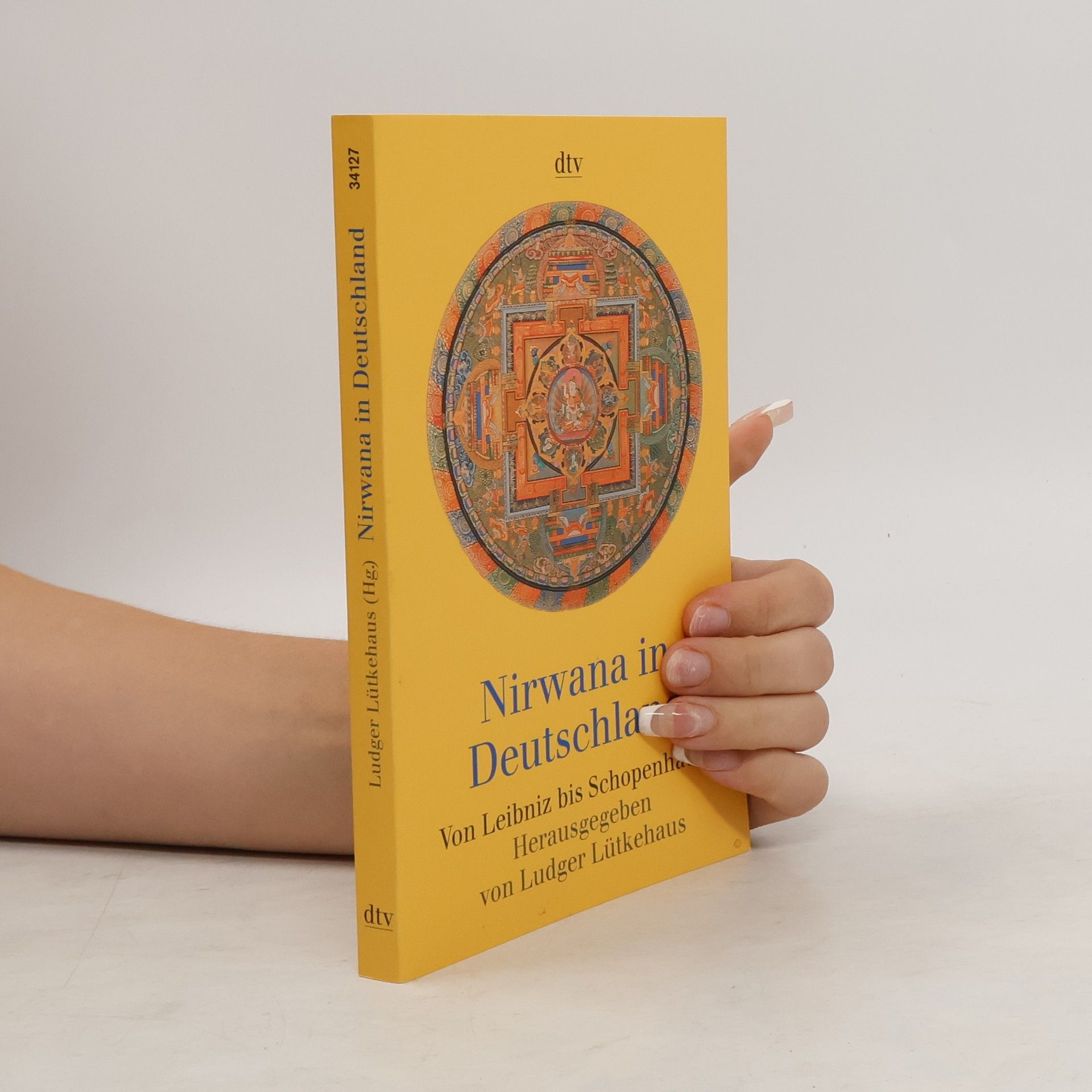
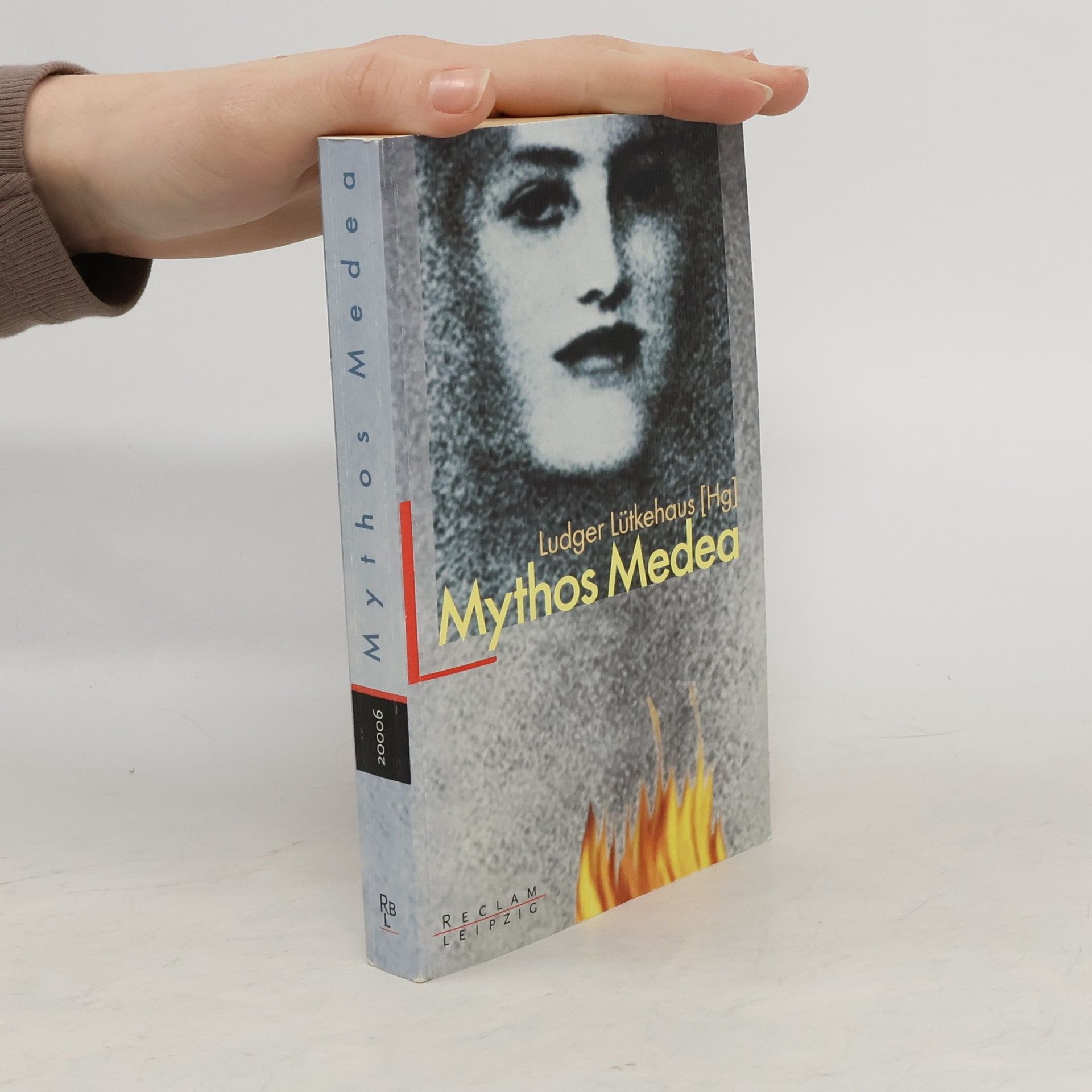
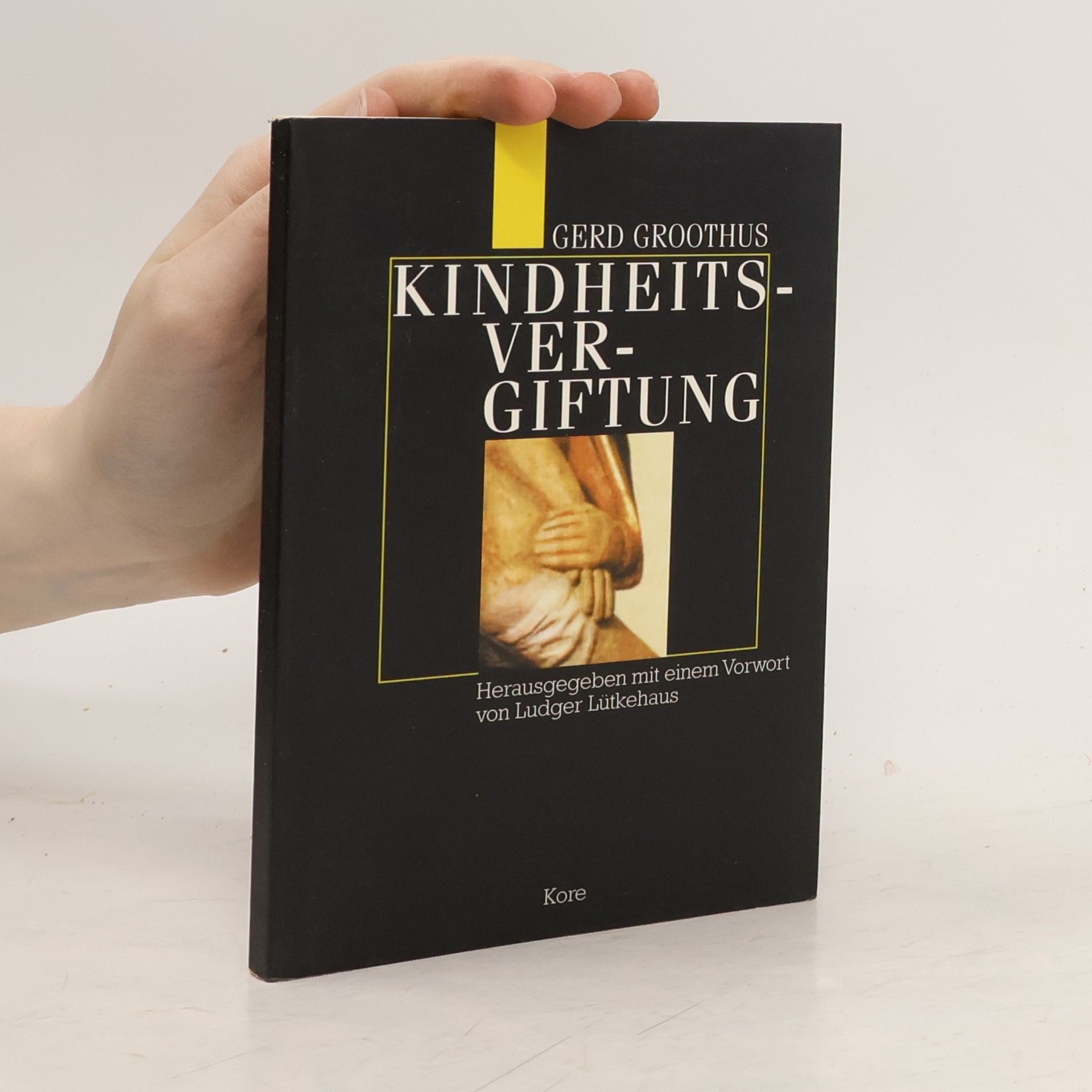
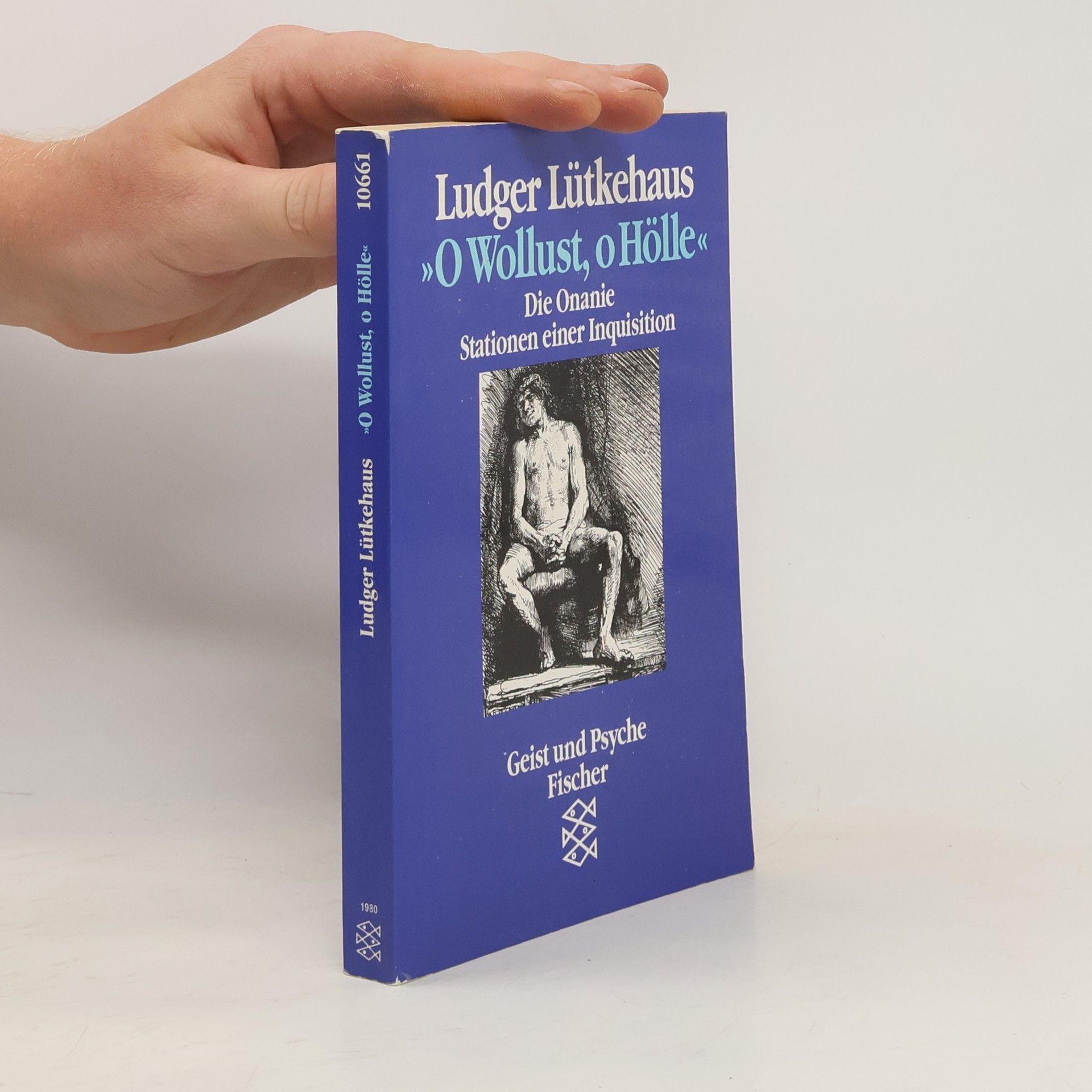

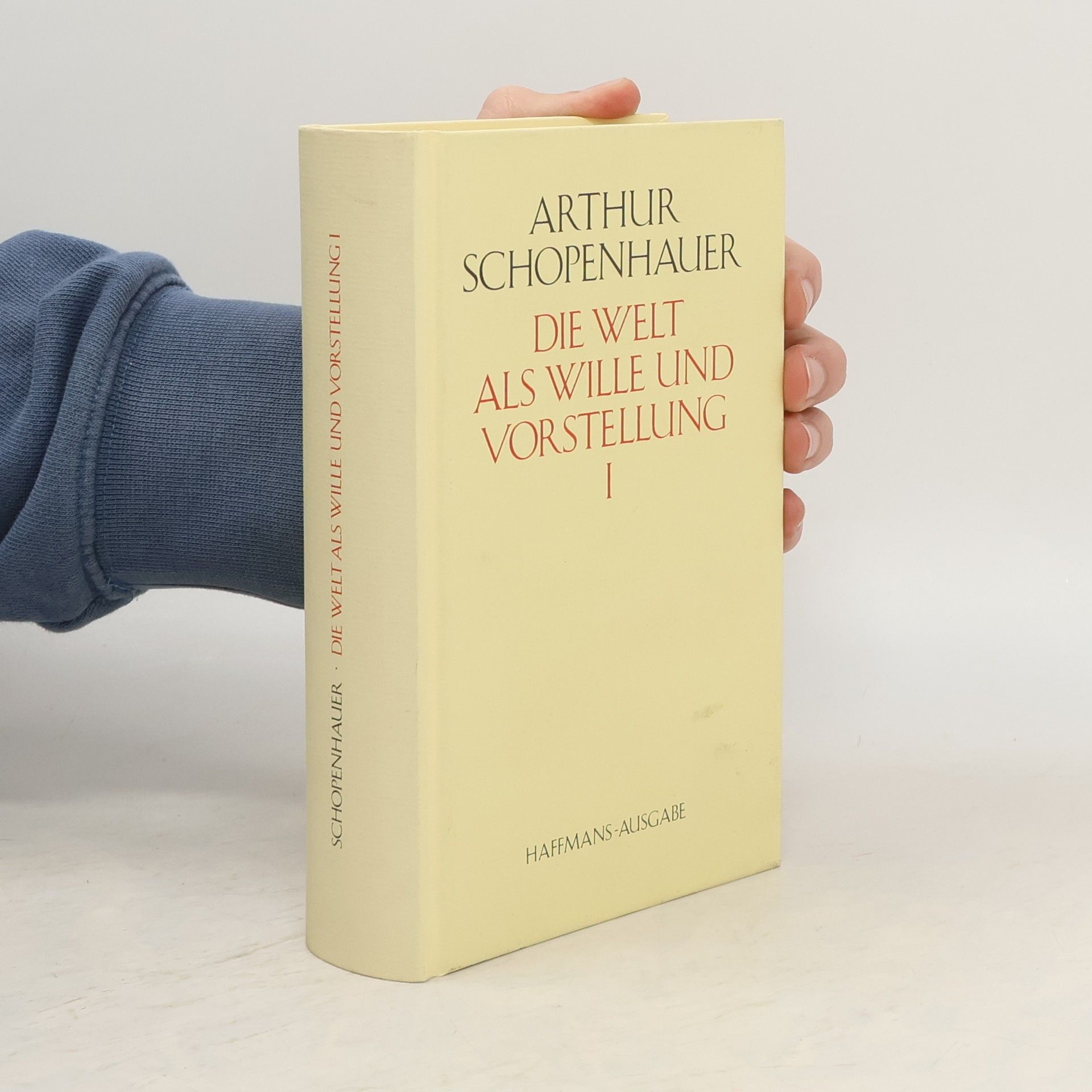
Kann man mehr als 750 Seiten über das „Nichts“ schreiben? Und lässt sich das lesen? Auf beide Fragen ein klares Ja. Denn der Philosophie-Dozent und Herausgeber der Schopenhauer-Werke letzter Hand, Ludger Lütkehaus, hat hier alle Register seines Könnens und Wissens gezogen und nicht nur ein Standardwerk über den philosophischen Nihilismus geschaffen, sondern zugleich ein lesenswertes Buch über die europäische Geistesgeschichte der Moderne.
Der Autor erzählt von einer Kindheit in einem streng katholischen Umfeld, geprägt von Angst und Scham. Dabei entpuppen sich die Familienmitglieder gleichzeitig als Täter und Opfer eines religiösen Wahnsystems. Und die Leser werden in dieses Knäuel von schuldhaft erlebter Sexualität und gewaltsamer Religiosität hineingezogen, ohne sich entziehen zu können.Die Ketzereien reflektieren in aphoristischer Form das Gottesbild, welches dieser Form gelebter Religion zugrundliegt und vervollständigen auf diese Weise das satirisch-ketzerische Psychogramm einer gottgefälligen Familie.
Mythos Medea
- 334 Seiten
- 12 Lesestunden
Verführerisch, sündig, ruchlos und grausam! Medea, die aus Rache, Enttäuschung und Eifersucht zur Mörderin wird, gehört zu den faszinierendsten Figuren der griechischen Mythologie. Die ambivalente Frauengestalt, die liebt und mordet, kämpft und zaubert, hat die großen Autoren und Philosophen von der Antike bis in die Gegenwart zu zahlreichen Interpretationen und literarischen Bearbeitungen angeregt. Die wichtigsten Texte sind in diesem Band versammelt.
Alexander, größter aller Großkönige und jüngster der Götter, begegnet während seines Indien-Feldzuges einem Kalanos, der völlig besitzlos seine Tage mit Nichtstun verbringrt: Der Feldherr gekleidet in prächtiger Rüstung, der andere nackt, ungewaschen, in der Sonne liegend, die Grüße des Größten nicht erwidernd - es wird geschwiegen und das lange. Bis es aus Kalanos herausbricht: »Warum er, Alexander, die ganze Reise nach Indien gemacht habe? Mehr als satt könne er sich auch hier nicht essen. Und mehr Erde, als darauf zu stehen, zu sitzen oder am Ende zu liegen, habe er auch nicht.« Und doch gesellt sich Kalanos zu Alexanders Tross, werden die Herren Freunde. Außerdem treten auf: Der Todesprediger Hegesias, der als weiser König Midas und der trunksüchtige Waldgott Silen als Duo Infernale; Gott selbst in Teufelsbekleidung und Krates und Hipparchia in ungewöhnlichem Liebesakt. Ludger Lütkehaus nutzt seinen historischen Rahmen, um - en passant und hintergründig - ungezwungen große Angelenheiten des Lebens zu verhandeln; Existenzielles, Unausweichliches wie Geburt und Tod, Liebe und Hoffnung und all das Dazwischen. Wie wir durchs Leben gehen wollen, mit welcher Haltung wir ihm begegnen können und möchten.
Vom Anfang und vom Ende
- 92 Seiten
- 4 Lesestunden
Auf literarische, philosophisch verspielte, erhellende Weise stiftet der Autor mit seinen beiden Essays Vom Anfang und vom Anfangen und Vom Enden und vom Ende zur Gelassenheit an. Was wir heute unter „Lebenskunst“ verstehen, bezieht sich vor allem auf die Gestaltung des Lebens und findet seine Quellen in der antiken Philosophie. In den Ratgebern wird Philosophie ein Mittel zur Beförderung des Wohlergehens, zur Gestaltung des „guten“ Lebens. Voraussetzung dieser abendländischen Philosophie ist der Glaube, daß das Leben ein Geschenk sei und die Welt, in die wir geboren werden, ein Licht. Ist der Gegenstand von Lebenskunst das Leben selbst, stellt sich die Hamletfrage. Die Frage nach dem Nichtsein, dem „Nichts“ beschäftigt von der Antike bis heute Philosophen, Dichter und Schriftsteller. Mit ihnen als Zeugen (von Sokrates, Lichtenberg, Schopenhauer bis Beckett, Hannah Arendt und Peter Sloterdijk) gewährt Lütkehaus der Nachtseite des Lebens Raum. „Gerade wenn die tatsächliche Verfassung der Welt nur wenig auf ein Licht, noch weniger die des Lebens auf ein Geschenk hindeutet, versucht der inkarnierte Wille zum Dasein und Wohlsein sich um so entschlossener in der Welt, dem Sein als dem Guten heimisch zu machen.“