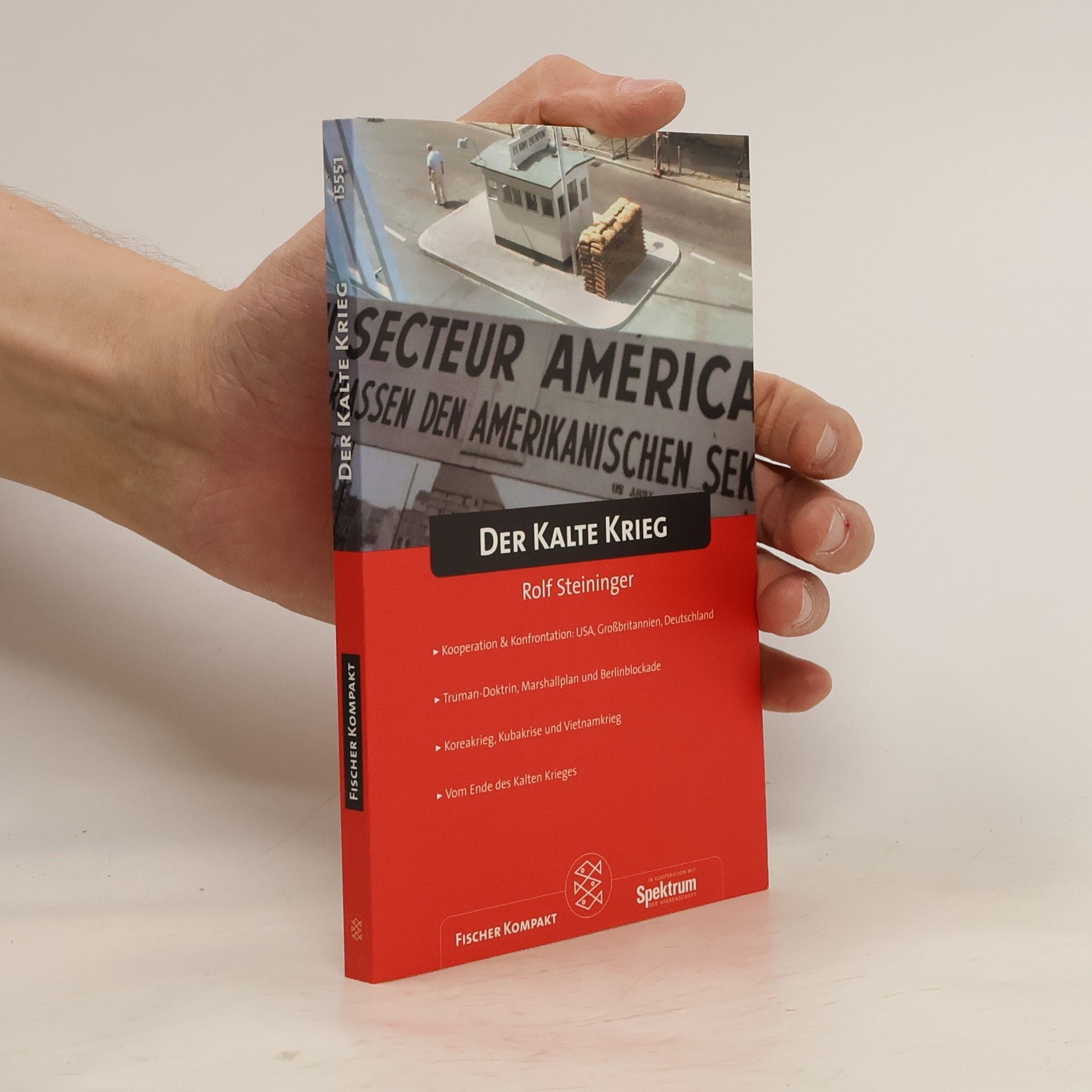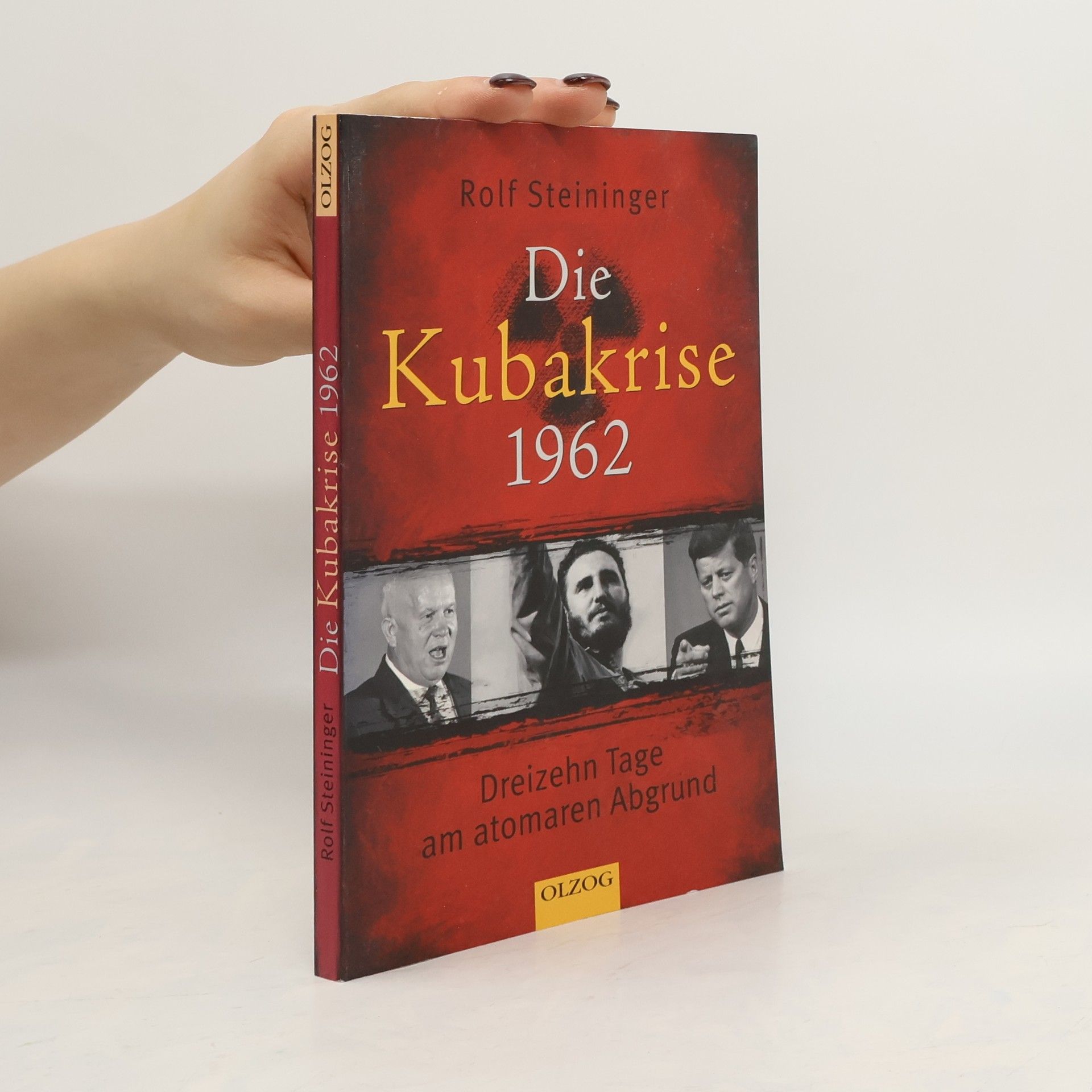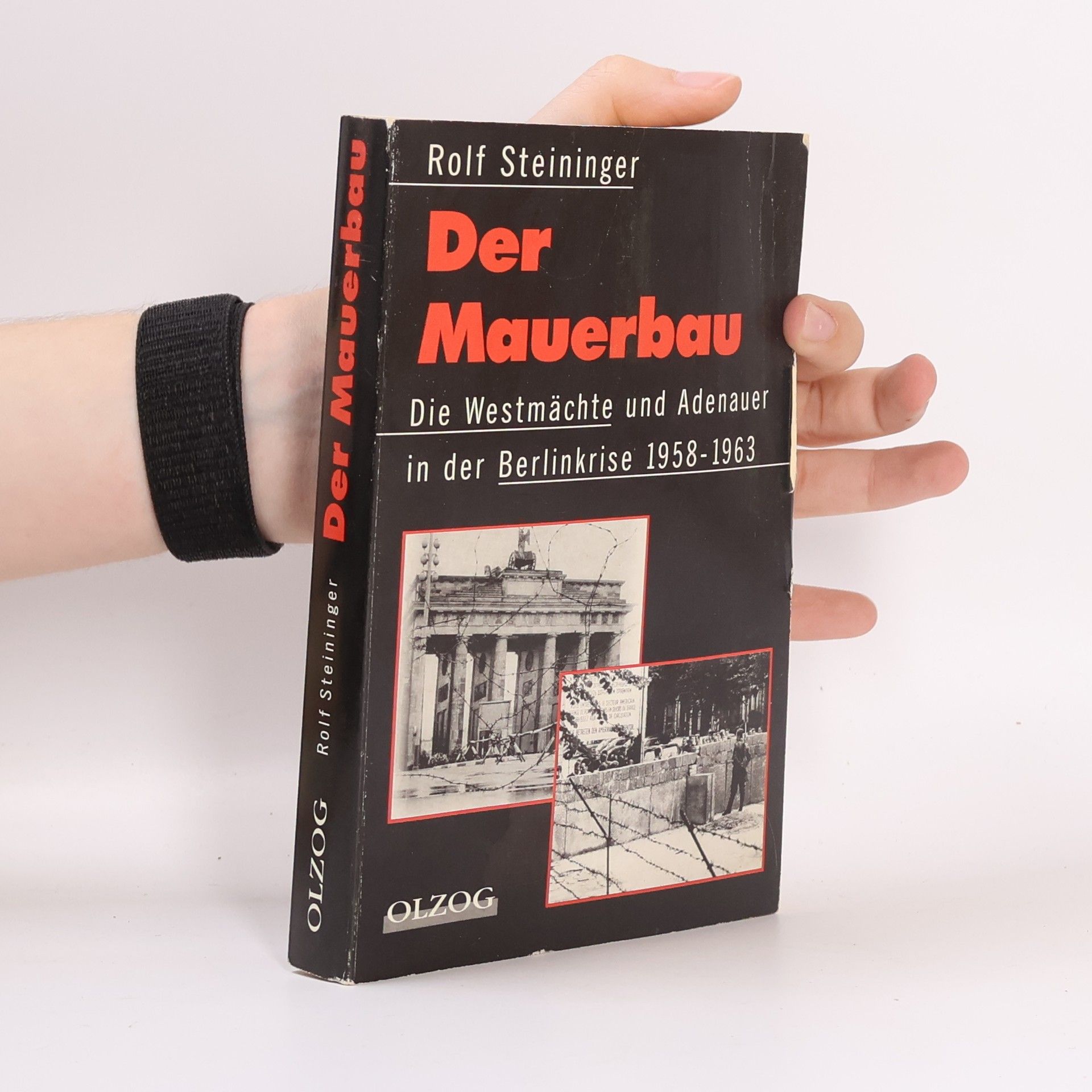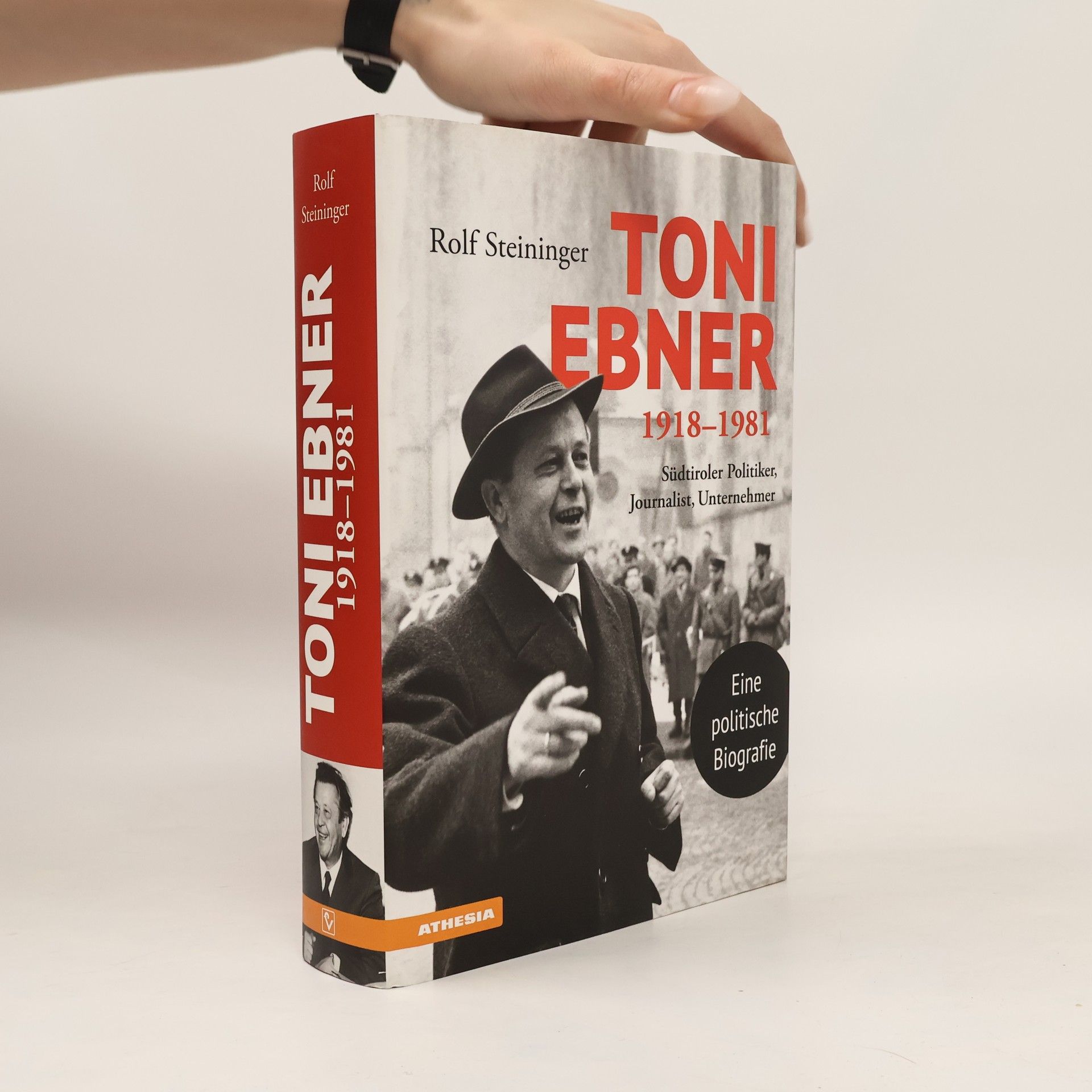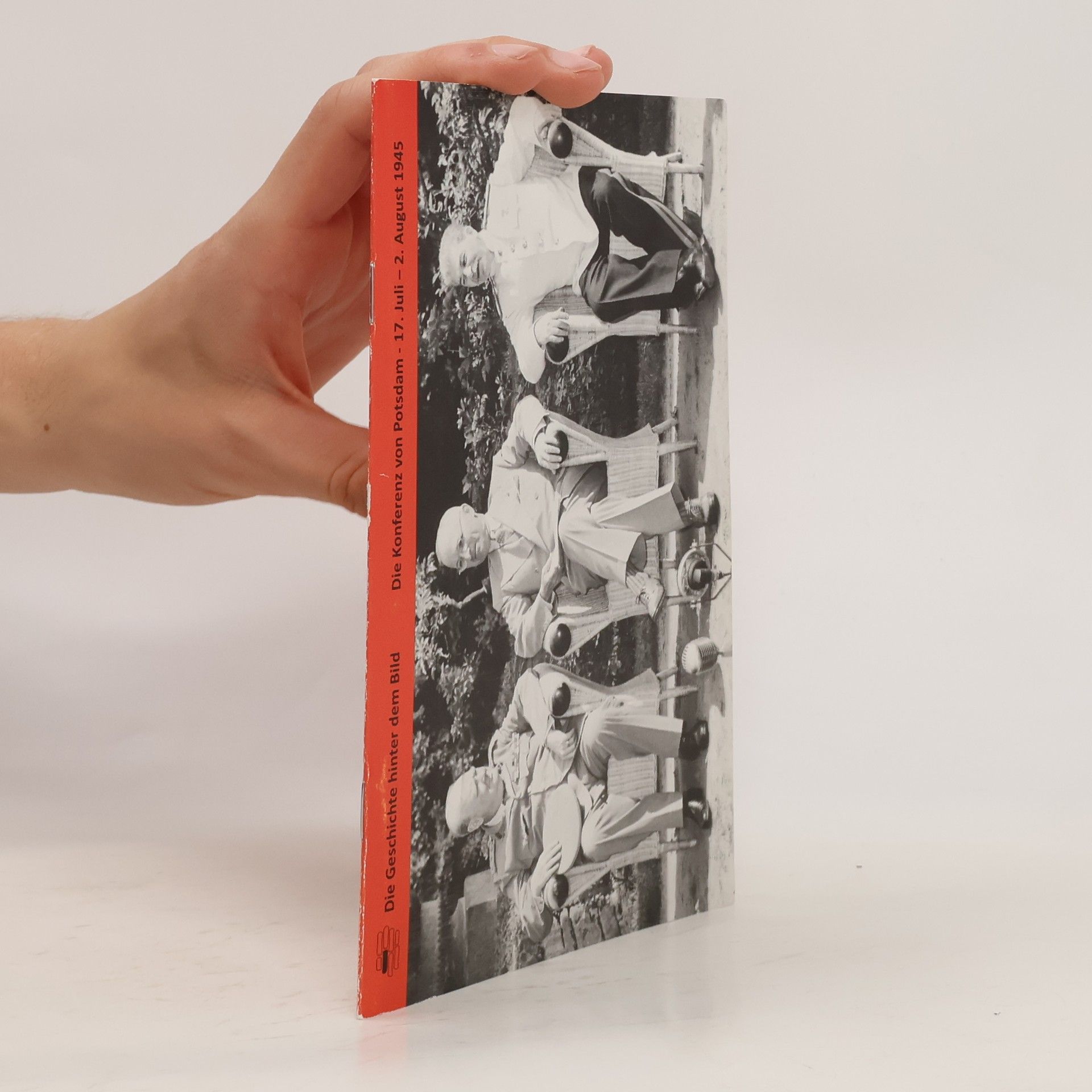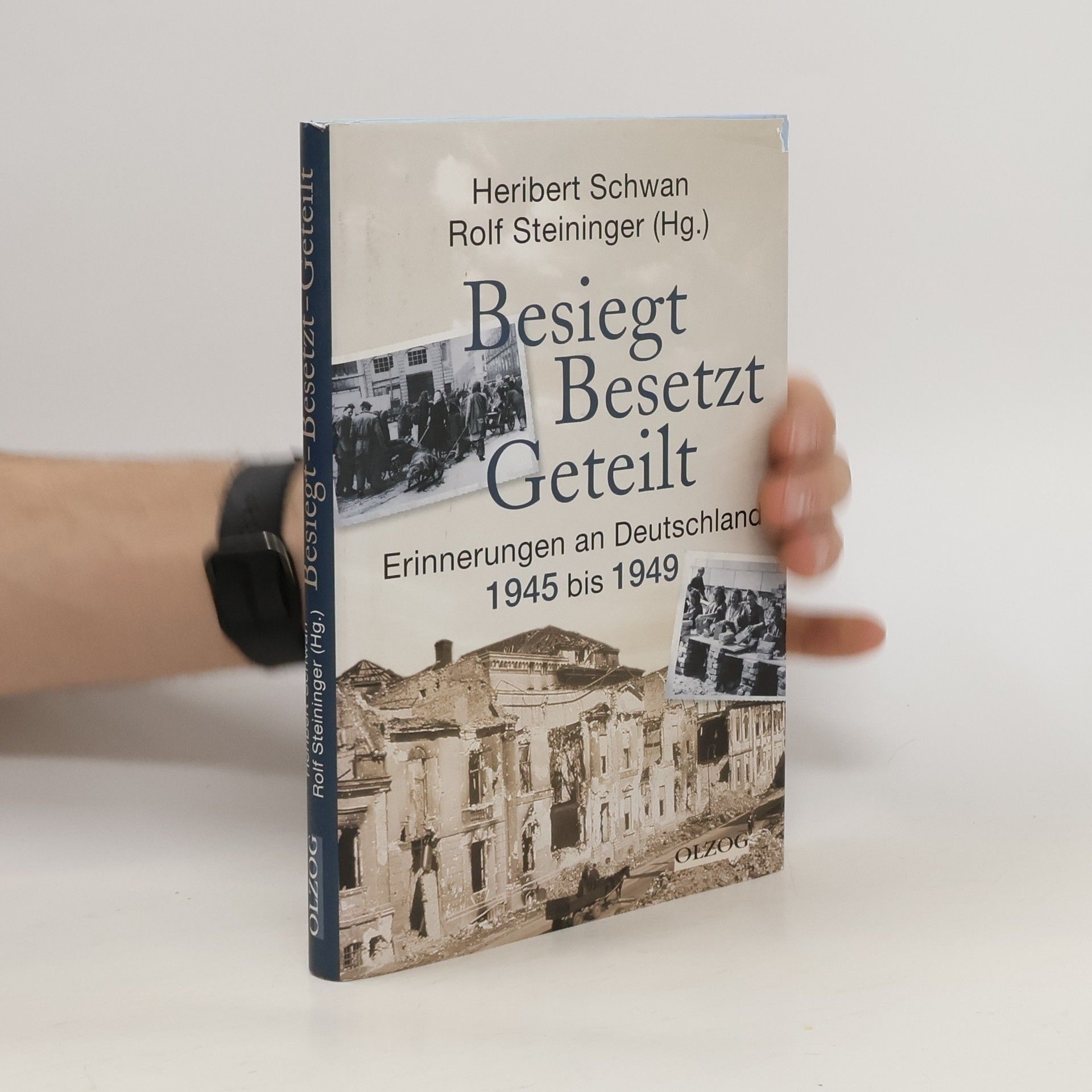Kein Frieden im Nahen Osten
Die Geschichte Israels von Theodor Herzls Judenstaat 1896 bis zur Gegenwart
- 166 Seiten
- 6 Lesestunden
Die chronologische Erzählweise in Rolf Steiningers "Geschichte Israels" wird durch die Einbeziehung historischer Berichte deutscher Generalkonsuln und österreichischer Botschafter bereichert, die neue Perspektiven auf die Ereignisse bieten. Der Fokus liegt auf den Konflikten zwischen Arabern und Juden, der Entwicklung diplomatischer Beziehungen sowie wichtigen historischen Momenten bis 1990, einschließlich der Intifada und der Annexion des Golan. Der Band enthält zudem 41 Fotos und drei Faksimiles, die die Darstellung der komplexen Geschichte Israels visuell unterstützen.