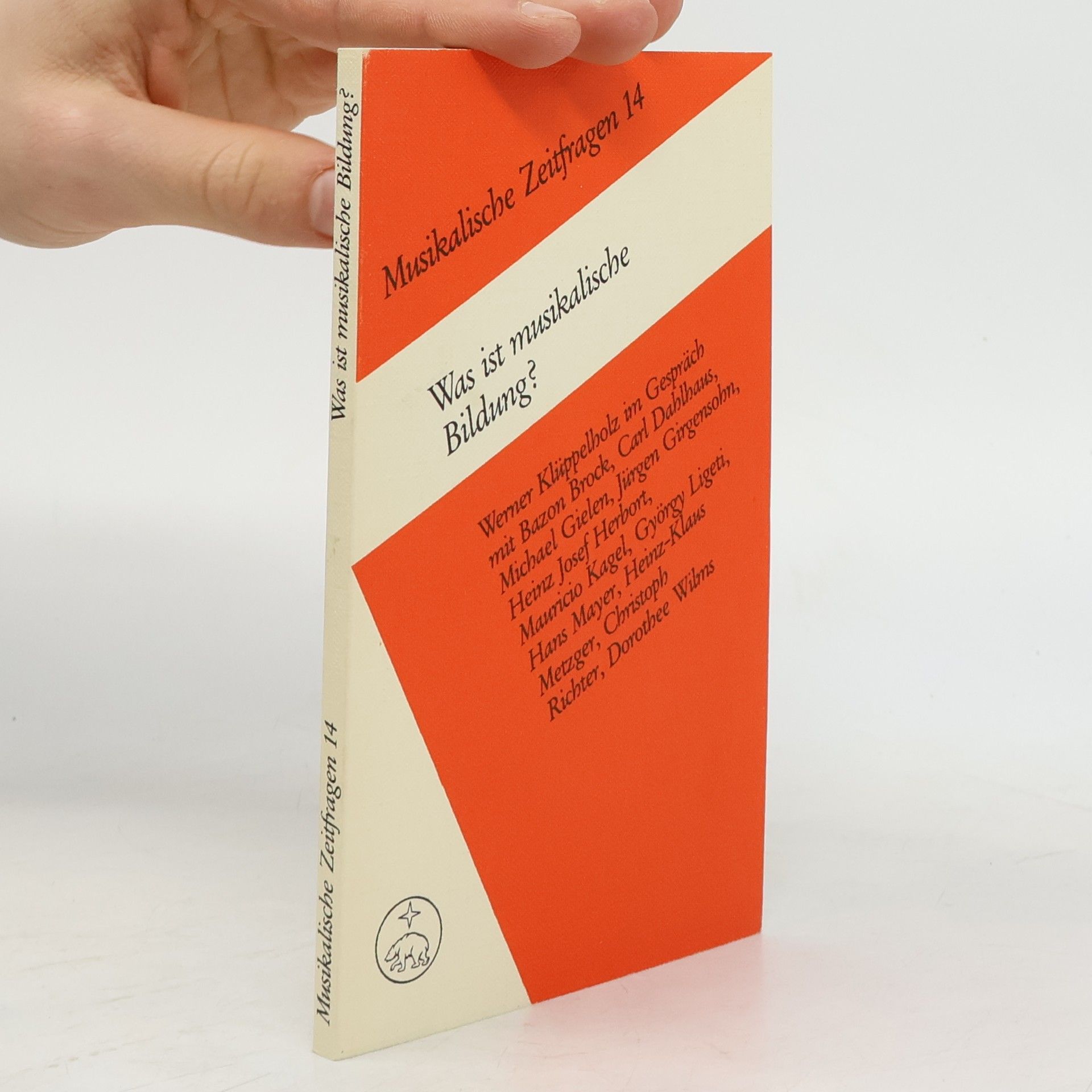Gebäude und Räume ähneln Instrumenten: Architektonische Körper sowie deren Material, Oberflächen und Anordnungen erzeugen Resonanzen und wirken so sensorisch auf den Menschen. Diese Vorstellung von Architekturen als Klangkörper wurde im Zeichen einer rein funktionalistischen Architektur sowie eines Historismus der Proportionen bisher zumeist vernachlässigt. Ausgehend von Kunstinstallationen ab der Mitte des 20. Jahrhunderts, die sich vermehrt mit Phänomenen der Klangkunst und der sinnlichen Wahrnehmung befassen, wird hier eine Architekturgeschichte der Resonanzwirkungen entwickelt, die auf das einzelne Haus und dessen Monofonie ebenso eingeht wie auf die Polyfonie des Stadtraums. Architektur und Resonanz stellt die Frage nach „guter Architektur“ für unsere Zeit neu im Hinblick auf akustische und multisensorische Experimente und Theorien der Moderne und zeigt Planungsansätze auf, bei denen wieder eine ganzheitliche Ansprache aller menschlichen Sinne im Zentrum steht.
Christoph Metzger Bücher


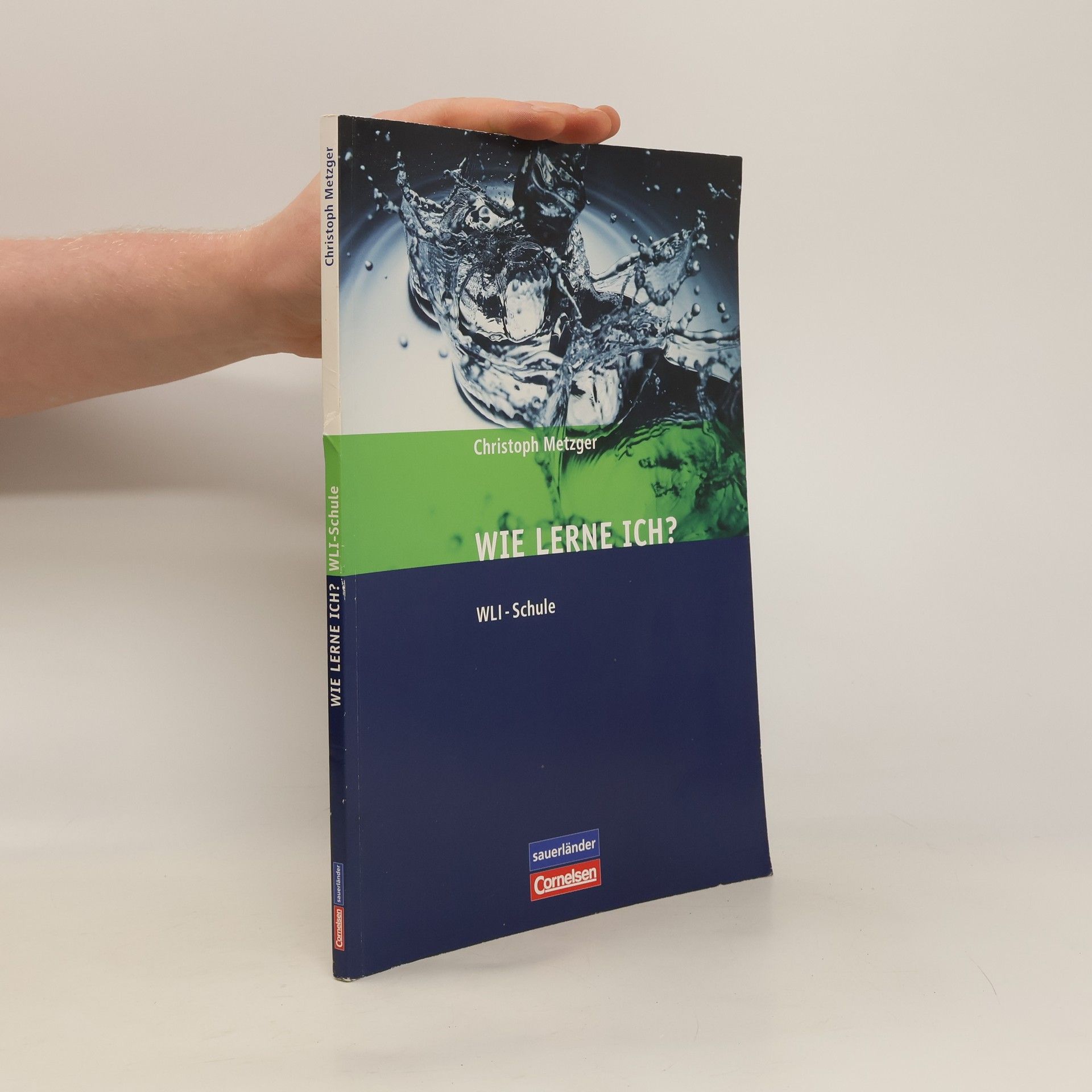
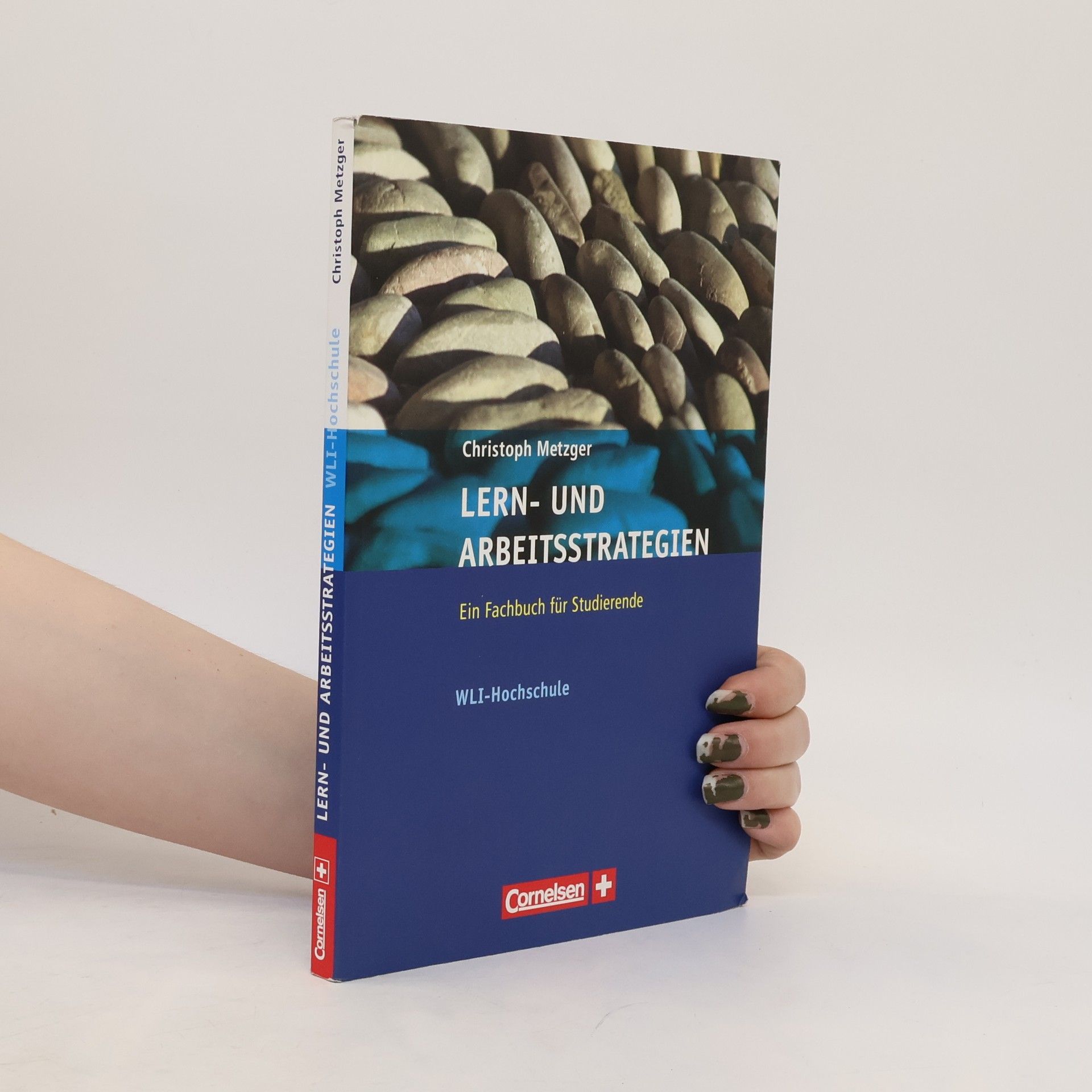
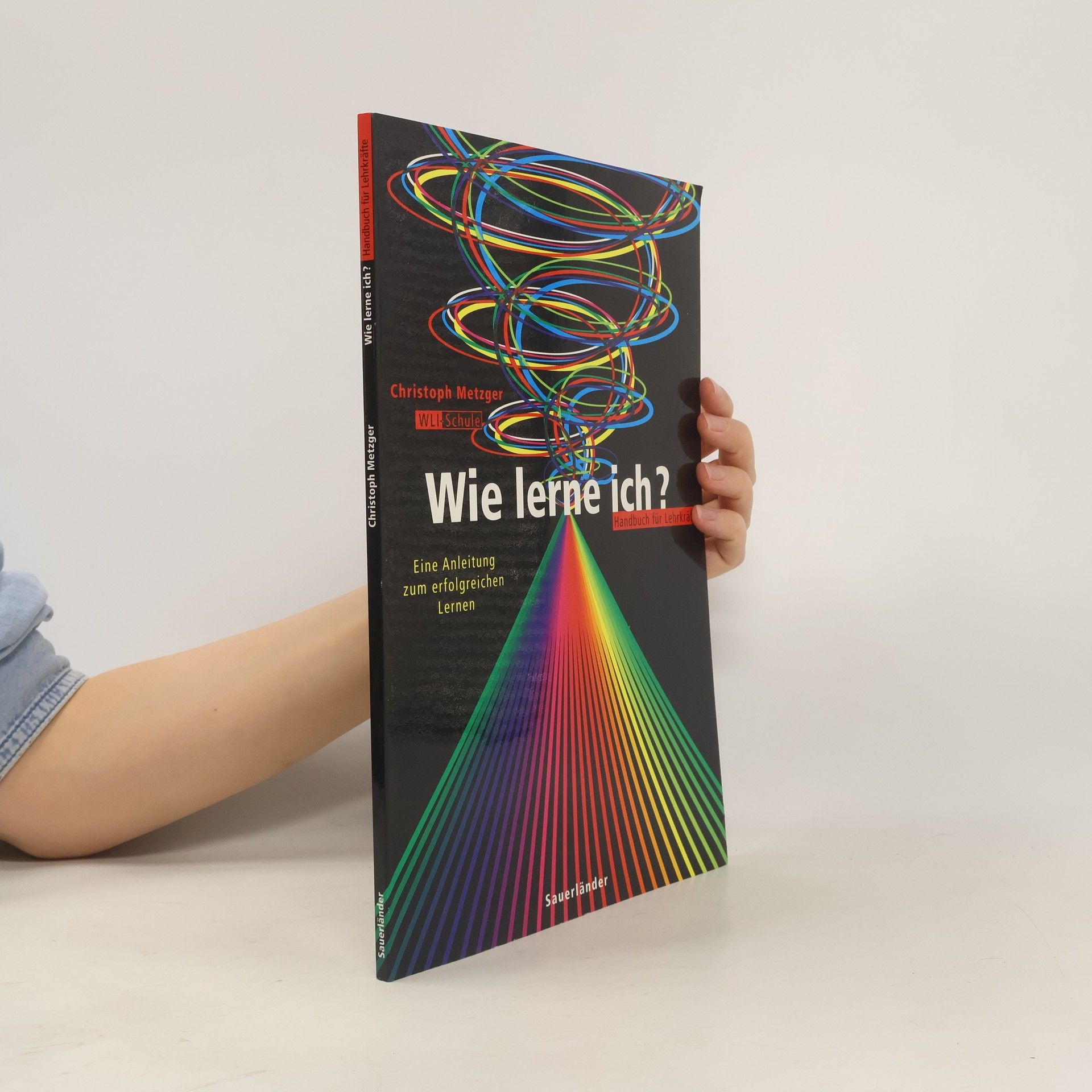

Wie lerne ich? WLI Schule
Eine Anleitung zum erfolgreichen Lernen mit eingelegtem Fragebogen
- 184 Seiten
- 7 Lesestunden
Christoph Metzger gibt in seinem Buch einen chronologischen Überblick über die Geschichte der Abstraktion: von ihren Anfängen bei Paul Cézanne, Claude Monet, Wassily Kandinsky und Piet Mondrian über ihre musikalische Weiterentwicklung in den Kompositionen von Anton Webern, John Cage und Morton Feldman bis zu ihrer Wiederentdeckung bei Jackson Pollock, Willem de Kooning, Cy Twombly oder Gerhard Richter.Wissenschaftsgeschichtlich speist sich die Theorie der Abstraktion aus Erkenntnissen der Gestalttheorie, die Phänomenen der Mustererkennung verpflichtet ist. Die Konditionierungen der Menschen ändern sich im Lauf des Lebens und spiegeln sich in ästhetischen Erfahrungen wider, die Abstraktion und Mustererkennung zur bedeutenden kognitiven Leistung menschlicher Existenz machen
Whiteheads Gott, der „Leidensgefährte, der versteht“ und der „Poet der Welt“, teilt das Schicksal der Welt, kann sie aber nur mittels Lockung beeinflussen. Es ist an der Zeit zu versuchen, einmal umgekehrt diesen Leidensgefährten zu verstehen, die Tragik dieses Poeten zu ergründen kraft der Poesie. Gott will für alle Kreaturen das Beste, kann das aber aufgrund der „natürlichen Ordnung der Dinge“ nie erreichen: Denn nur allzu oft geraten ethische oder ästhetische Werte in Konflikt, und es lässt sich von zwei gleich hohen Idealen höchstens eines verwirklichen. Das ist, in aller Kürze, Whiteheads Auffassung von Tragik, die freilich im Kontext der Theodizeefrage steht, und hier schließlich in eine „theopoetische Defensio“ münden wird.
Lern- und Arbeitsstrategien
WLI-Hochschule: Ein Fachbuch für Studierende an Universitäten und Fachhochschulen (mit beigelegtem Fragebogen)
- 180 Seiten
- 7 Lesestunden
Mit dem Fragebogen können Studierende ihre Lernstrategien selbst analysieren und finden u.a. Angaben über Motivation, Zeitplanung, Angst, Informationsverarbeitung und Prüfungsstrategien. Der erste Teil des Buches dient dazu, aufgrund des ermittelten Lernstrategienprofils, das Lernen zu verbessern. Im zweiten Teil finden Sie ein umfassendes Kapitel, das dem Verfassen schriftlicher Arbeiten gewidmet ist. Das Kapitel "Überzeugend präsentieren" gibt nützliche Tipps für die mündliche Präsentation.
Musikalische Zeitfragen - 14: Was ist musikalische Bildung?
Werner Klüppelholz im Gespräch mit Bazon Brock, Carl Dahlhaus, Michael Gielen, Jürgen Girgensohn, Heinz Josef Herbort, Mauricio Kagel, György Ligeti, Hans Mayer, Heinz-Klaus Metzger, Christoph Richter, Dorothee Wilms
- 115 Seiten
- 5 Lesestunden
Neuroarchitecture
- 223 Seiten
- 8 Lesestunden
Architectural spaces are anchors for our memory. We find our place in the room by means of our sensory perception; the brain makes use of surfaces and spatial systems in order to store and organize the world we live in. The understanding of this principle forms the basis for the transfer of the results of recent neuroscientific research to architectural practice, as discussed in this book. Neuroarchitecture links neuroscience, perception theory, and Gestalt psychology, as well as music, art, and architecture, into a holistic approach that focuses on the laws of structure formation and the movement of the individual within the architectural space. Christoph Metzger, the author of Building for Dementia and Architecture and Resonance, analyses buildings designed by Alvar Aalto, Sou Fujimoto, Hugo Häring, Philip Johnson, Hermann Muthesius, Juhani Pallasmaa, James Stirling, Frank Lloyd Wright, and Peter Zumthor in the context of the Amsterdam School of Architecture and their criticism of functionalism in order to develop bases and criteria for a modern, people-related architecture that is indebted to neuroscientific knowledge.
Building for dementia
- 160 Seiten
- 6 Lesestunden
As a consequence of demographic change, it is increasingly necessary now and in the future for the architectural profession to rethink the design of residential solutions for aging people and especially those with dementia. With advancing age we are increasingly dependent on a spatial environment that not only has a positive effect on us, but also supports our everyday activities and takes age-related restrictions into account. A focal point of the new requirements is multisensory architecture: color and lighting design, sound design, tactile materials and surfaces, and haptically attractive forms, creating a spatial atmosphere in which the resident feels comfortable, providing security and orientation and fostering motor skills and cognitive abilities. Bauen für Demenz (Building for Dementia) has been developed as a guideline for contemporary and dignified architecture that meets the requirements of people with dementia and views them as an integral part of society.