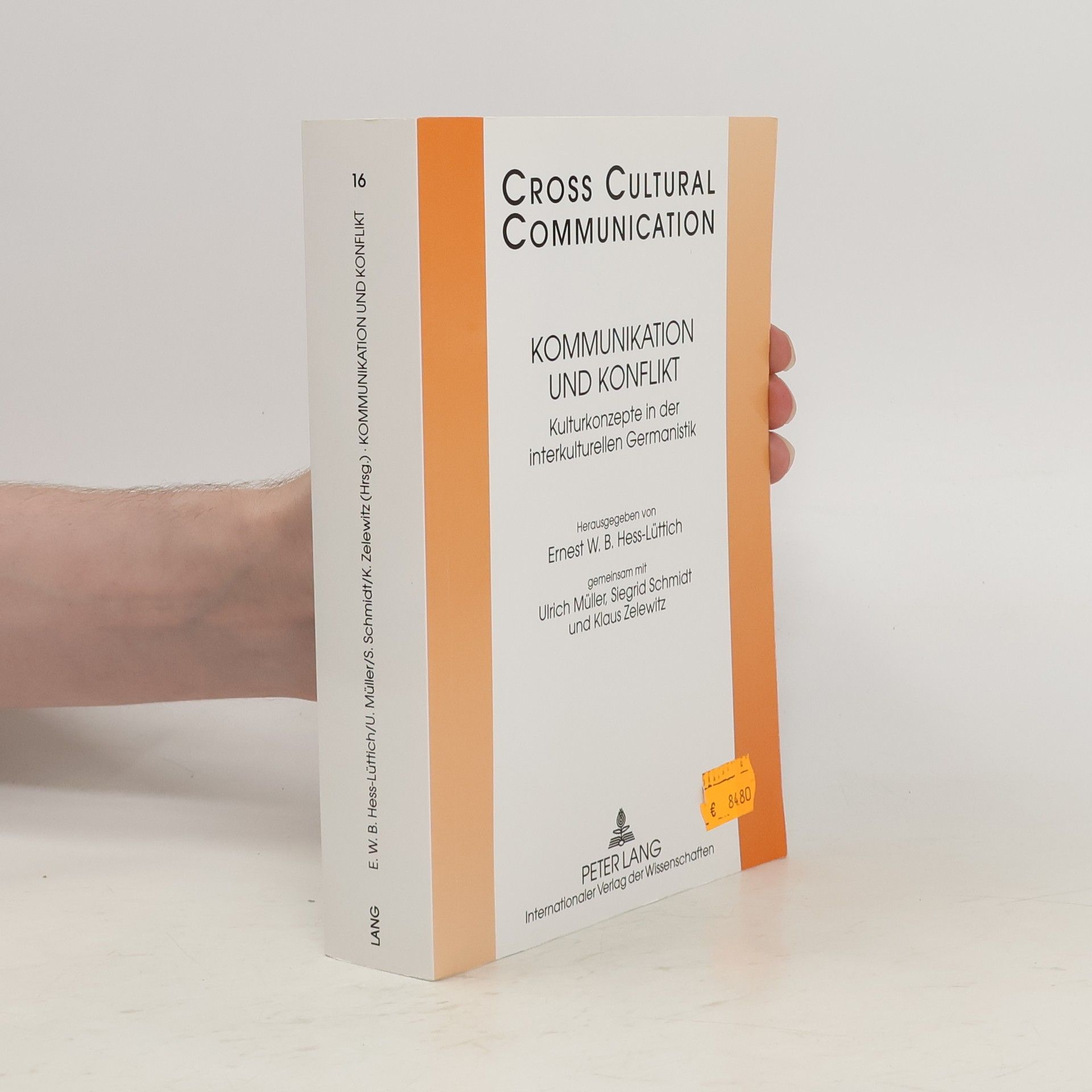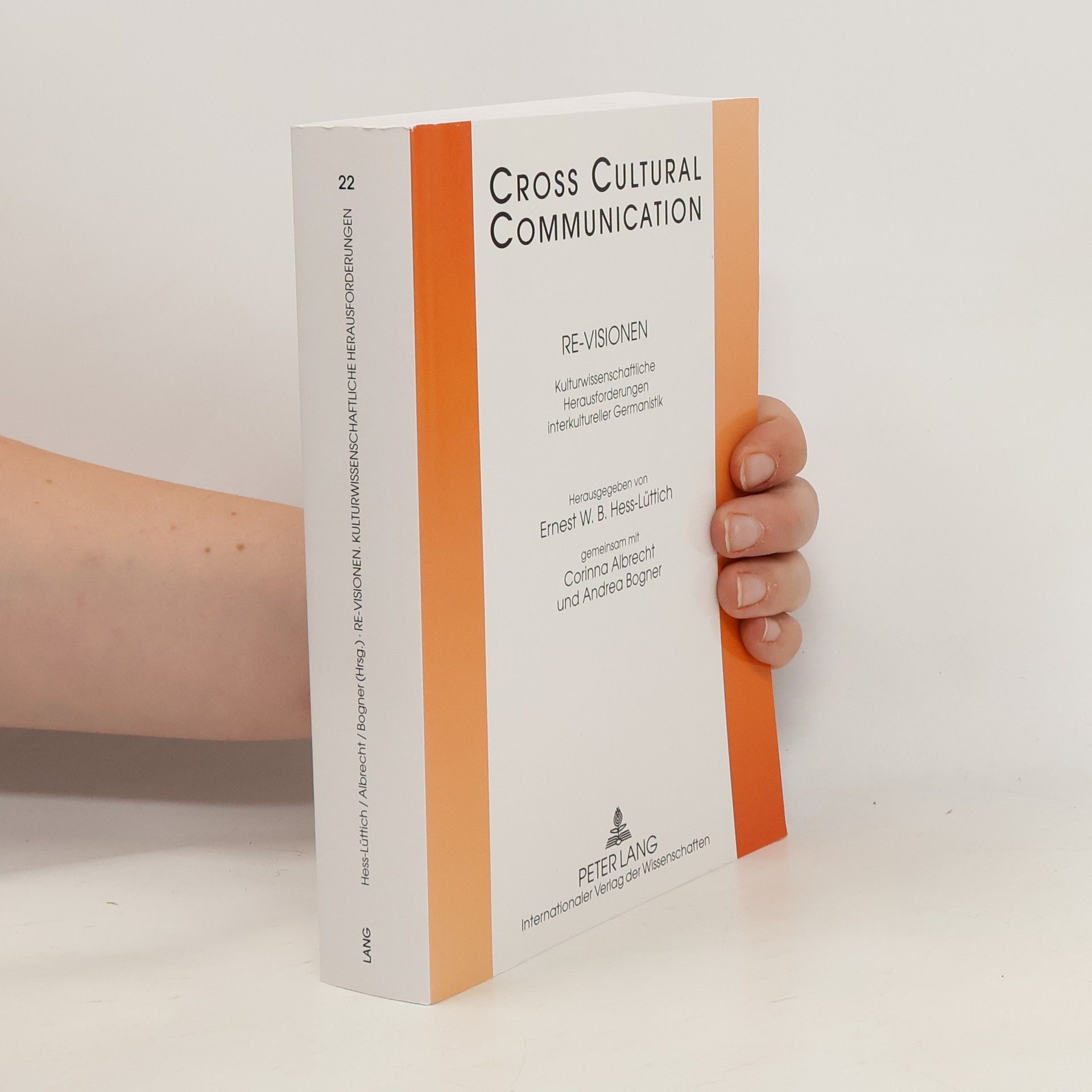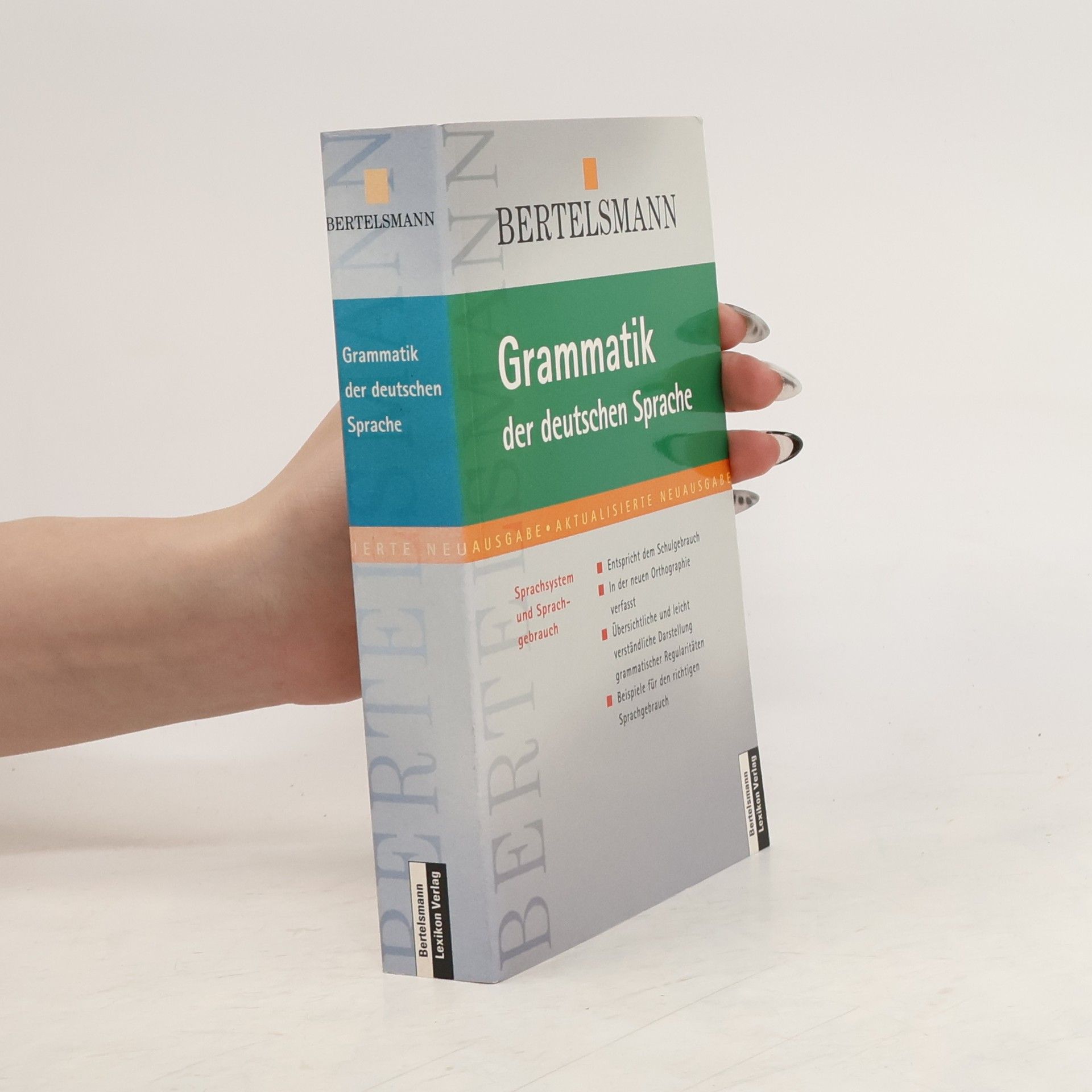Zeichen der Stadt: Berlin lesen
- 138 Seiten
- 5 Lesestunden
Zeichen der Stadt lesen: Am Beispiel von Berliner Quartieren, die im Fokus kontroverser Debatten stehen, diskutiert der Band Ansätze semiotischer, urbanologischer, ökologischer, linguistischer Provenienz als multidisziplinären Zugang zur Lektüre` urbaner Räume als Texte`. Der Band möchte dafür sensibilisieren, die 'Zeichen der Stadt' wahrzunehmen, sie zu 'lesen'. Am Beispiel ausgewählter Quartiere in Berlin, die in jüngster Zeit im Fokus kontroverser Debatten standen, möchte er Antworten suchen auf die Frage: Was sind urbane Diskurse? Diese Frage nach dem 'Wie' urbaner Kommunikation zielt auf deren (sozio)kulturelle Verfasstheit im Schnittfeld von Diskursforschung und Semiotik, Stadtökologie und Stadtsoziologie. Welche Ansätze können in einem interdisziplinären Forschungsdesign zur Anwendung kommen, um die Diskursbedingungen urbanen Wandels zu verbessern? Die einleitend vorgestellten Ansätze semiotischer, urbanologischer, ökologischer, linguistischer Provenienz sollen einen multidisziplinären Zugang für die 'Lektüre' urbaner Räume als 'Texte' bieten. Inhaltsverzeichnis Urbanität Diskursforschung Stadtplanung, -ökologie, -soziologie Raumwissenschaft Ökosemiotik Stadtsprachen Sprachlandschaften