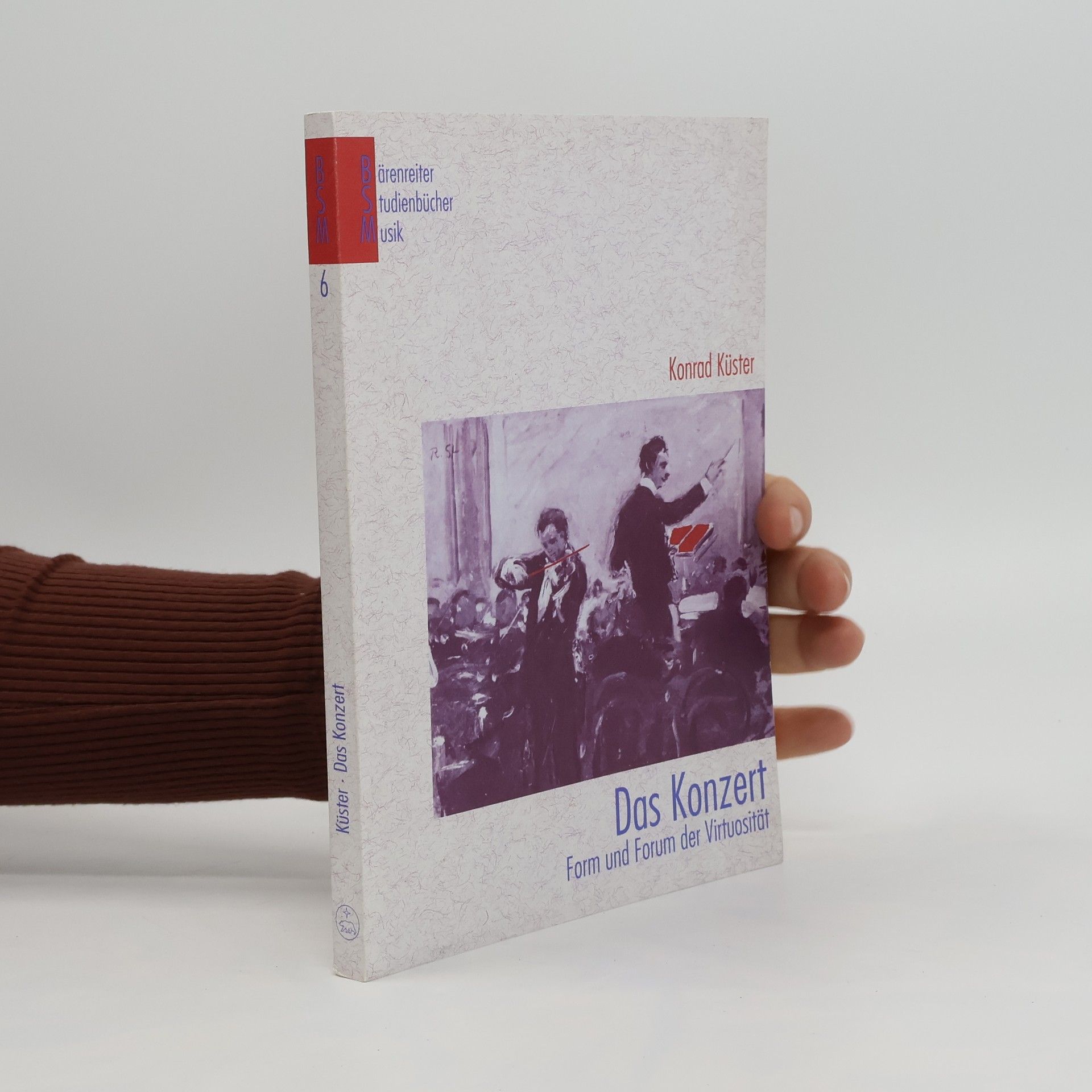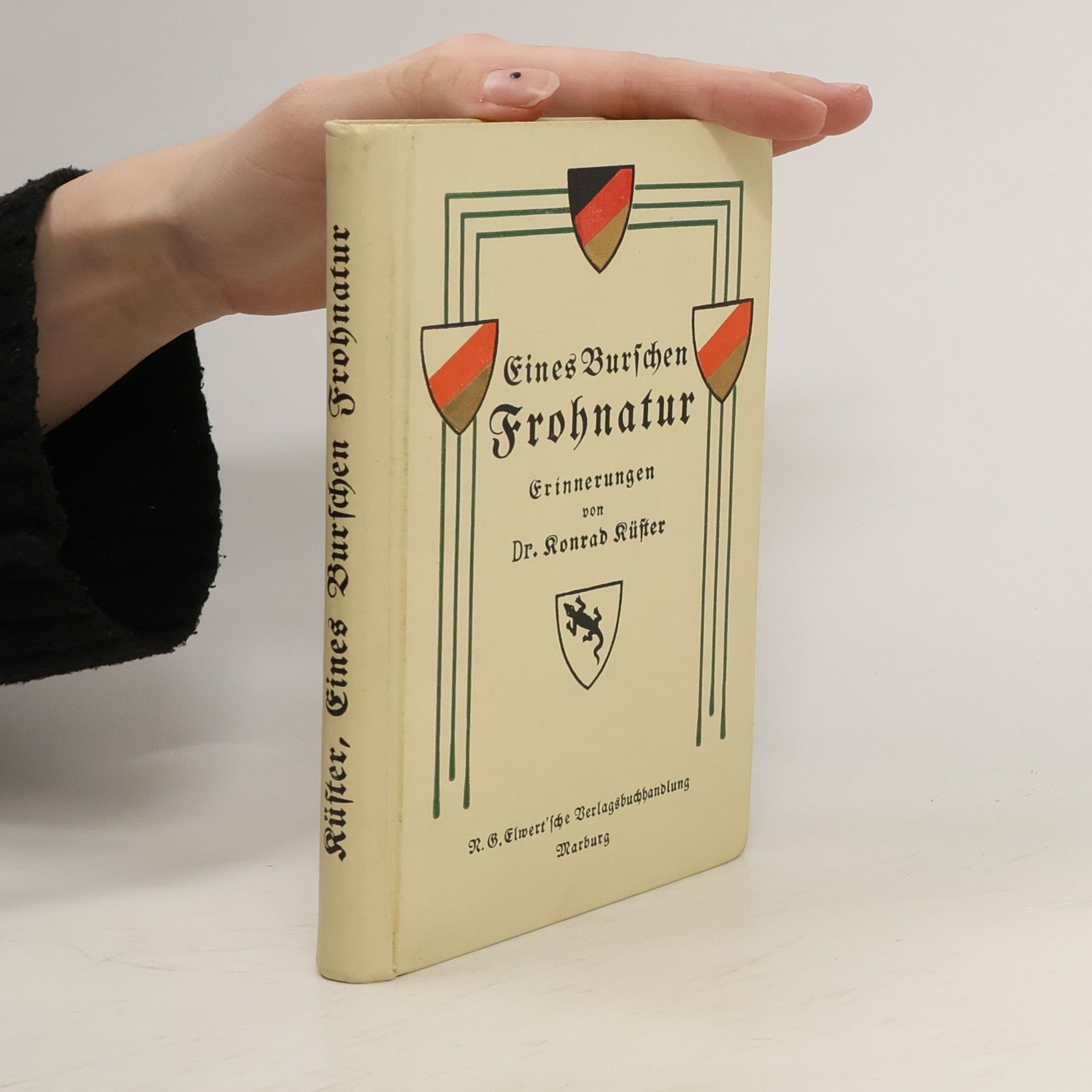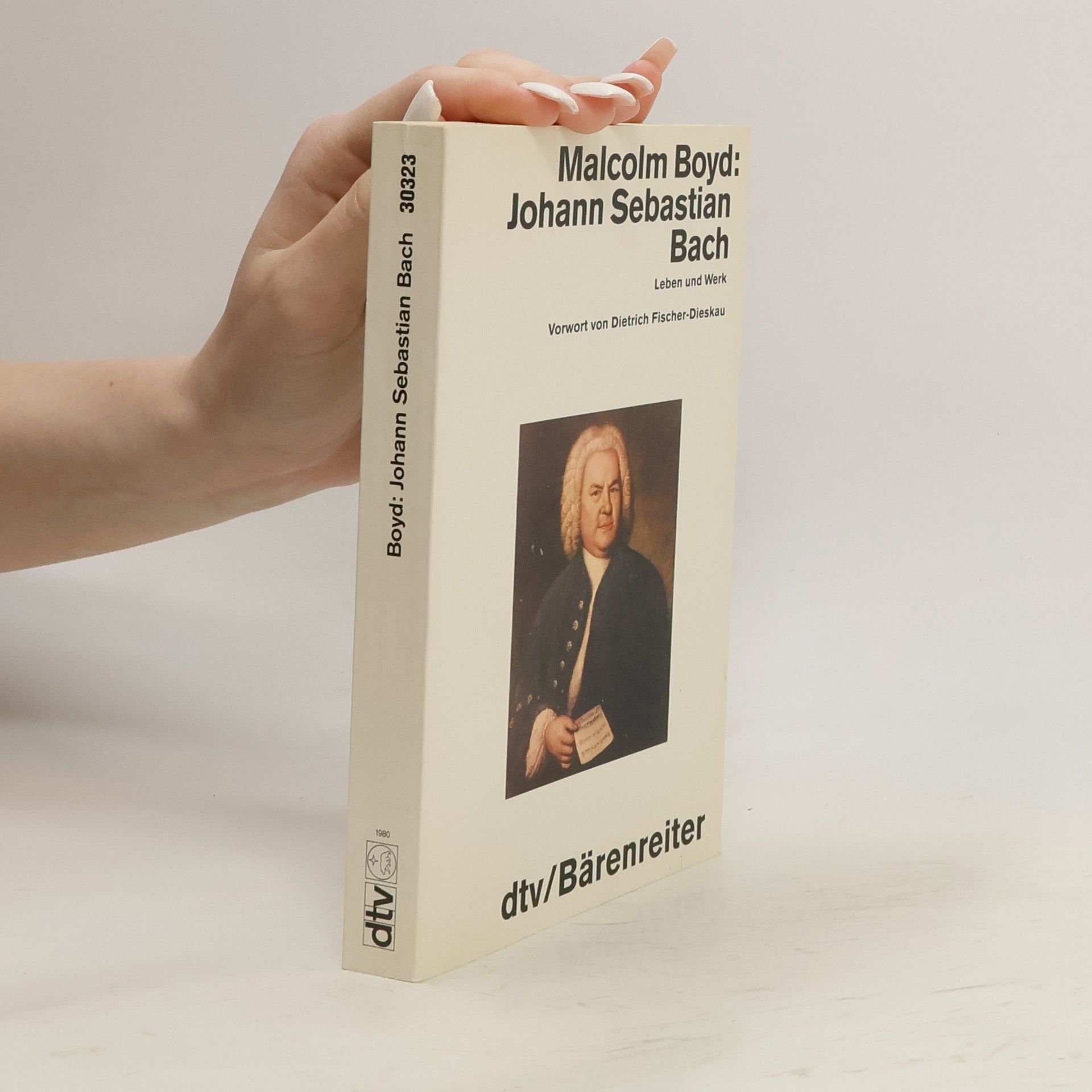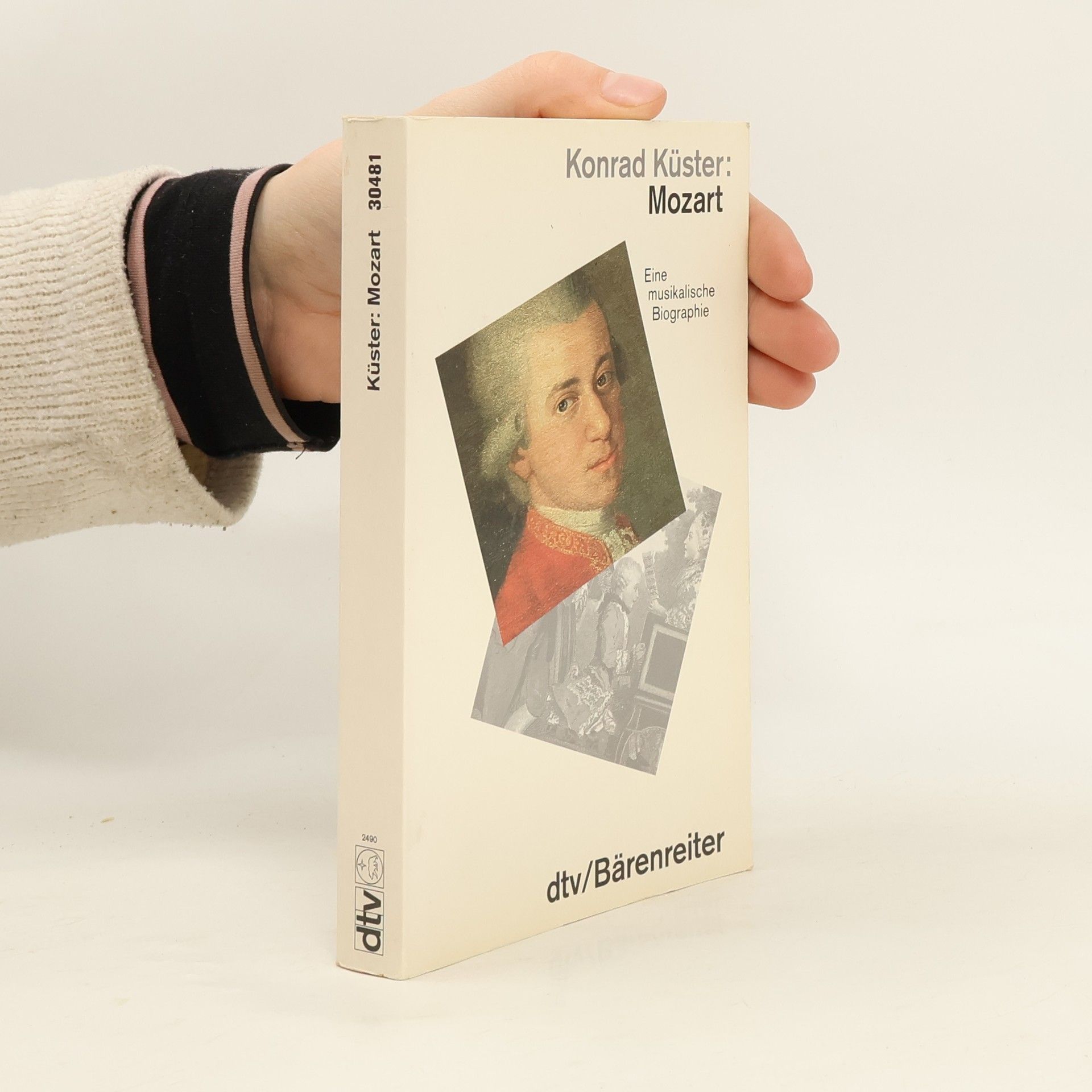Bach-Handbuch
- 987 Seiten
- 35 Lesestunden
Bach fur Musiker, Kenner und Liebhaber. Die Fullen an Fakten und Zusammenhangen aus Leben, Werk und Wirken Bachs werden in diesem Handbuch systematisch und fundiert zusammengefuhrt. Werkubersichten, Notenbeispiele, Literaturhinweise und mehrere Register erleichtern den Zugang. In sich abgeschlossene Kapitel stellen die Charakteristika einer Gattung ebenso vor wie die Entstehungsgeschichte und Kompositionsweise der Einzelwerke. Erstmals werden die mehr als 200 Kantaten in chronologischer Folge dargestellt, die Orgel- und Cembalomusik in ihrer Typenvielfalt neu strukturiert und erklart, die Klavier- und Kammermusik wie auch das Orchesterschaffen und das Spatwerk auf der Basis der neuesten Forschungsergebnisse analysiert. Ein umfassendes Nachschlagewerk und gut verstandliches Lesebuch zugleich.