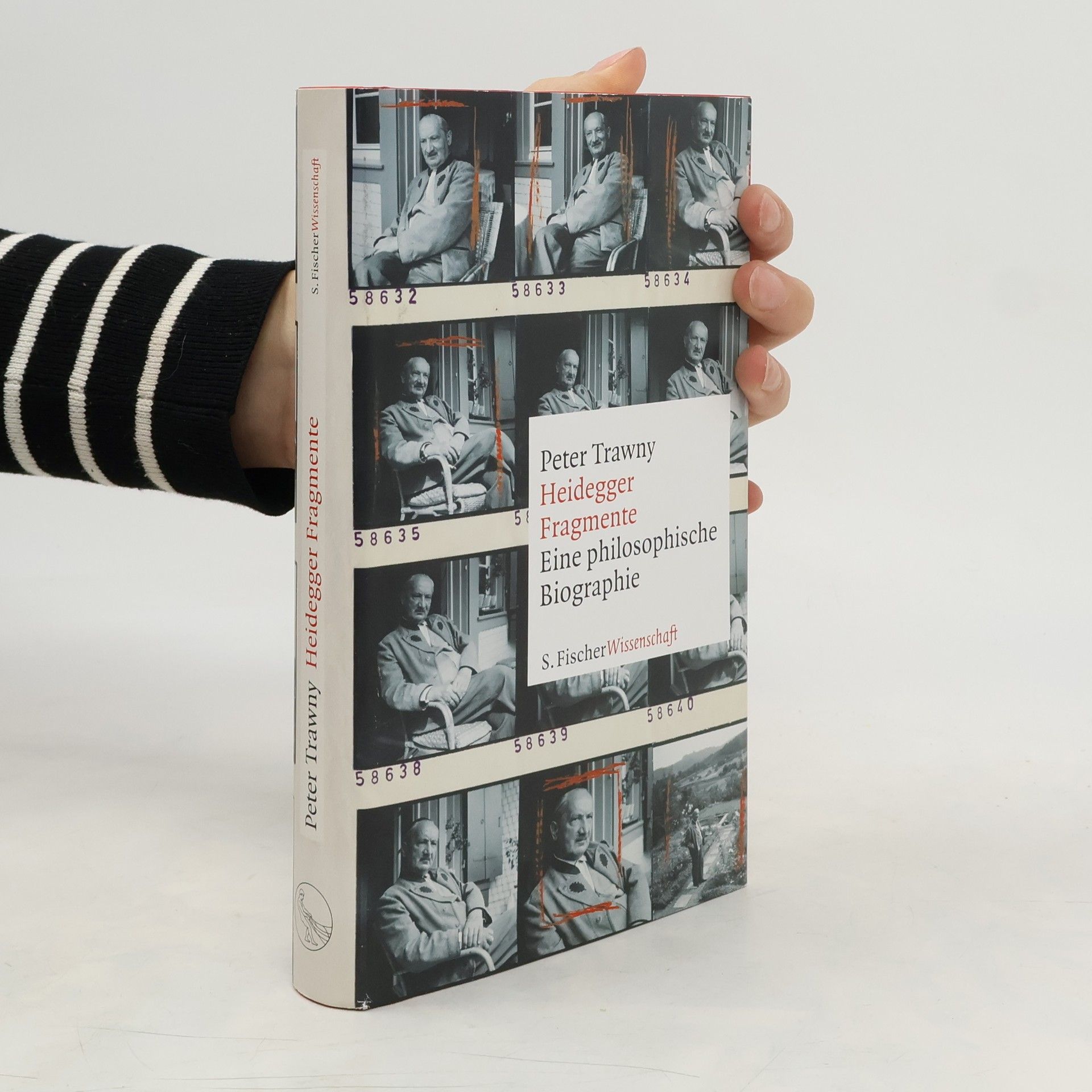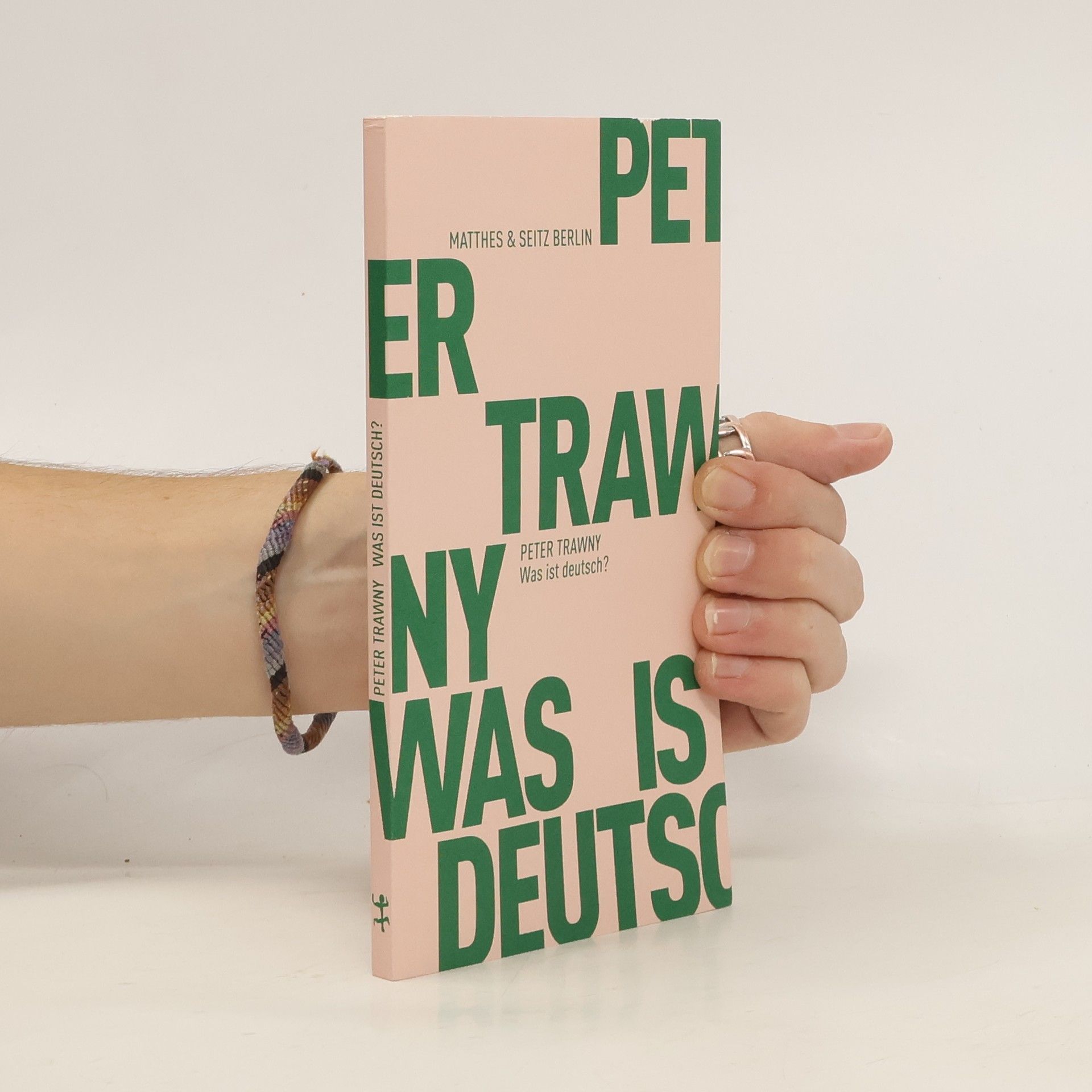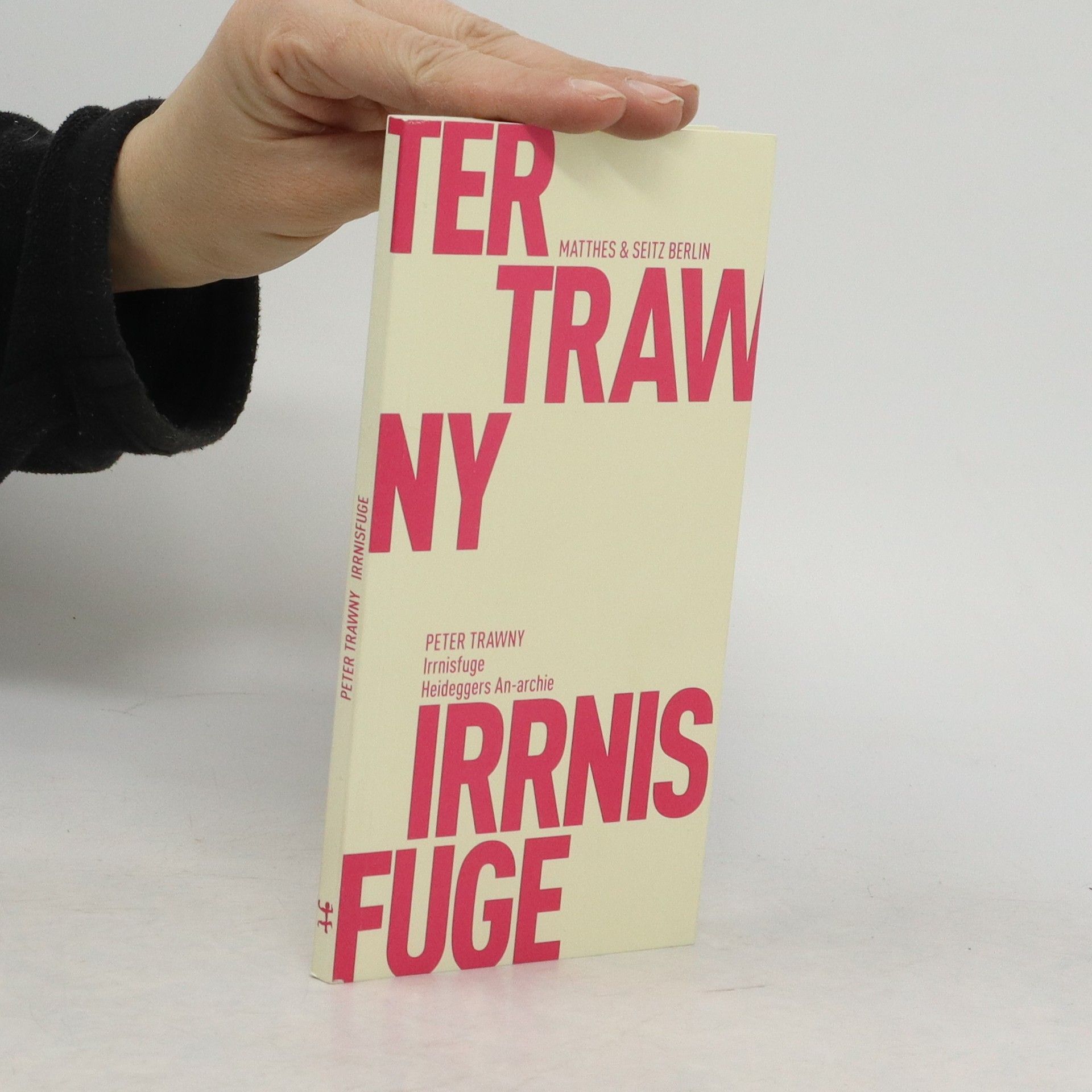Hitler, die Philosophie und der Hass
Anmerkungen zum identitätspolitischen Diskurs
- 172 Seiten
- 7 Lesestunden
Zu glauben, der europäische Diskurs könne den Nationalsozialismus wie ein Objekt auf Distanz halten, ist im besten Fall eine naive Hypothese, im schlimmsten Fall aber ein politischer Fehler. Man tut dann so, als hätte der Nationalsozialismus mit dem Rest von Europa, mit den anderen Philosophen, mit anderen politischen und religiösen Sprachen keinen Kontakt gehabt, betont Jacques Derrida in einem Gespräch mit Didier Eribon. Und doch haben Philosophinnen und Philosophen seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute die wichtigsten Selbstdarstellungen des Nationalsozialismus ignoriert. Adolf Hitlers »Mein Kampf« gilt noch immer als ein Buch, das einer philosophischen Auseinandersetzung nicht würdig ist. Diese Haltung wirft ein Licht auf die Philosophie selbst. Findet sie in »Mein Kampf« womöglich zu viel von sich selbst? Und was ist es genau, was sie dort findet? Trawnys Lektüre von Hitlers Buch geht der Möglichkeit einer Kontinuität von Philosophie und Nationalsozialismus nicht aus dem Weg. Es ist die Begegnung mit einem Hass, der uns allein schon deshalb bedroht, weil er einmal die Macht ergriffen und das Leben der Gesellschaft beherrscht hat. Es gibt keinen Grund zu meinen, der Hass wäre vergangen.