Athen und Rom
- 270 Seiten
- 10 Lesestunden
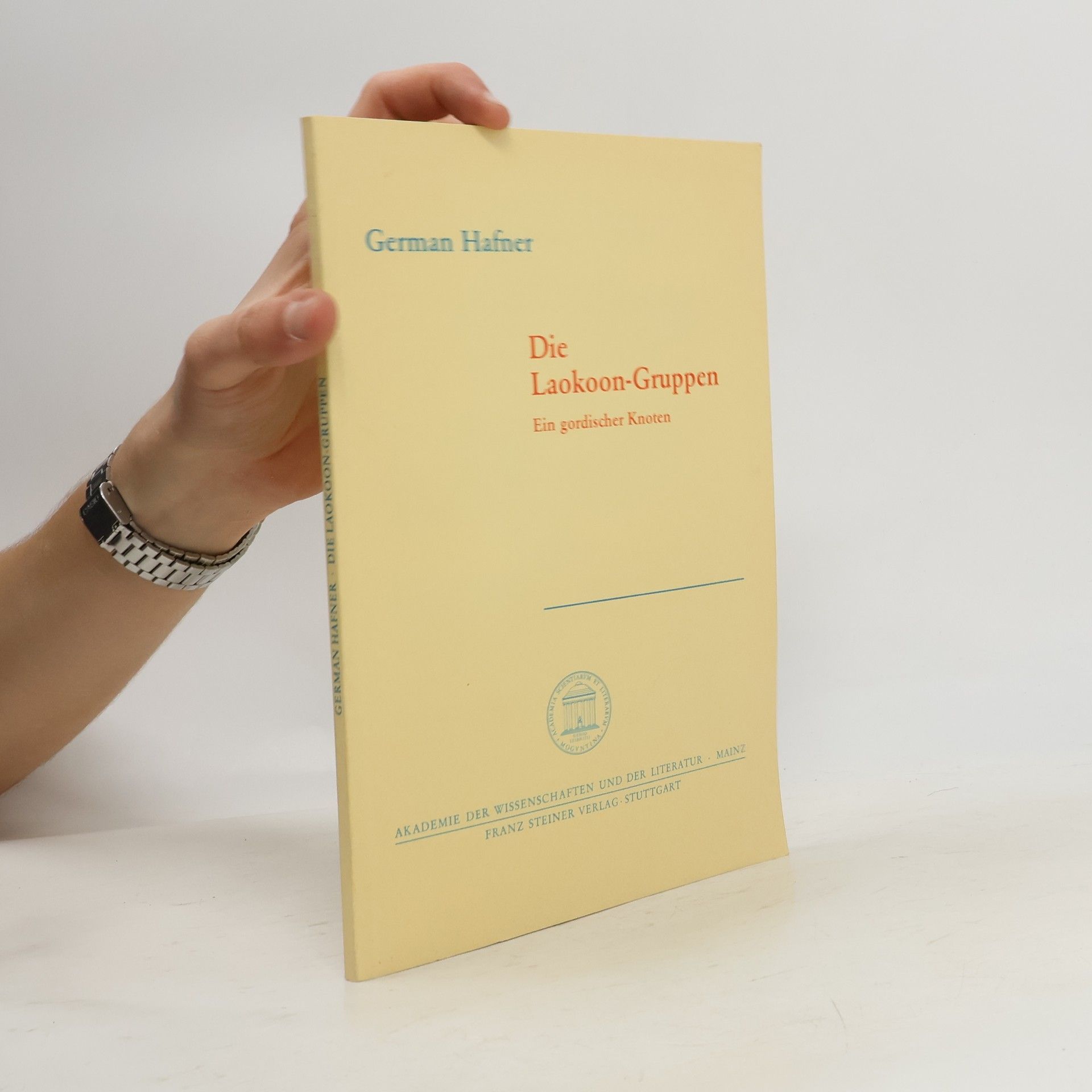
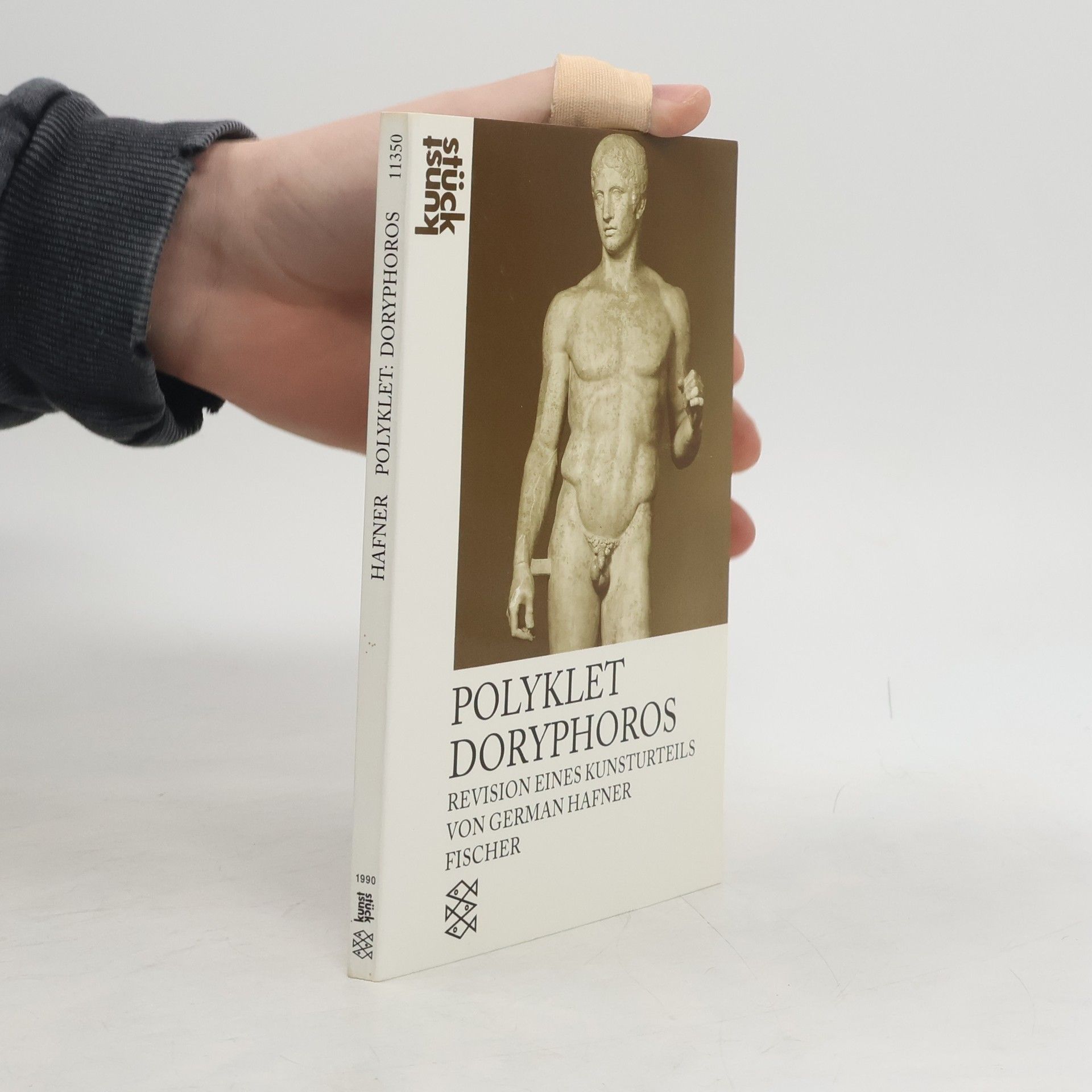



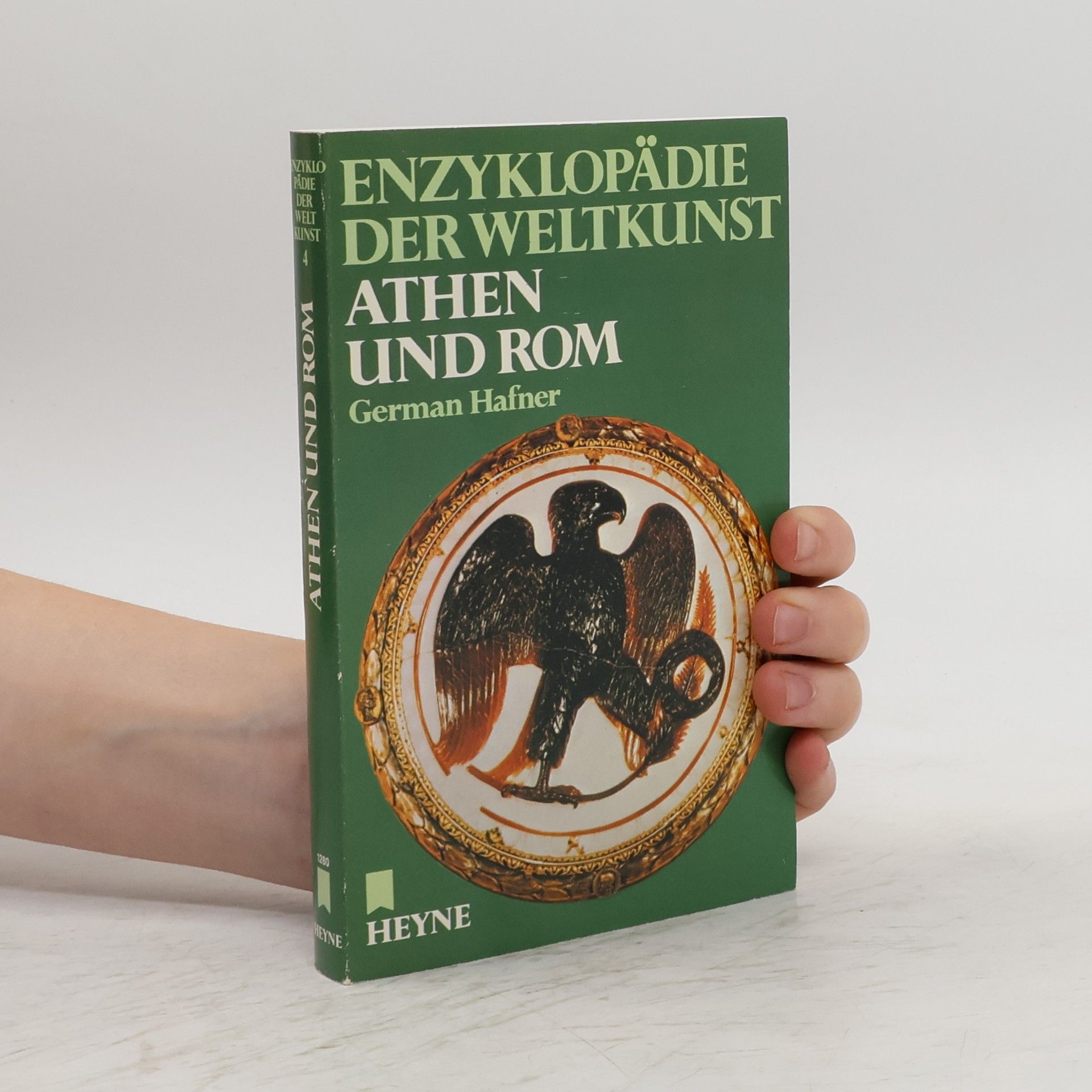
Per Gesetz machte im Jahre 534 n. Chr. Kaiser Justinian der Kultur ein Ende, die von den Griechen 1000 Jahre vorher erfolgreich gegen den Angriff der Perser verteidigt worden war und in deren Mittelpunkt der Mensch stand. Mit dem Christentum kehrte jetzt jene Tyrannis zurück, die die Griechen überwunden glaubten. Die Christen zerstörten alles, was an das „Heidentum“ erinnerte und fügten sich in die anonyme Masse, über die ein König herrschte, der im Auftrag eines allmächtigen Gottes handelte. Es galt nun nicht mehr was evident oder mit logischen Mitteln bewiesen war, sondern was verkündet wurde. Cassiodor, Privatsekretär des Theoderich in Ravenna, konnte große Teile der antiken Schriften retten. In von ihm gegründeten Klöstern übernahmen die Mönche die Aufgabe, die Schriften der alten Denker abzuschreiben und so für die Zukunft zu bewahren. Diese philosophischen Schriften zählen zur Grundlage der freiheitlichen Kultur der Gegenwart.
Über den Doryphoros des Polyklet wurde bereits viel und ausführlich geschrieben. Allerdings standen dabei meist formale Gesichtspunkte im Vordergrund des Interesses, da Polyklet eine theoretische Schrift mit dem Titel »Kanon« verfaßt hatte und die Statue des Doryphoros im Altertum ebenfalls so genannt wurde. Seitdem die Statue durch Kopien bekannt ist, sah man in ihr jene Proportionsgesetze, die Polyklet theoretisch dargelegt hatte, greifbar realisiert und nachprüfbar. So wurde der Doryphoros eine Art »Musterfigur«, mit der Folge, daß Polyklet als »Formalist« erschien.Man vergaß darüber den Anspruch der Statue auf eine Würdigung der künstlerischen Leistung insgesamt. Eine solche ist aber nur möglich, wenn man weiß, wen der Doryphoros darstellt. Um Klarheit zu schaffen, bedarf es der eingehenden Sichtung der antiken Quellen. Dieser Aufgabe hat sich German Hafner angenommen.(Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)