Hoodia Gordonii ist eine Sukkulente aus der Wüste Kalahari im Süden Afrikas, deren Wirkstoff dem Körper Sättigung vorgaukelt. Hoodia ist jedoch kein Wundermittel, das, ein paar Mal geschluckt, die Pfunde ohne eigenes Zutun verschwinden lässt. Monika Braun stellt diese kleine Pflanze in ihrer großen Komplexität vor. Geschichten und Hintergründe, Froschungsergebnisse und Erfolge kombiniert sie mit wichtigem Wissen zu Nährstoffen, Entstehung von Hunger, Appetit und Heißhunger. Eine gute Diät braucht Zeit und sollte sich letztendlich selber überflüssig machen. Sie sollte uns umdenken lassen, um einen neuen gesunden Weg zum dauerhaften Wunschgewicht zu finden. Und dabei kann Hoodia, verantwortungsvoll eingesetzt, helfen.
Monika Braun Bücher




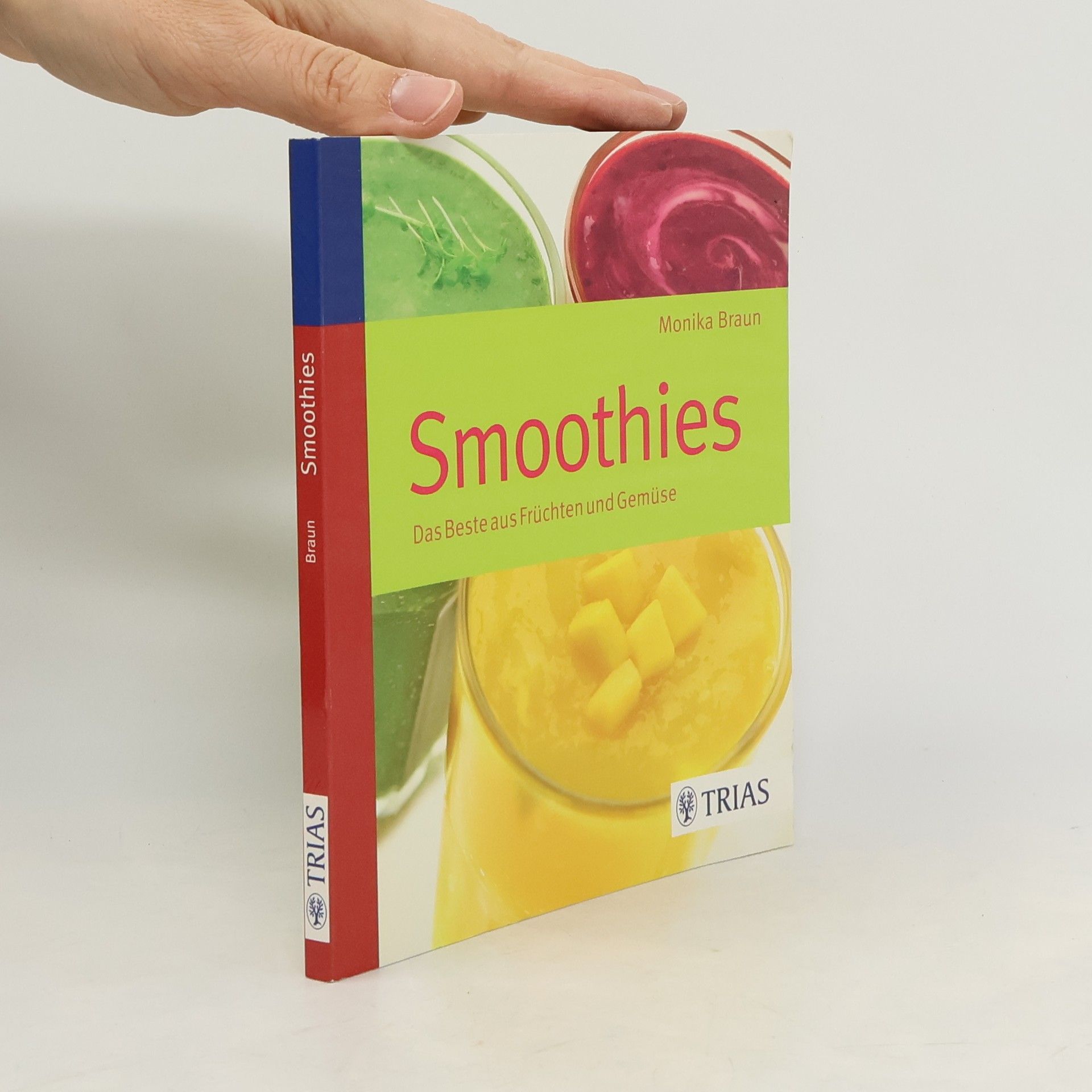
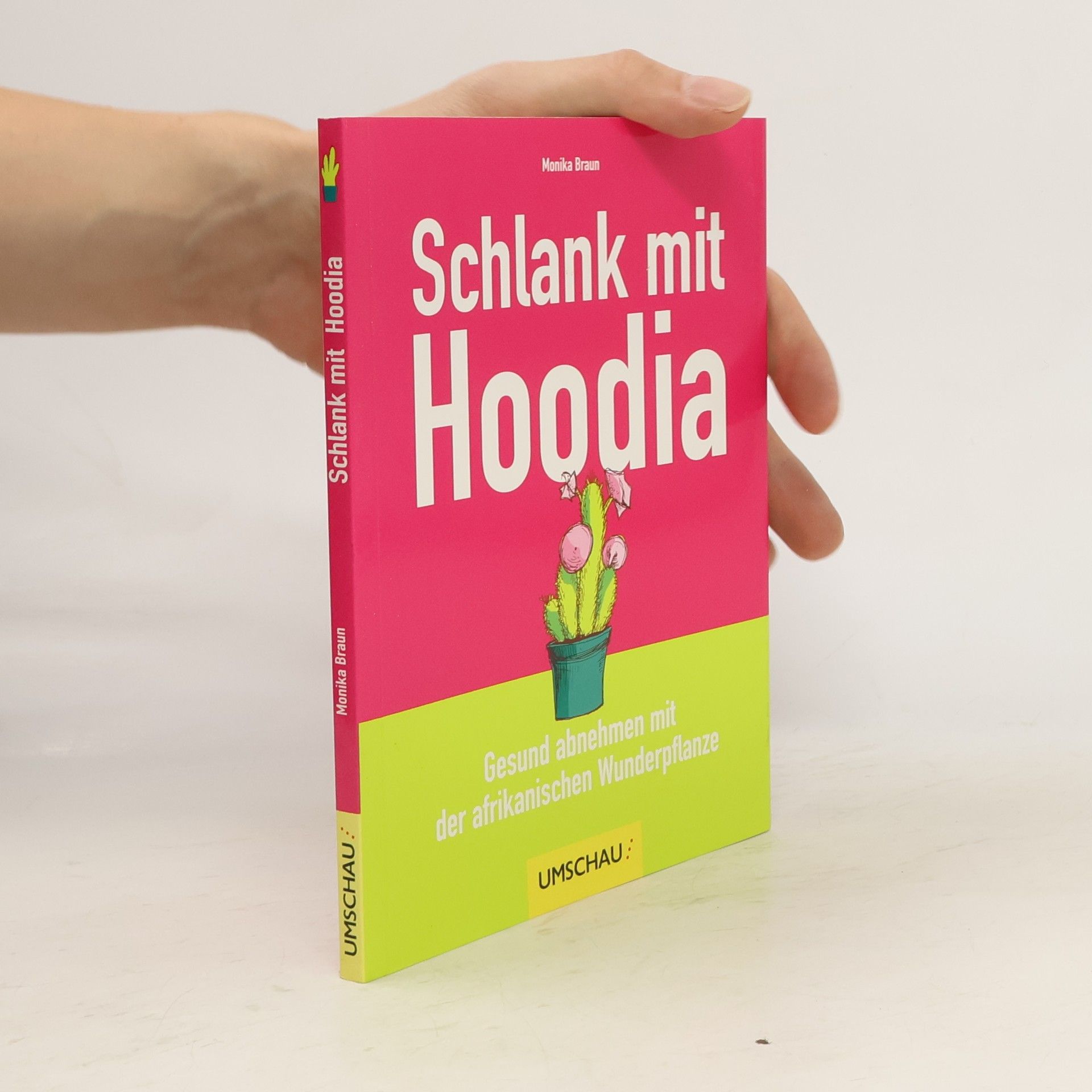
Bunte Powerdrinks zum AbnehmenSo macht Detox Spaß: cremig, fruchtig-lecker und vollgepackt mit Vitalstoffen. Mit diesen Smoothies können Sie Ihre Tagesration an Vitaminen und Mineralstoffen ganz einfach trinken - Zutaten schnippeln, den Mixer anwerfen und ruck-zuck pürieren. Ob ganz aus Früchten, leuchtend grün oder mit einem Extraschuss Stoffwechsel-Power aus Superfoods wie Chiasamen, Gojibeeren und wählen Sie sich Ihre Schlank-Shakes ganz nach Lust und Laune. So kurbeln Sie Ihren Stoffwechsel an und tanken Kraft - ganz locker und auf die "smoothe" Art!Monika Braun liebt Smoothies! Hat in ihrer Küche püriert, gemixt, probiert. Dabei über 100 ungewöhnliche Drinks kreiert. Und gut 20 Kilo abgenommen. Die Oecotrophologin lebt und arbeitet in Berlin als Gesamtschuldirektorin.
Fit wie ein Turnschuh mit Baobab
Ein uraltes, reines Naturpulver revolutioniert.
- 86 Seiten
- 4 Lesestunden
DAS GELD FÜR ÜBERTEUERTE POWERDRINKS KÖNNEN SIE SICH SPAREN; ".ein Naturfruchtpulver bringt Sie in Schwung...." Fühlen Sie sich manchmal antriebslos und lustlos? Der Erfolgsdruck im Leben kann erdrückend sein und macht oft krank. Ich kenne dieses Gefühl nur zu gut, aber ich habe eine Lösung gefunden: Baobab, ein Naturfruchtpulver vom Affenbrotbaum. Mein Interesse daran wurde während eines Besuchs auf einer Veganmesse geweckt, wo ich zwei auffällige junge Männer mit Baobab-Pulver entdeckte. Neugierig geworden, habe ich es ausprobiert und bin begeistert von den Ergebnissen. Seit ich Baobab regelmäßig einnehme, fühle ich mich fit und ausgeglichen. Meine Bekannten bemerken meine neue Vitalität und mein frisches Aussehen. Diese positive Veränderung geschieht nicht über Nacht, sondern ist das Resultat einer natürlichen Nahrungsergänzung. Mein Ratgeber bietet Ihnen alle wichtigen Anwendungshinweise, Tipps und Rezeptvorschläge. Baobab ist auch für Diabetiker geeignet, da es frei von vielen Allergenen ist. Zahlreiche positive Rückmeldungen bestätigen die Vorteile: von verbesserter Gesundheit bis hin zu frischerer Haut. Warum sich mit teuren Vitamin- und Powerdrinks abmühen, wenn die Natur so viel zu bieten hat? Entdecken Sie die Vorteile dieses Naturwunders und verbessern Sie Ihre Lebensqualität.
Książka Uwierzyć w niemożliwe jest tekstem hybrydycznym. Pozornie otrzymujemy klasyczne omówienie „życia i twórczości” jednej z najwybitniejszych polskich witrażystek, Teresy Marii Reklewskiej. Jednak nawet pobieżna lektura sprawia, że dzięki niemu zaczynamy stopniowo wnikać w tajemniczy i fascynujący świat wielowiekowej tradycji witraży i witrażownictwa jako odrębnej dziedziny rzemiosła oraz w sferę sacrum, dla której witraż jest jedynie pośrednim, ale bardzo istotnym medium. Rozległa wiedza filologiczna, filozoficzna i historyczna autorki pozwala jej poruszać się swobodnie w różnych obszarach badawczych, łączących w sobie na przykład informacje na temat metafizycznej i mistycznej interpretacji światła z konkretną, wypracowywaną przez wieki wiedzą technologiczną i warsztatową niezbędną przy powstawaniu witraży. prof. dr hab. Waldemar Okoń
Książka ta powstała z krzyżowania się ludzkich losów w czasie i przestrzeni, będąc rezultatem historii moich antenatów, ich przyjaciół, wrogów, miłości oraz wyborów. Nie byłoby jej bez ludzi, którzy obecnie są częścią mojego życia i których spotkałam w wyniku dziwnych zbiegów okoliczności, starając się lepiej zrozumieć życie tych, którzy odeszli. To wspólny wysiłek przeszłości i teraźniejszości składa się na opowieść o dziedziczeniu cech ciała i umysłu, majątku, tytułów, pasji i chorób – procesie tak tajemniczym jak migrena. Ta dolegliwość jest nie tylko fizycznym skurczem naczyń krwionośnych, ale także częścią osobowości, genetycznym dziedzictwem. Cierpienie, które po uzdrowieniu pozostawia nosiciela z uczuciem braku i tęsknoty. Historia ta ukazuje, co nas łączy – zarówno w dobrych, jak i złych momentach, mimo że często nie jesteśmy tego świadomi. To trudna do zidentyfikowania, wewnętrzna substancja jest naszym prawdziwym domem, podczas gdy materialne aspekty ludzkich siedzib podlegają zniszczeniu. Autorka, Monika Braun, jest aktorką, kulturoznawczynią, nauczycielką akademicką i pisarką, z bogatym dorobkiem publikacyjnym oraz doświadczeniem w pracy na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Monika Braun jest niemałą nagrodą za trud nadążania za jej myślą, w której żyją myśli zmarłych myślicieli. Oni głosu już nie mają zdali go na nas, jako i my zdamy go w dziedzictwie tym smarkaczom, co się nawet jeszcze nie porodzili. Książki czułych metafizyków zawsze są o tym samym, lecz każdy z nich, jak kornik kręci w bezmiarze możliwych słów swoją własną, niepowtarzalną a krętą ścieżkę. Gdy podążamy za słowem metafizyka, mamy pewność, że jest jedyne i niezastępowalne, choć w końcu podobne do tysięcy innych mądrych słów. I właśnie w tej niepowtarzalnej powtarzalności metafizyki wykłada się i uwierzytelnia prawda. Monika Braun ma ucho do prawdy. Jest prawdomówna. I właśnie dlatego, że tak skrzętnie wymiata ze swoich tekstów fałszywe nuty, są one tak ujmujące, miłe dla ucha i umysłu. To niełatwa sztuka, bo, wierzcie mi, pokusa egzaltacji i tromtadracji jest w rzemiośle filozofa przemożna. Podobnie jak pokusa ckliwości i banału. Za nic nie płacą filozofom tak dobrze, jak właśnie za zdradę tego powołania do nasłuchiwania prawdy i starannego poszukiwania dla niej trafnego słowa. To tak jak z muzyką za melodyjność i forte płacą lepiej niż za cichy, szlachetny liryzm i skupienie. I z aktorstwem, które czym oszczędniejsze w środkach, tym oszczędniejsze w gażach.