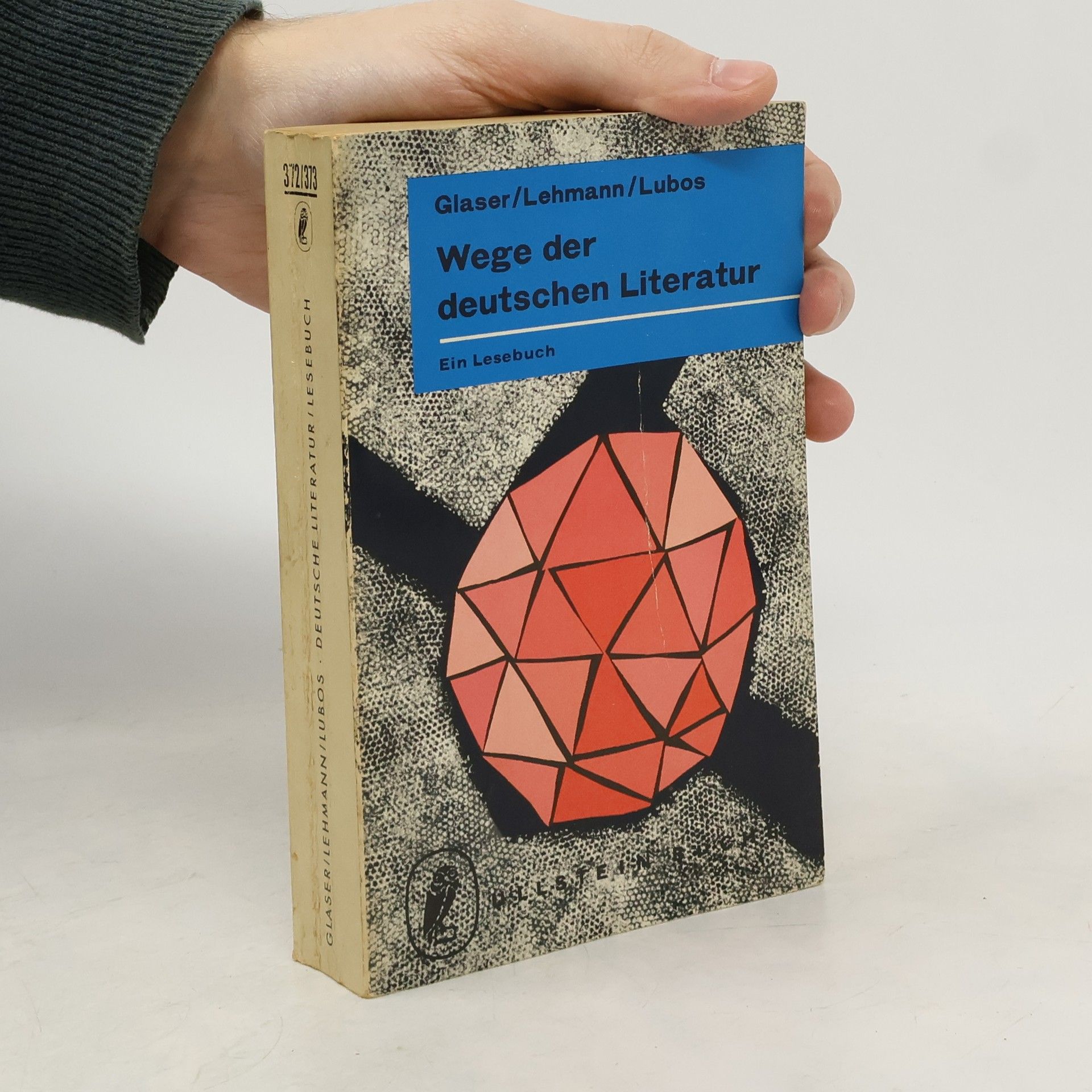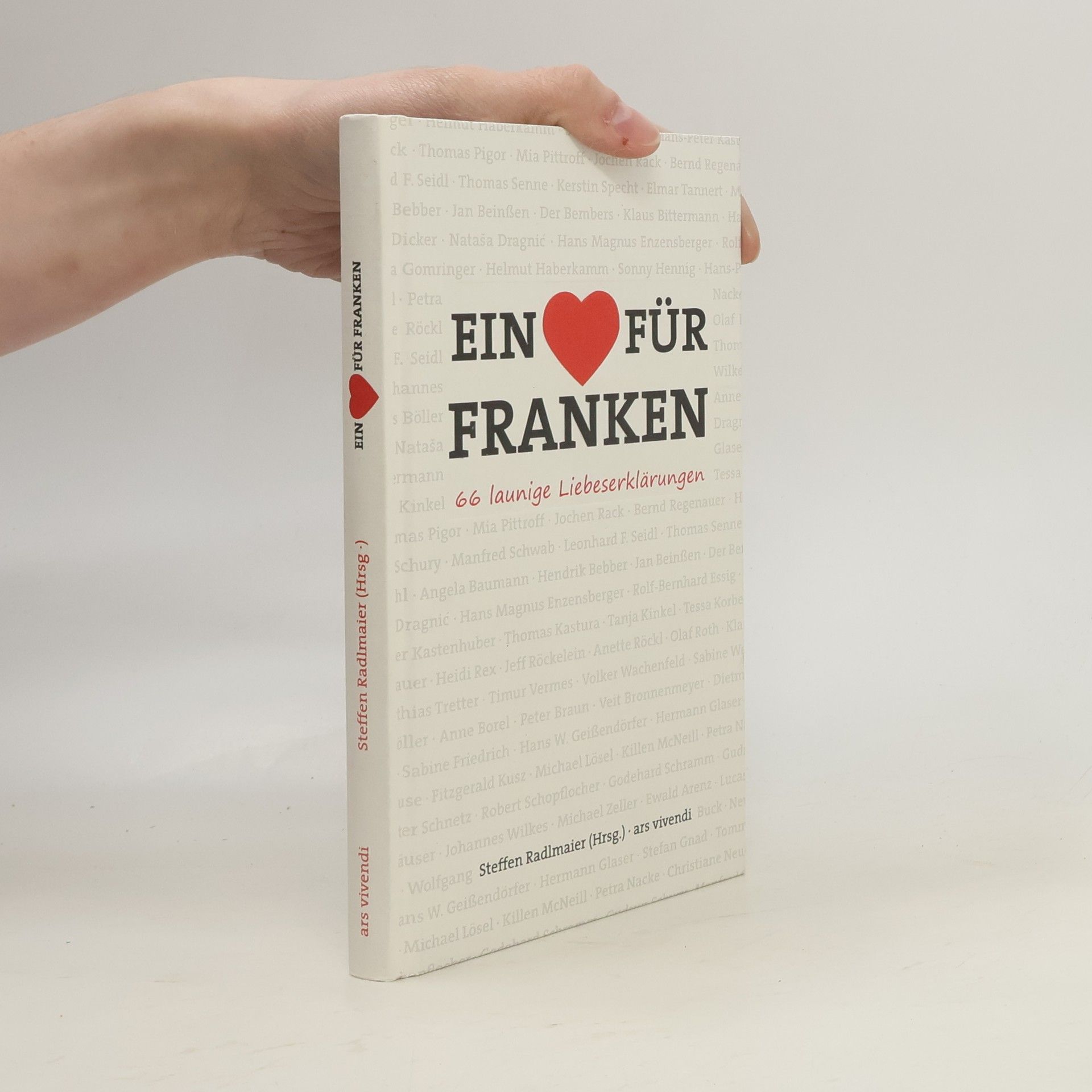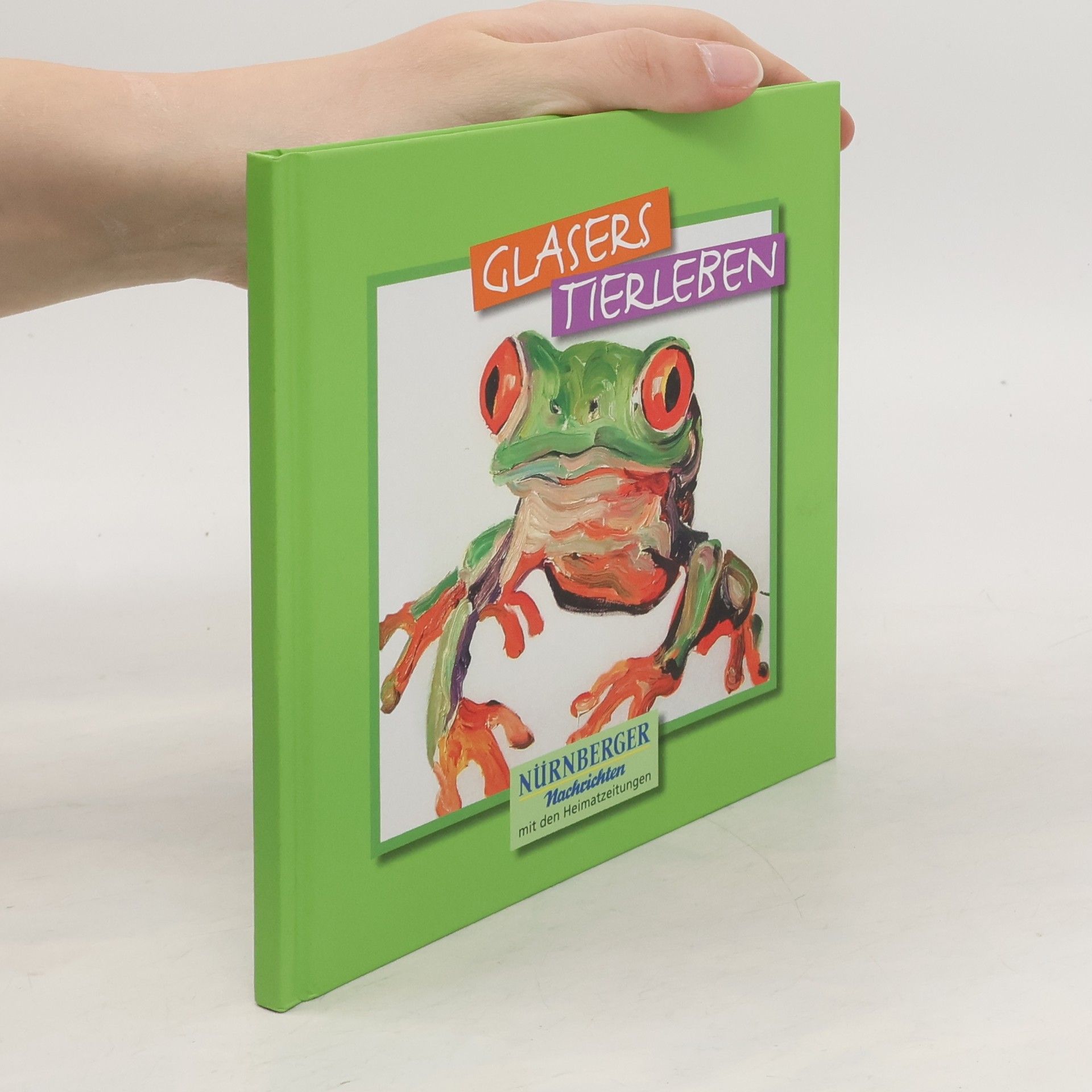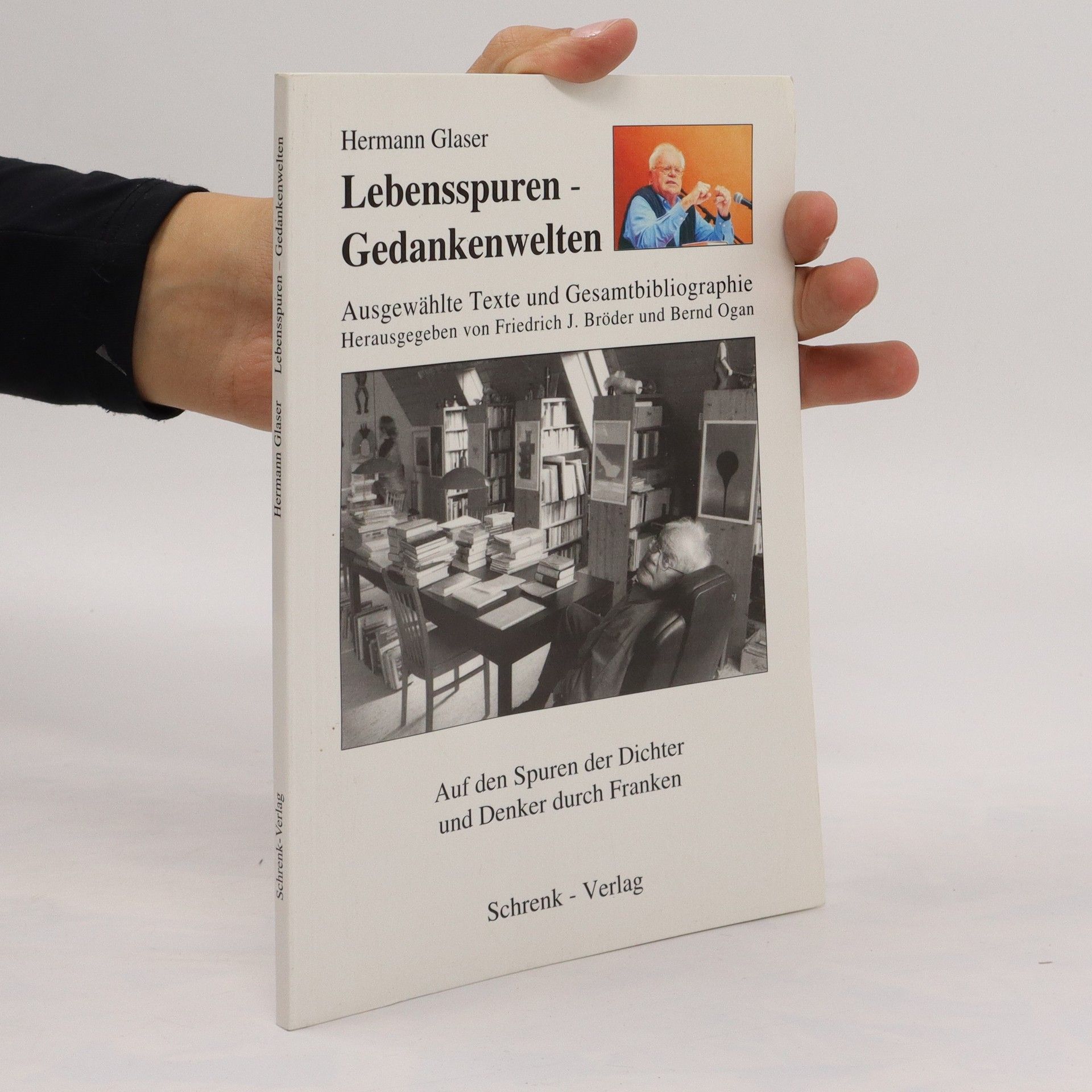The Cultural Roots of National Socialism
- 292 Seiten
- 11 Lesestunden
The book explores the pervasive provincialism in German culture that has persisted since the mid-19th century, highlighting significant issues faced in the 20th century. It delves into the implications of this cultural limitation and its impact on society, offering insights into the historical and social factors that have shaped German identity and thought. Through a critical analysis, it addresses the challenges that arise from such provincialism and its relevance to broader cultural discussions.