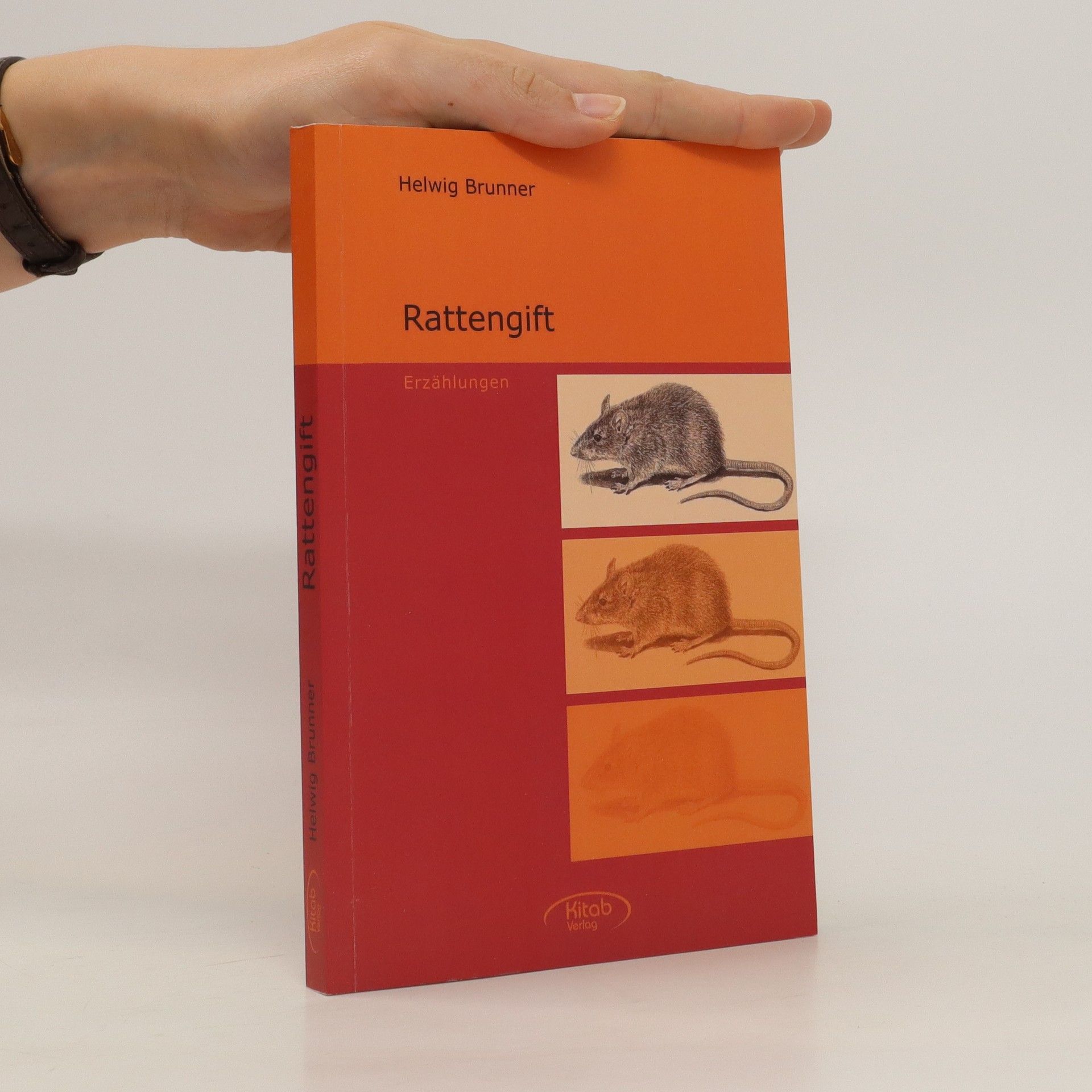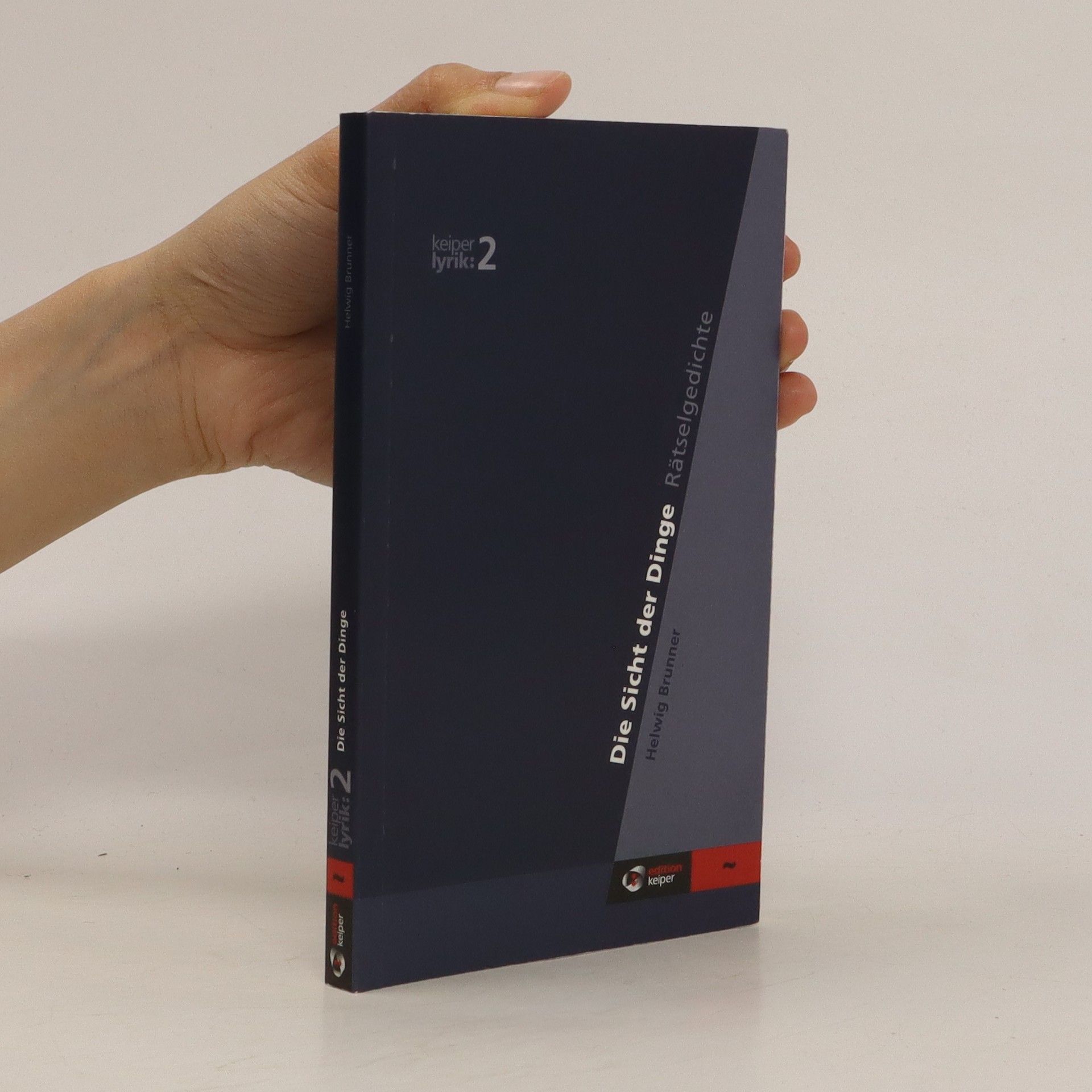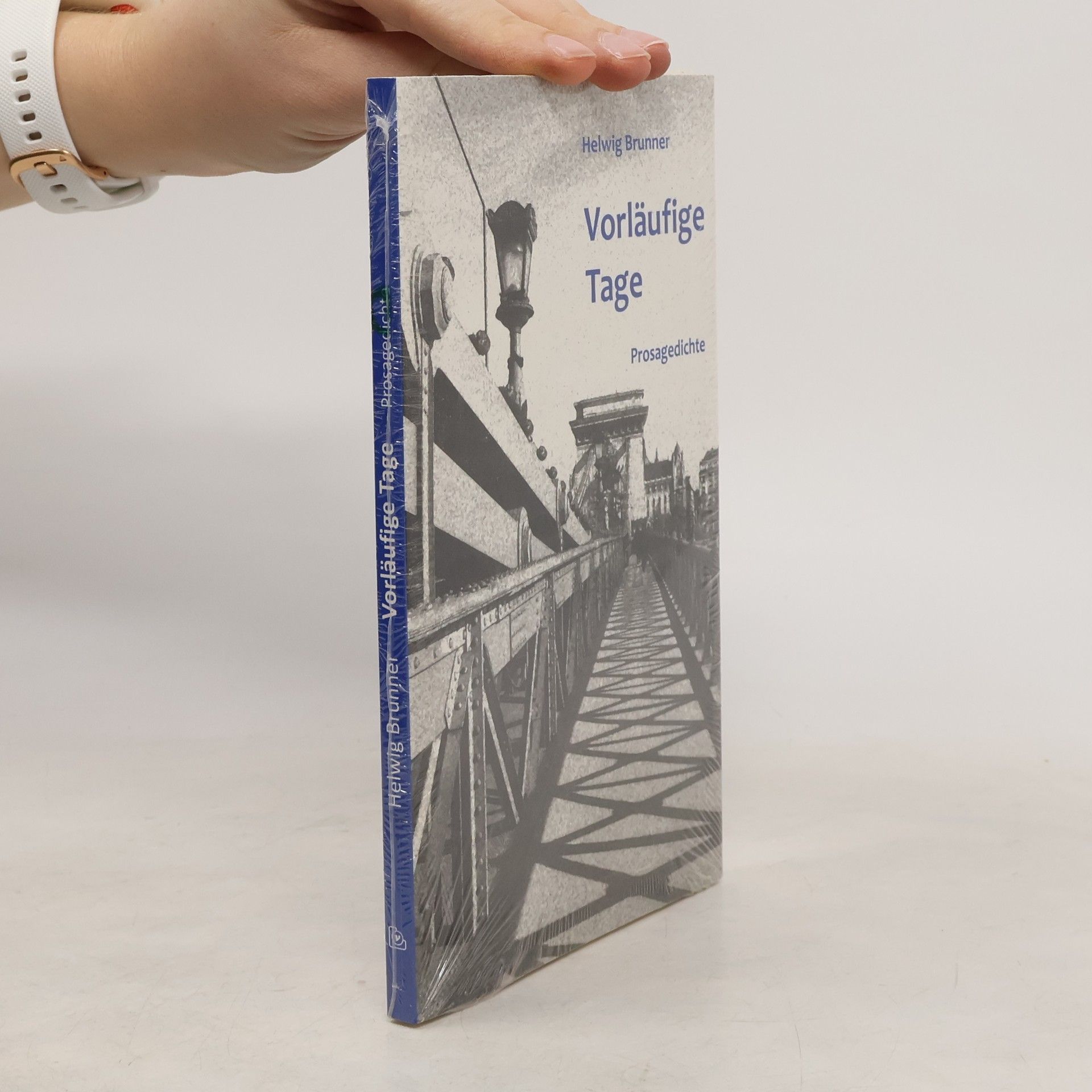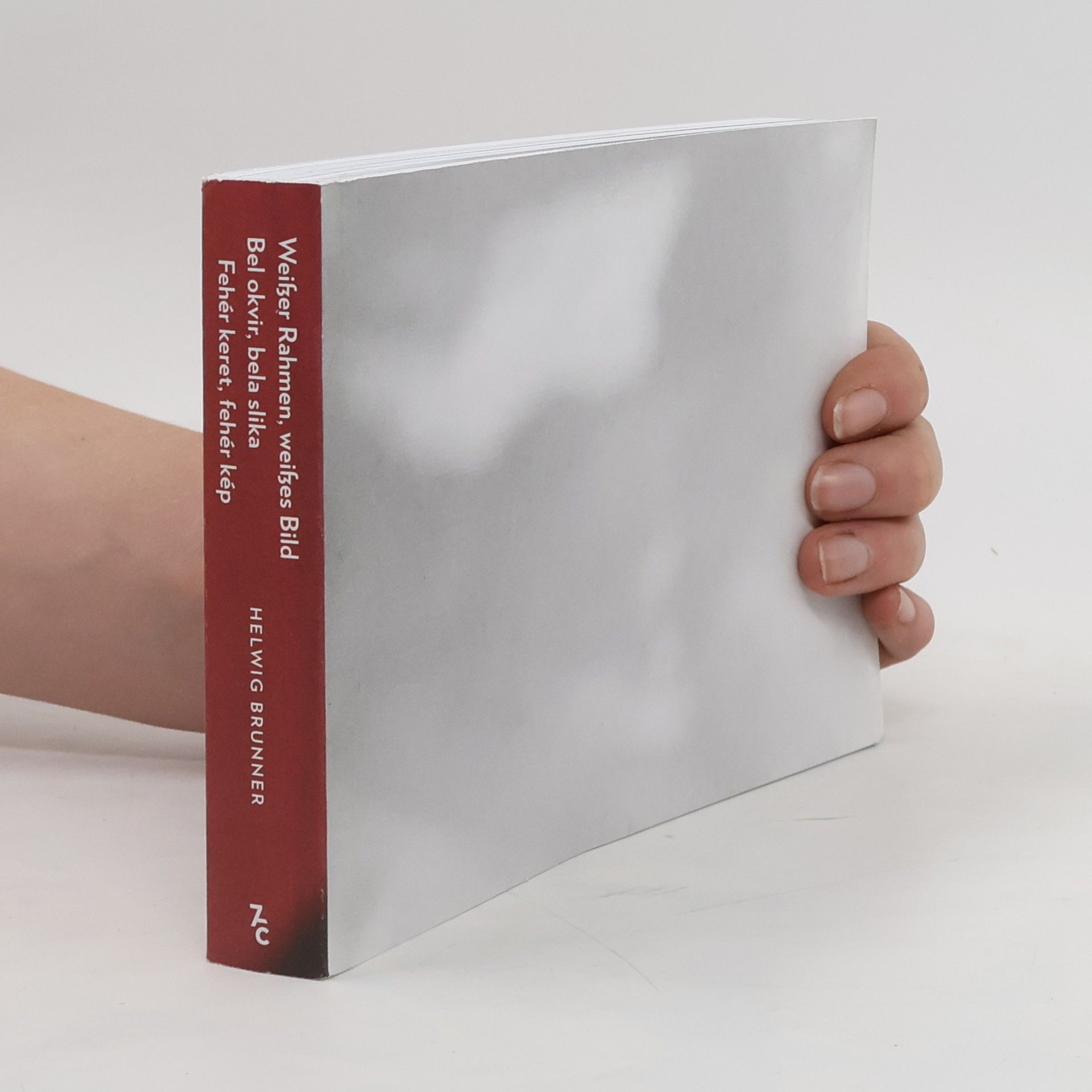Flirren
Roman
Helwig Brunner zeichnet ein Bild von unserer Welt, wie sie im 25. Jahrhundert aussehen könnte. Was bleibt vom Leben, wie wir es heute kennen? Was von unseren Werten? Und wie wird der Rückblick aus der Zukunft auf unser heutiges »Hoffnungszeitalter« aussehen? Flirren erweist sich als Bündel von Fragen, die aus einer fernen Zukunft auf uns selbst, unser Hier und Jetzt, zurückfallen. Wir schreiben das 25. Jahrhundert. Klimakrise, Artensterben und nukleare Katastrophen haben die Erde zu einem unwirtlichen, schwer bewohnbaren Planeten gemacht. Hitze und Dürre flirren auf und über der Welt, Gletscher schmelzen, das Wasser dunstet den Menschen davon. In einem Humanareal lebt der Vergangenheitsforscher Leonard und arbeitet im Auftrag einer mächtigen Behörde daran, einstige Hoffnungsquellen und verheerende Versäumnisse der Menschheitsgeschichte zu beschreiben. Er blickt auf das dunkle Herz des 20. und 21. Jahrhunderts und erinnert sich zugleich voller Trauer an seine große Liebe Lea. Mit seiner umfangreichen Sachkenntnis als Ökologe mit dem Schwerpunkt Energiewende hat Helwig Brunner einen wachrüttelnden Roman geschaffen. Flirren ist ein Versuch, die offensichtlichen Gefährdungen menschlichen, zivilisatorischen und ökologischen Wohlergehens ungeschönt und in kompromisslos genauer Sprache weiterzudenken.