Unterrichtsentwicklung muss mit der Praxis der schulischen Leistungsbewertung zusammengebracht werden: nur so können die schulischen Lehr- und Lernprozesse verändert werden. Offener Unterricht leistet einen wichtigen Beitrag zu einer zeitgemäßen Veränderung schulischer Lehr- und Lernprozesse. Unterrichtsentwicklung greift jedoch zu kurz, wenn die Praxis der schulischen Leistungsbewertung nicht sorgfältig mitbedacht wird. Die Zusammenführung der beiden Themenbereiche 'Leistungsbewertung' und 'Offener Unterricht' wurde bisher vernachlässigt. Der Band greift dieses Spannungsfeld systematisch auf, entwickelt theoretische und methodisch-didaktische Grundlagen, stellt empirische Forschungsergebnisse dar und beschreibt zahlreiche praxisnahe Beispiele. Damit ist eine Lücke geschlossen, die von Studierenden, Referendaren, Lehrkräfte und Multiplikatoren als ein großer Nachteil empfunden wurde. Aus dem Inhalt:Leitbilder des offenen UnterrichtsErgebnisse der empirischen ForschungBegründung einer veränderten BewertungLeistungsbewertung bei bekannten Reformpädagogen (z. B. C. Freinet)Diagnostische GrundlagenGütekriterienMethodisch-didaktische Aspektezahlreiche BeispieleGestaltung von ZeugnissenPortfolio
Thorsten Bohl Bücher
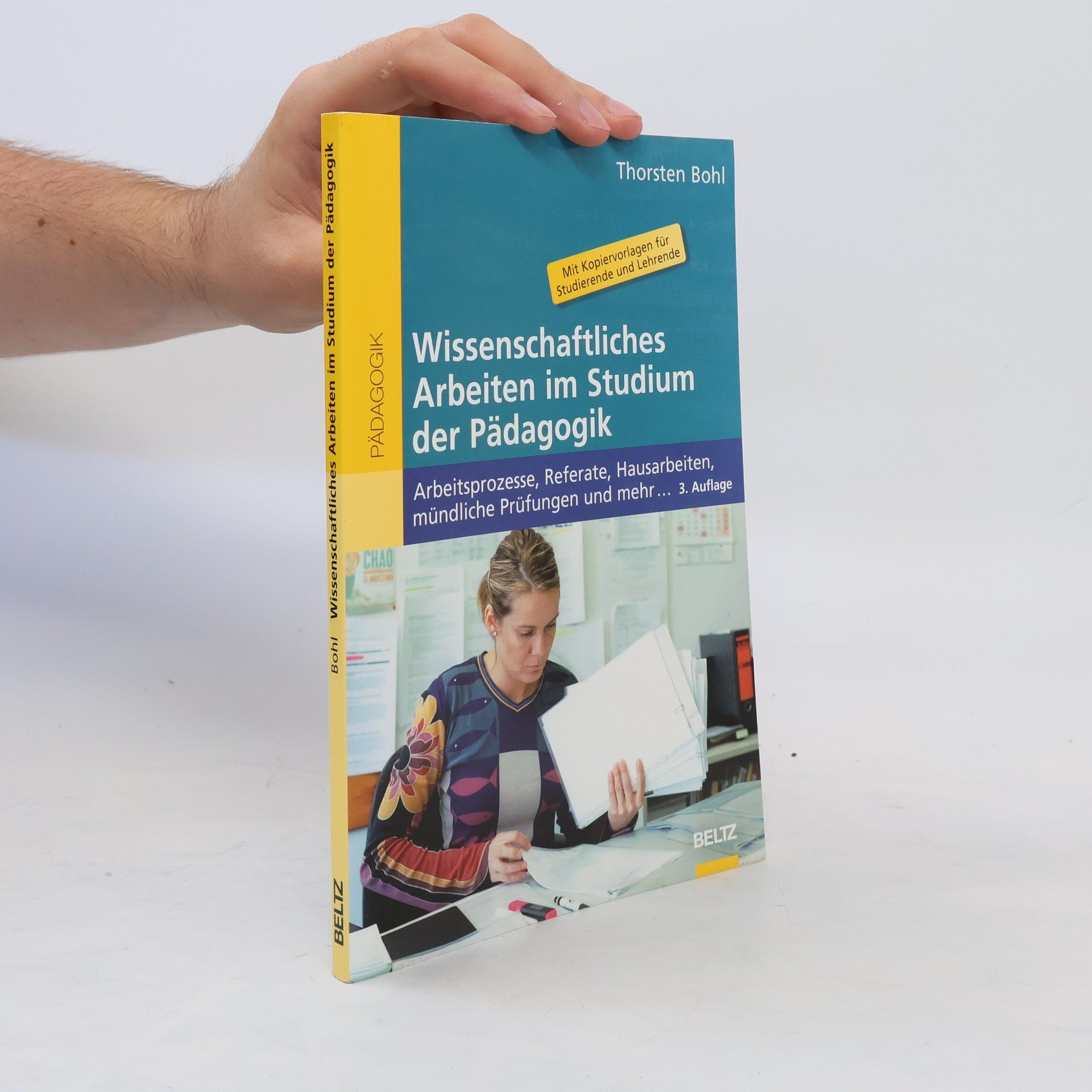
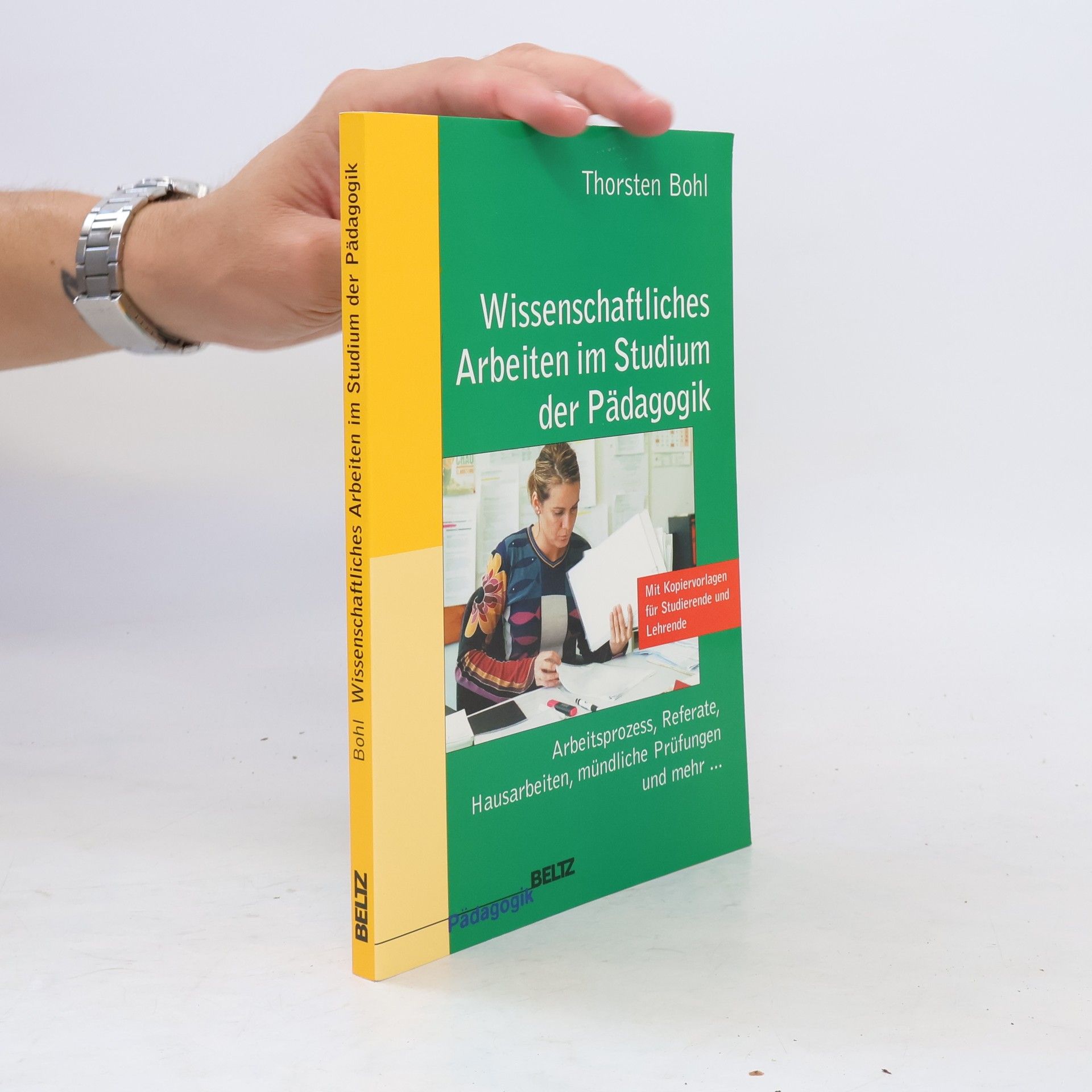


Jeder Schüler ist anders und die Heterogenität in Schulen nimmt zu. Das Studienbuch stellt den „state of the art“ der Forschung zur Heterogenität in Schule und Unterricht dar und fasst die aktuelle Diskussion für Studierende des Lehramts sowie der Erziehungswissenschaft präzise und verständlich zusammen. Die Beiträge repräsentieren den nationalen und internationalen Forschungsstand und sind verständlich geschrieben.
Alles zum Thema wissenschaftliches Arbeiten - anschaulich dargestellt und mit vielen praktischen Beispielen. Studierende sind im Laufe ihres Studiums vielfach mit wissenschaftlichen Arbeitstechniken befasst: Wie wähle ich das Thema einer schriftlichen Arbeit aus? Wie kann der Arbeitsprozess strukturiert werden? Wie zitiert man? Wie verfasst man ein Literaturverzeichnis? Wie lässt sich ein Referat strukturieren und abwechslungsreich gestalten? Wie kann die Qualität von Hausarbeiten verbessert werden? Wie bereite ich mich auf eine mündliche Prüfung vor? Wie kann ich den Verlauf von Prüfungsgesprächen gestalten? Das Buch ist geeignet das gesamte Studium erfolgreicher und effektiver zu gestalten, insbesondere wenn damit bereits von Beginn an gearbeitet wird. Dozierende erhalten hochschuldidaktische Unterstützung in Form zahlreicher Visualisierungen und umfangreicher Kopiervorlagen, z. B. als Arbeitsaufträge, Diskussionsgrundlagen, Checklisten für Referate und Hausarbeiten oder Gliederungshilfen für mündliche Prüfungen. Der Band berücksichtigt zudem neuere Entwicklungen im Hochschulbereich wie Glaubwürdigkeitsprüfungen von Internetquellen oder eine Einführung in Portfolio als alternativen Leistungsnachweis.
Weissenschaftliches Arbeiten im Studium der Pädagogik
- 137 Seiten
- 5 Lesestunden
Alles zum Thema wissenschaftliches Arbeiten - anschaulich dargestellt und mit vielen praktischen Beispielen - steckt in diesem Buch. Es zeigt, wie das gesamte Studium erfolgreicher und effektiver zu gestalten ist.Studierende sind im Laufe ihres Studiums vielfach mit wissenschaftlichen Arbeitstechniken * Wie wählt man das Thema einer schriftlichen Arbeit aus?* Wie kann der Arbeitsprozess strukturiert werden?* Wie verfasst man ein Literaturverzeichnis?* Wie bereitet man sich auf eine mündliche Prüfung vor?Dozierende erhalten hochschuldidaktische Unterstützung in Form von zahlreichen Visualisierungen und umfangreichen Kopiervorlagen.