Die Simpsons: Gelber wird's nicht
35 Jahre Simpsons, 70 Jahre Matt Groening
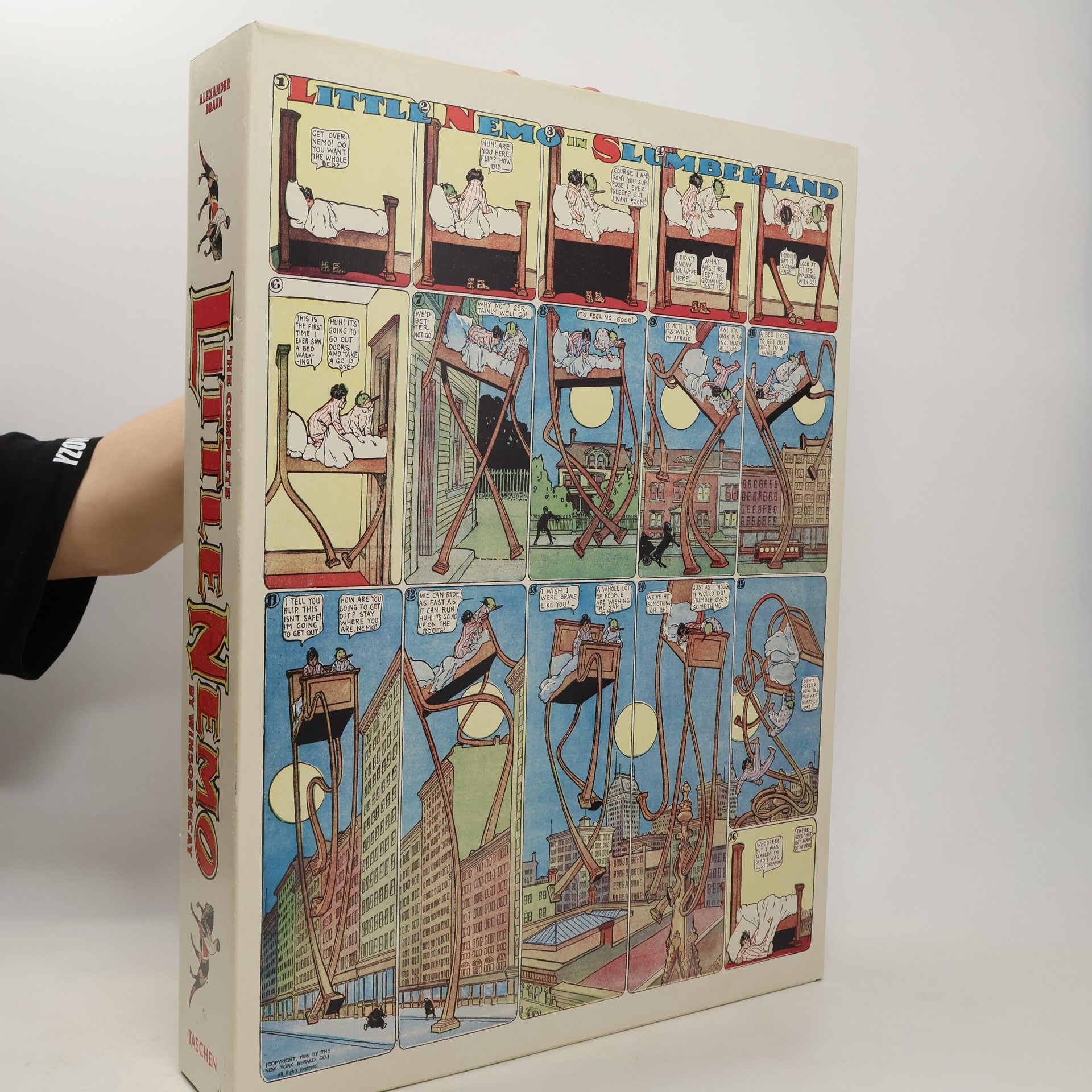





35 Jahre Simpsons, 70 Jahre Matt Groening
Comics vom Wilden Westen
"Katzenjammer" erzählt von den Brüdern Rudolph und Gus Dirks, die Ende des 19. Jahrhunderts in den USA als deutsche Immigranten einen kometenhaften Aufstieg im Verlag von William Randolph Hearst erlebten. Die Monographie bietet Einblicke in ihr Leben und Werk, ergänzt durch bislang unveröffentlichte Originalseiten und Fotodokumente.
Horror-Comics gibt es seit den frühen 1950er-Jahren. Sofort wurden sie von konservativen Kräften der amerikanischen Gesellschaft der McCarthy-Ära angefeindet, was 1954 zur Verabschiedung eines Selbstzensur-Codes der Industrie führte. Zensur ist eigentlich ein No-Go für westliche Demokratien, aber Horrorcomics – insbesondere die des EC-Verlags – waren zu subversiv, zu gesellschaftskritisch und zu autonom im Sinne einer unerwünschten Jugendkultur. Ab den späten 1960er-Jahren setzte schließlich eine Liberalisierung ein und Horror wurde zu einer festen Größe der Pop- und Comic-Kultur. Vampire, Werwölfe, Frankensteins Monster: sie alle wurden jetzt auch als Comic adaptiert. Dazu Geister und Dämonen, Okkultismus und Zombies, sowie Manga-Gore aus Japan. Diese Publikation präsentiert 70 Jahre Horror-Comics, vorgestellt durch seltene Dokumente und Meisterwerke von Graham Ingels, Jack Davis, Bernie Wrightson, Richard Corben, Mike Mignola, Hideshi Hino, Shintaro Kago u.v.m. – darüber hinaus liefert Alexander Braun ganz nebenbei auch einen spannenden Ritt durch Gesellschafts- und Kulturgeschichte.
Kaum jemand hat den Comic so sehr geprägt wie der amerikanische Autor und Zeichner Will Eisner!Fast 70 Jahre lang arbeitete er in dem Medium, von seinen Anfängen während des Comic-Hefte-Booms Ende der 1930er Jahre, bis zu seinem eigenen stilprägenden Charakter „The Spirit“, der von 1940–1952 als Zeitungsbeilage erschien und die Grenzen des Erzählens mit Bildern immer wieder neu auslotete. Filmische Schnitte, ungewöhnliche Perspektiven, überraschende Seitenkompositionen, nie gesehene Verbindungen von Text und Bild – mit „The Spirit“ wandte sich Eisner vornehmlich an ein erwachsenes Publikum und verfolgte literarische Ambitionen.Anschließend zeichnete er Lehr- und Sach-Comics für große amerikanische Unternehmen und für das US-Militär. Erst 1971 meldet er sich auf dem Comic-Markt zurück. Mit Ein Vertrag mit Gott legt er 1978 seine erste Graphic Novel vor und begründet damit ein neues literarisches Genre. Es folgen knapp zwanzig weitere Titel, darunter die autobiografisch inspirierten Werke The Dreamer und Zum Herzen des Sturms sowie 2005, kurz vor seinem Tod, Das Komplott – Die wahre Geschichte der Protokolle der Weisen von Zion in der er die Entstehung dieser antisemitischen Fälschung zum Thema macht.Eisner erhielt zahlreiche internationale Preise, darunter den „Grand Prix Alfred“ und den „Lifetime Achievement Award“ der National Foundation for Jewish Culture. Auch der bedeutendste Comic-Preis der USA ist nach ihm benannt!
Anime, die japanische Form des Zeichentrickfilms, hat seit den 1970ern die westliche Kultur beeinflusst. Während die erste Generation japanische Filme oft nicht erkannte, fand die Generation von Dragon Ball und Sailor Moon ab den 1990ern die Exotik stimulierend, was zu einer globalen Jugendkultur führte. Studio Ghibli gewann 2003 einen Oscar für Chihiros Reise ins Zauberland.
Nach Ende des Krieges teilten sich die Kriegs-Comics in das große Lager jener, die den historischen Kontext als Folie für heroische Heldengeschichten nutzten (Marvel, DC etc.), während ein Verlag wie EC bereits ab den frühen 1950er-Jahren – unter Federführung von Harvey Kurtzman, Erfinder des MAD Magazins – atemberaubend ambitionierte Anti-Kriegserzählungen vorlegte.Die 1970er-Jahre erlebten dann eine sukzessive Enthistorisierung des Themas. Cross-over-Produktionen des Kriegs-, Horror- oder Fantasy-Genres hielten Einzug, und die Figur des Nazis wurde neben Vampiren, Werwölfen und Zombies zum festen Bestandteil des Kanons des Bösen. Die Ausstellung zeigt knapp 100 seltene, bis heute überwiegend noch nie ausgestellte Originalzeichnungen und Dokumente.Es erscheint ein 224 Seiten starker Katalog mit über 300 Abbildungen. Das Buch ist nur in der Ausstellung erhältlich.(aus dem Flyer der Ausstellung)
Die Grundsituation ist simpel: Eine schwarze Katze liebt eine durchtriebene weiße Maus, die ihr ständig Ziegelsteine an den Kopf wirft. Der Hundepolizist Offissa Pupp, heimlich in die Katze verliebt, versucht, dies zu verhindern. George Herrimans legendärer Zeitungsstrip, der von 1913 bis 1944 erschien, variiert diesen Plot auf so geistreiche Weise, dass er ein breites Publikum anspricht, darunter literarische Größen wie Gertrude Stein, F. Scott Fitzgerald und Pablo Picasso. Die absurd-melancholischen Variationen über unerwiderte Liebe konnten dank Medien-Tycoon William Randolph Hearst, einem eingefleischten Fan, so lange bestehen. Herriman nutzte die Freiheit, die ihm Hearst gewährte, um die Möglichkeiten des Comics radikal auszuschöpfen. Er sprengte formale Grenzen und präsentierte der Leserschaft surreale, dadaistische Szenarien sowie eine Sprache voller Slang, Neologismen und Anspielungen. Zudem ließ er Geschlechterrollen diffus, was Krazy Kat zum ersten gender-fluiden Star der Comic-Geschichte macht. Dieser Band enthält alle farbigen Krazy-Kat-Geschichten aus den Jahren 1935–1944 und bietet eine ausführliche Einleitung von Comicfachmann Alexander Braun, der Herrimans multi-ethnischen Hintergrund beleuchtet und das Außergewöhnliche dieses zeitlosen Gesamtkunstwerks erforscht.