Eine unterhaltsame britische Familienkomödie mit einem Hauch von Prada, die sich um das Thema Scheidung und vier Pfoten dreht – perfekte heitere Unterhaltung für Frauen!
Birgit Franz Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
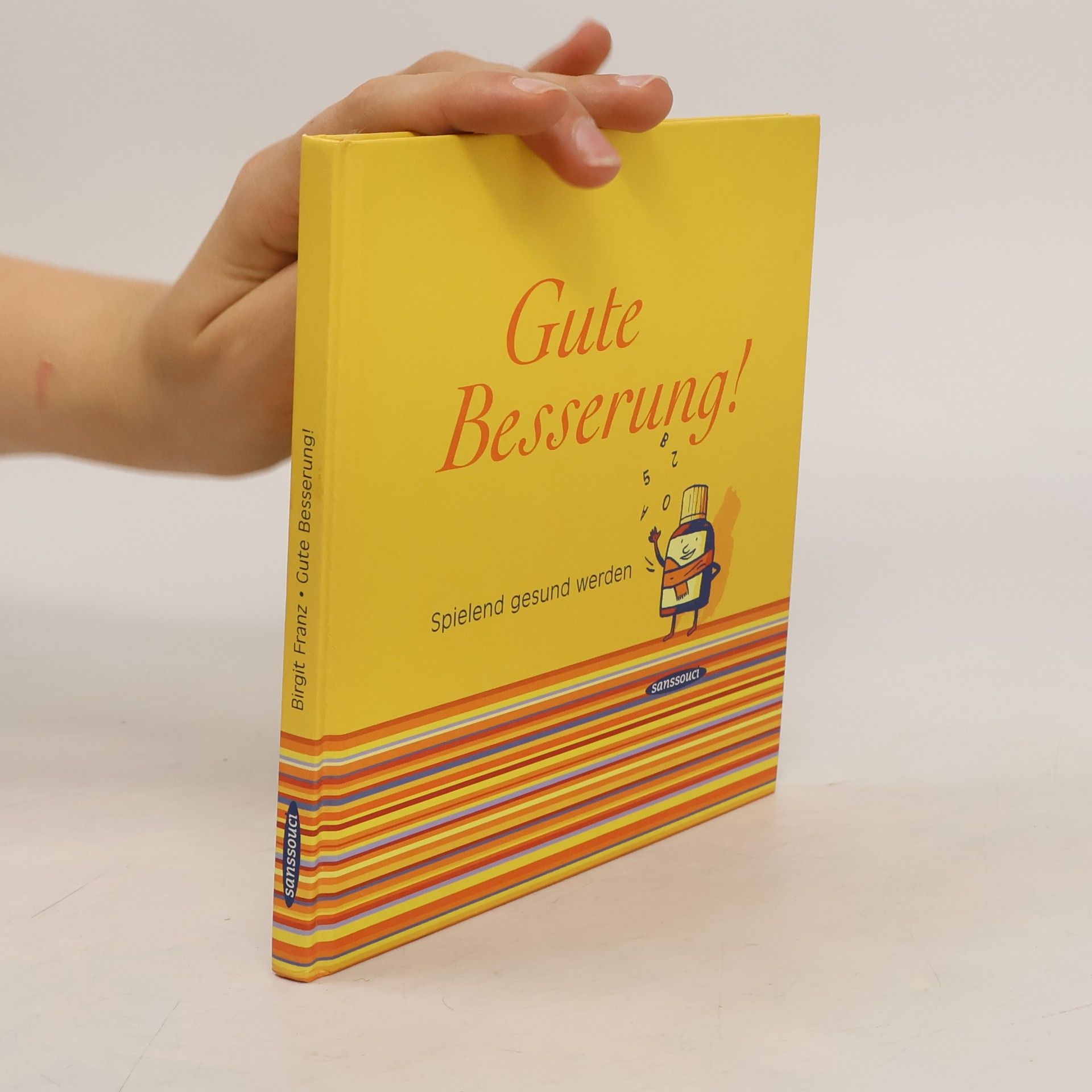

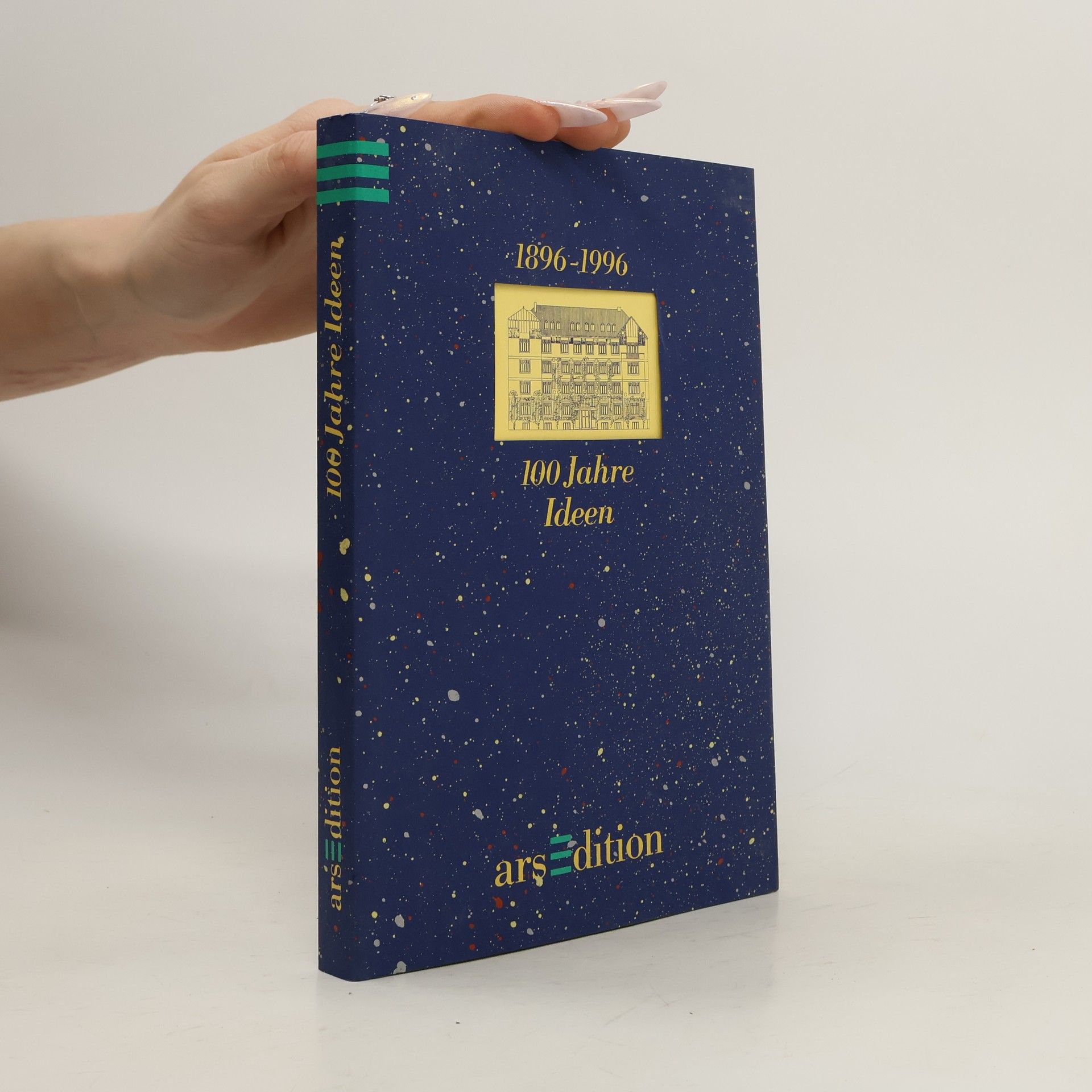
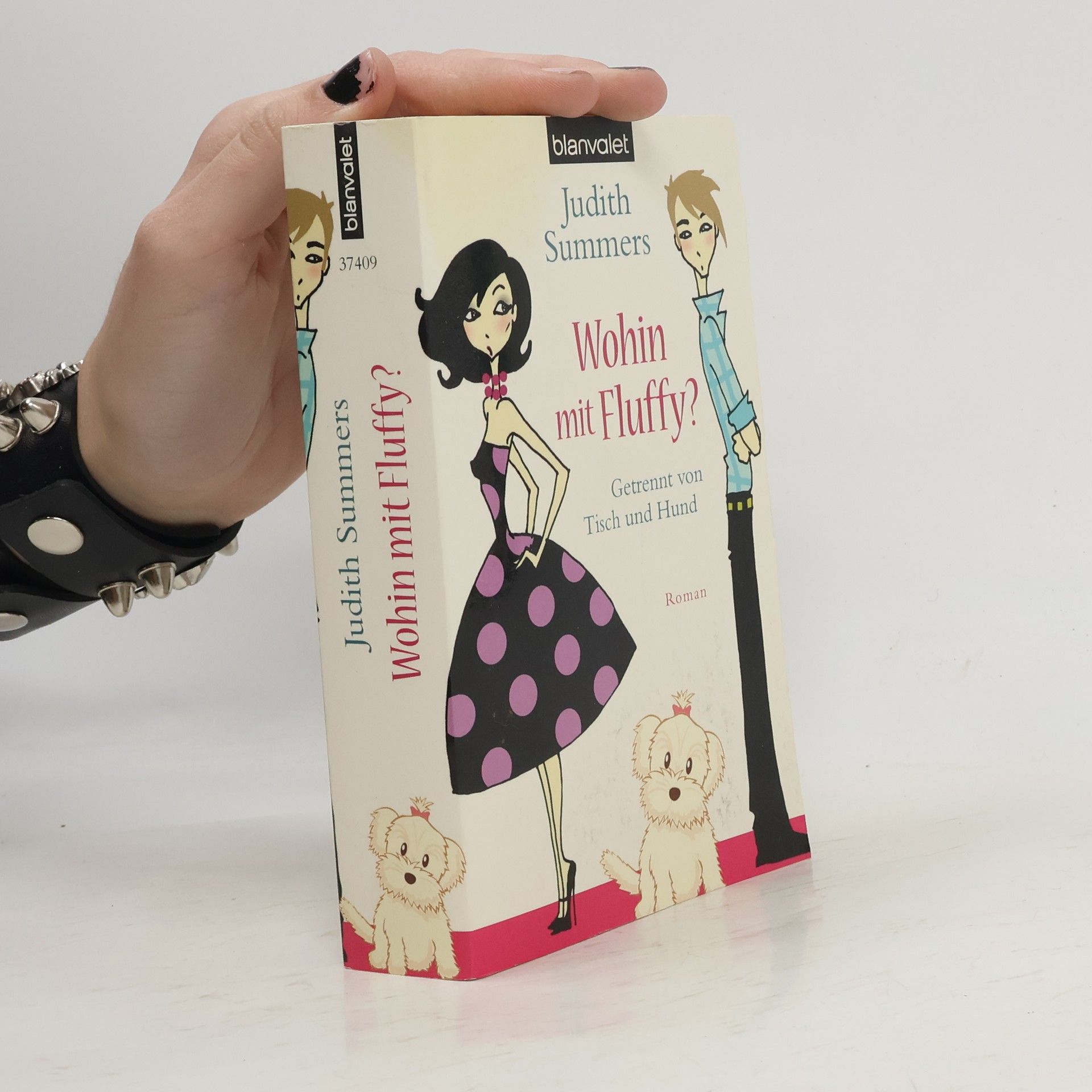
Spielend einschlafen - mit diesem Buch kein Problem! Entspannende Spiele und Gedankenreisen helfen dabei, den Tag abzuschließen und zur Ruhe zu kommen. Neben zahlreichen Spielideen gibt es Tipps und Tricks rund um das Thema „Schlafen“ - von der richtigen Schlafumgebung bis zum Schlummertee. Denn wer nachts gut schläft, dem gelingt der Start in den neuen Tag ganz spielerisch!
Nichts ist langweiliger, als krank im Bett zu liegen! Da hilft am besten eins: Spielen Sie mal wieder! Hier finden Sie abwechslungsreiche und humorvolle Spiel- ideen für Erwachsene, die ganz sicher von Langeweile und Schmerzen ablenken. Mit Wortspielen und Zahlenrätseln, Denk- und Schreibspielen aus dem modernen Alltagsleben verbringt man unterhaltsame Stunden, wenn einem die Tage lang werden - und spielend ist man wieder gesund!