Theorie der Wolke
Für eine Geschichte der Malerei
Hubert Damisch ist ein französischer Philosoph, der sich auf Ästhetik und Kunstgeschichte spezialisiert hat. Seine umfangreichen Werke sind wegweisende Referenzen für eine Theorie der visuellen Repräsentationen und befassen sich mit der Geschichte und Theorie von Malerei, Architektur, Fotografie, Kino, Theater und Museen. Damischs Ansatz zur Kunst basiert auf einem tiefen Verständnis visueller Darstellungen.

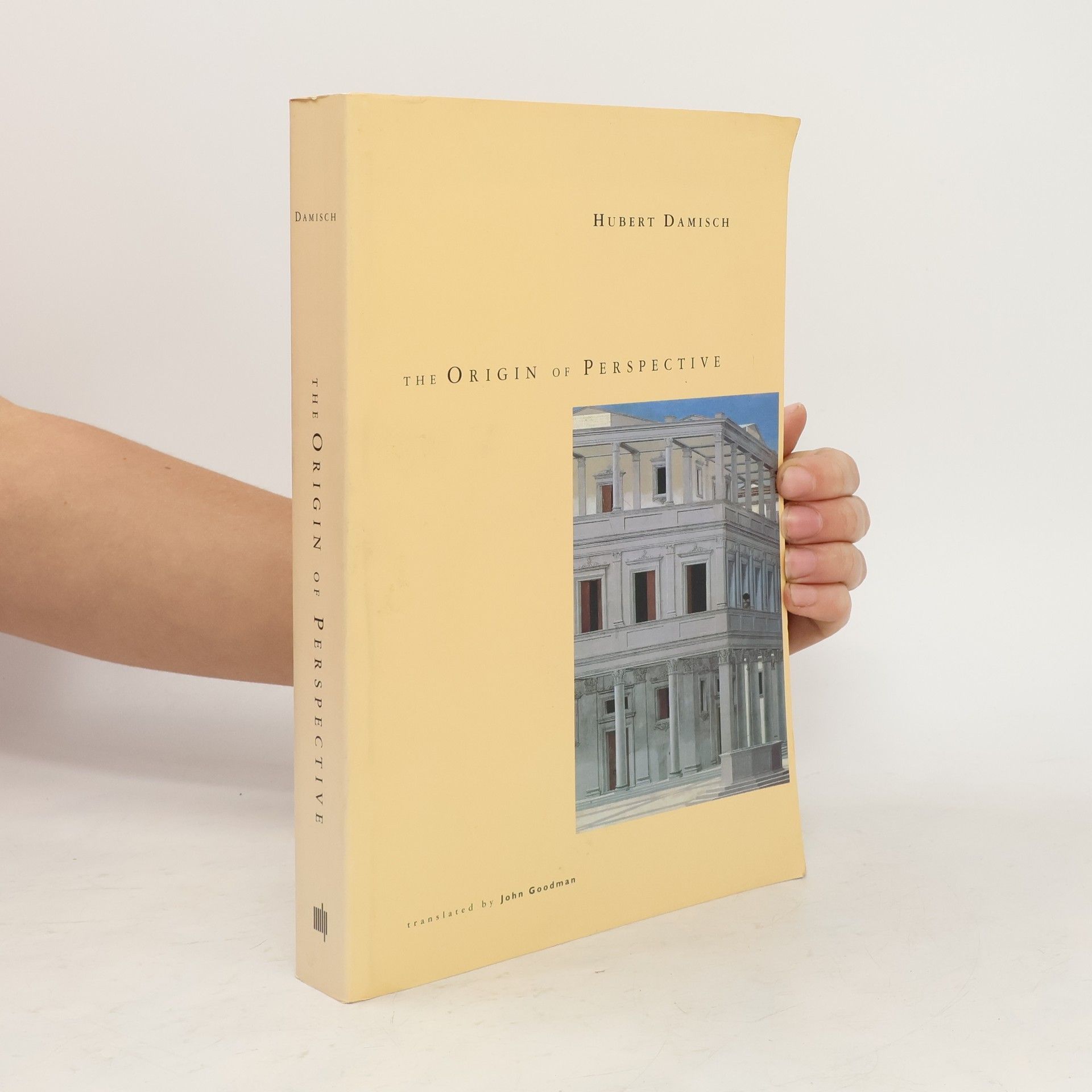

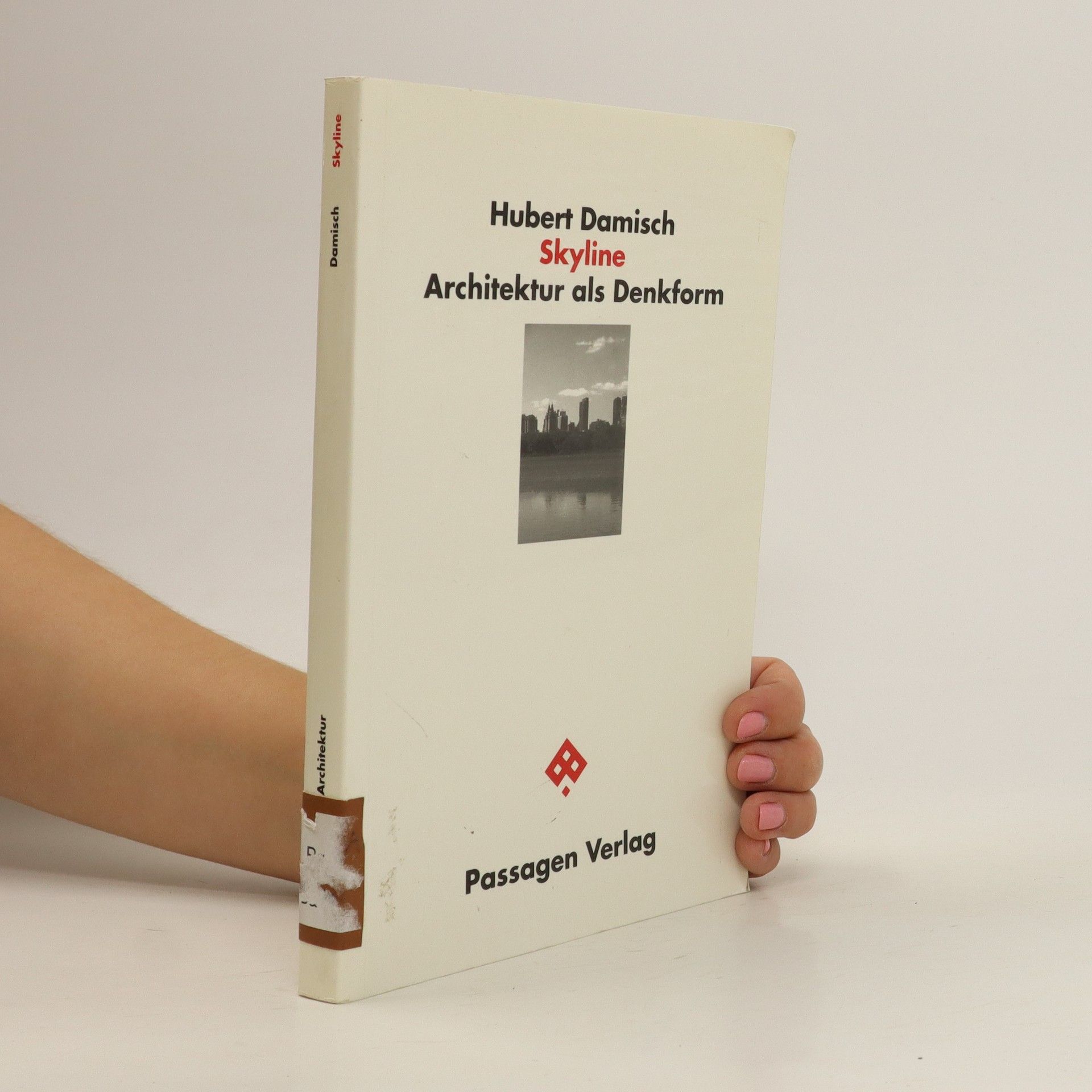
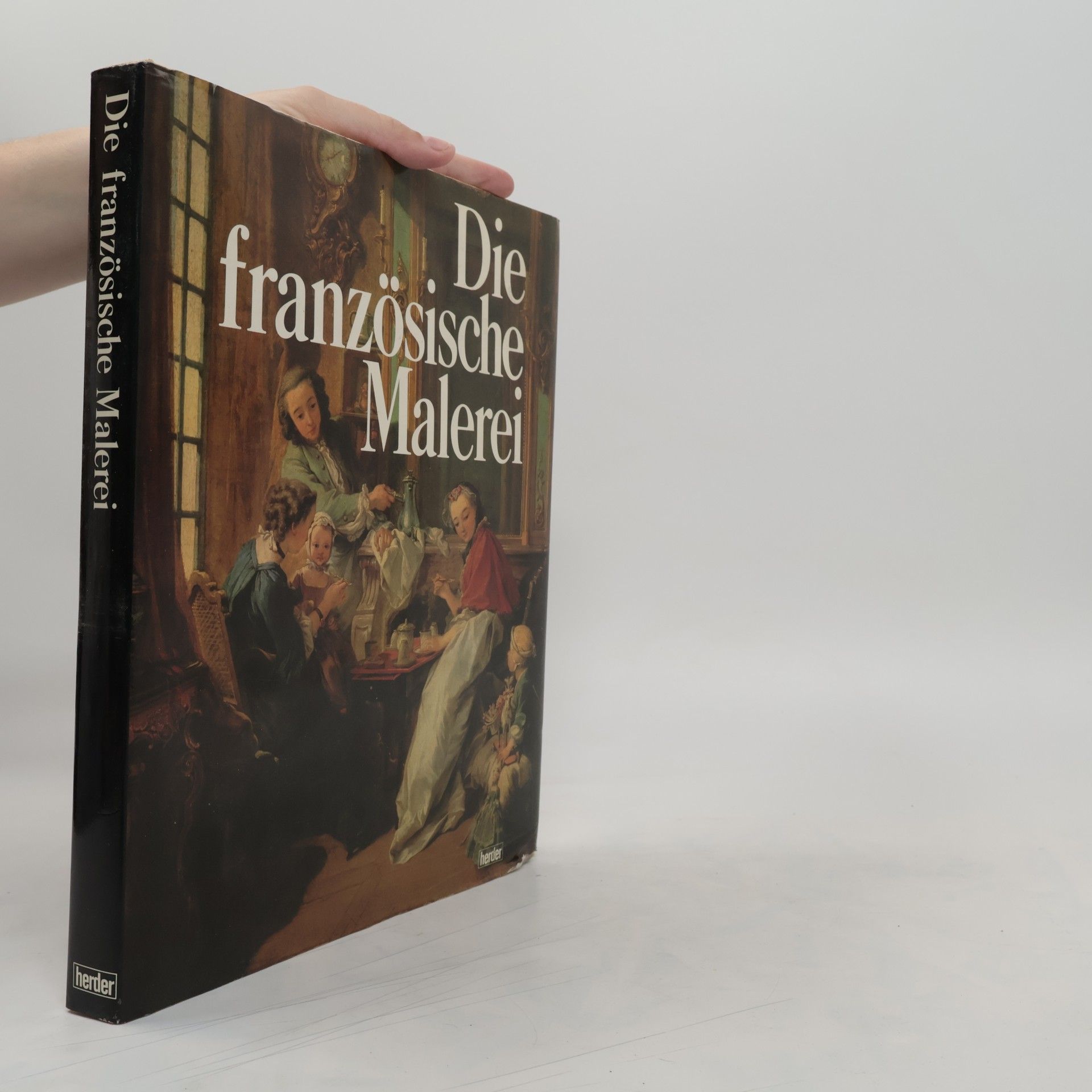

Für eine Geschichte der Malerei
/ / General art / Duits / German / Allemand / Deutsch / hard cover / dust jacket / 21 x 26 cm / 280 .pp /
The second part of the book brings the historical invention of perspective into focus, discussing the experiments with mirrors made by Brunelleschi, connecting it to the history of consciousness via Jacques Lacan's definition of the "tableau" as "a configuration in which the subject as such gets its bearings.".
Obłok wdziera się na niebo zachodniego malarstwa od średniowiecza aż po wiek XIX. Jest nie tyle fragmentem opisu, ile elementem semiotyki obrazu - grafem, którego funkcja zmienia się w zależności od epoki. Za pomocą spisu kolejnych funkcji elementu znaczącego, jakim jest /obłok/, praca Damischa jest próbą krytycznego spojrzenia na zadania i role przypisywane sztuce, nauce i ideologii w strukturze przedstawienia: przyczynkiem do przywrócenia historii sztuki jej systematycznego i materialistycznego wymiaru.
Extrait : Louroux, mardi 3 septembre 1822[1]. — Je mets à exécution le projet formé tant de fois d’écrire un journal. Ce que je désire le plus vivement, c’est de ne pas perdre de vue que je l’écris pour moi seul. Je serai donc vrai, je l’espère ; j’en deviendrai meilleur. Ce papier me reprochera mes variations. Je le commence dans d’heureuses dispositions. Je suis chez mon frère ; il est neuf heures ou dix heures du soir qui viennent de sonner à l’horloge du Louroux. Je me suis assis cinq minutes au clair de lune, sur le petit banc qui est devant ma porte, pour tâcher de me recueillir ; mais quoique je sois heureux aujourd’hui, je ne retrouve pas les sensations d’hier soir… C’était pleine lune. Assis sur le banc qui est contre la maison de mon frère, j’ai goûté des heures délicieuses... Justificatif : Eugène Delacroix (1798-1863) a écrit "Journal" entre 1857 et 1863. http://catalogue.bnf.fr/servlet/bibli...