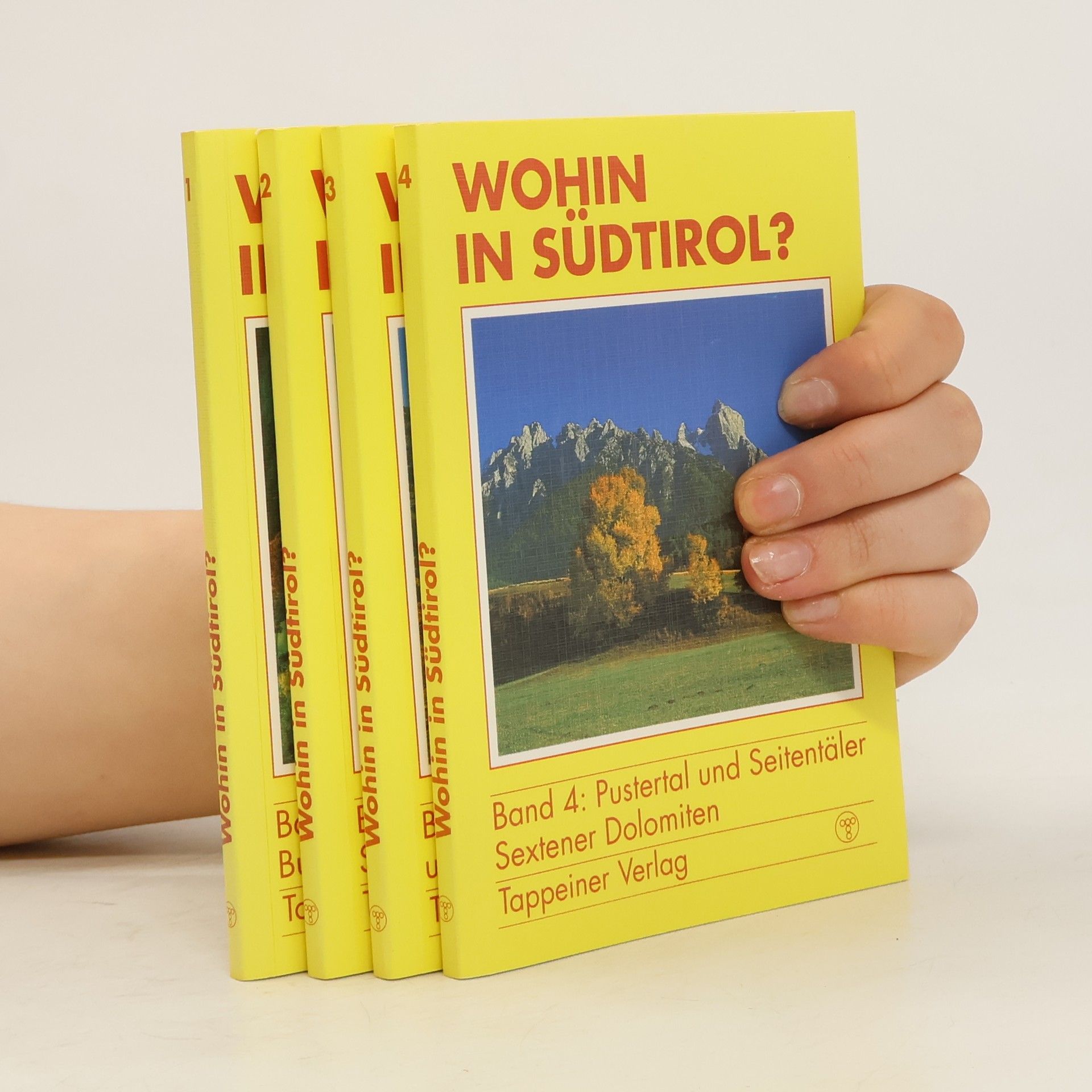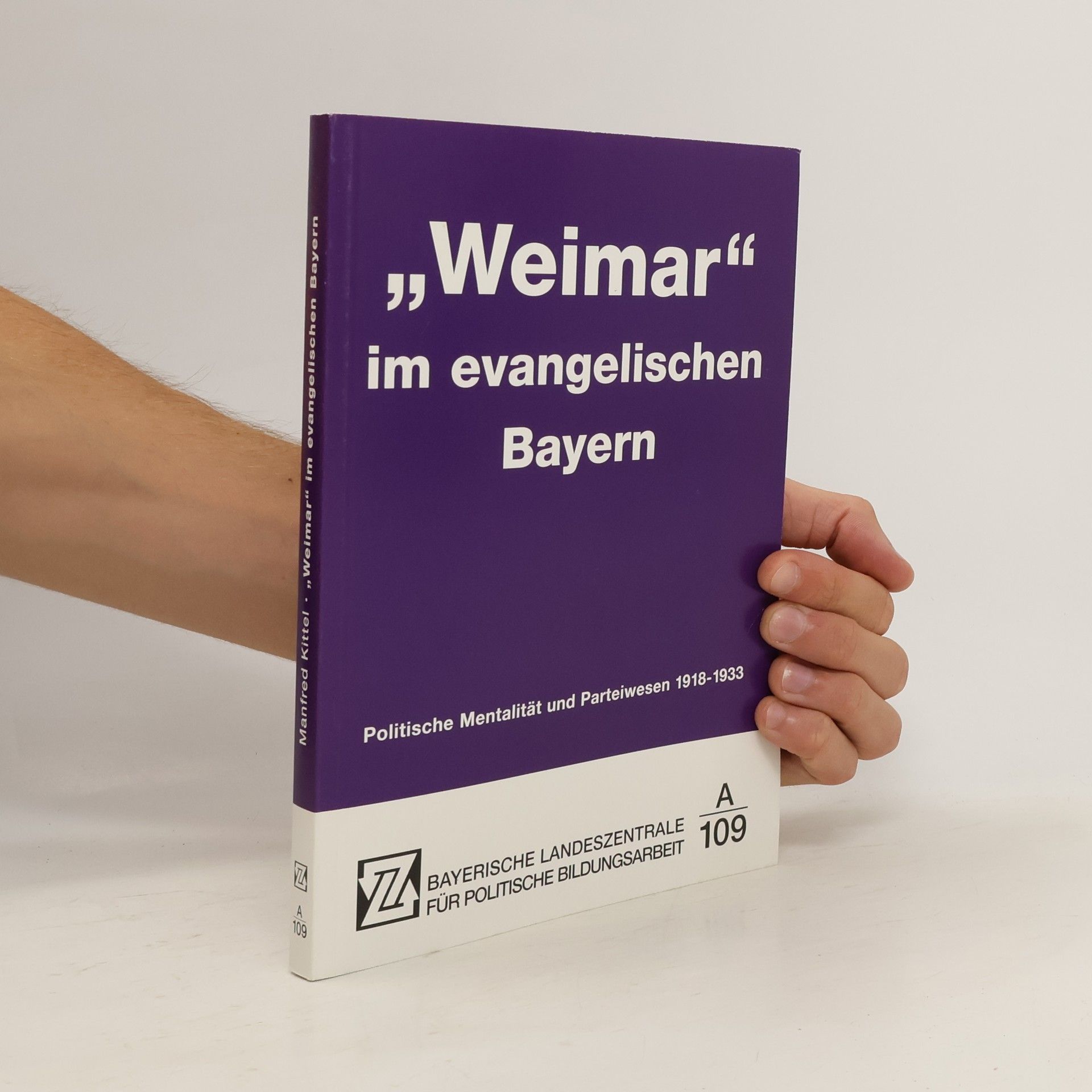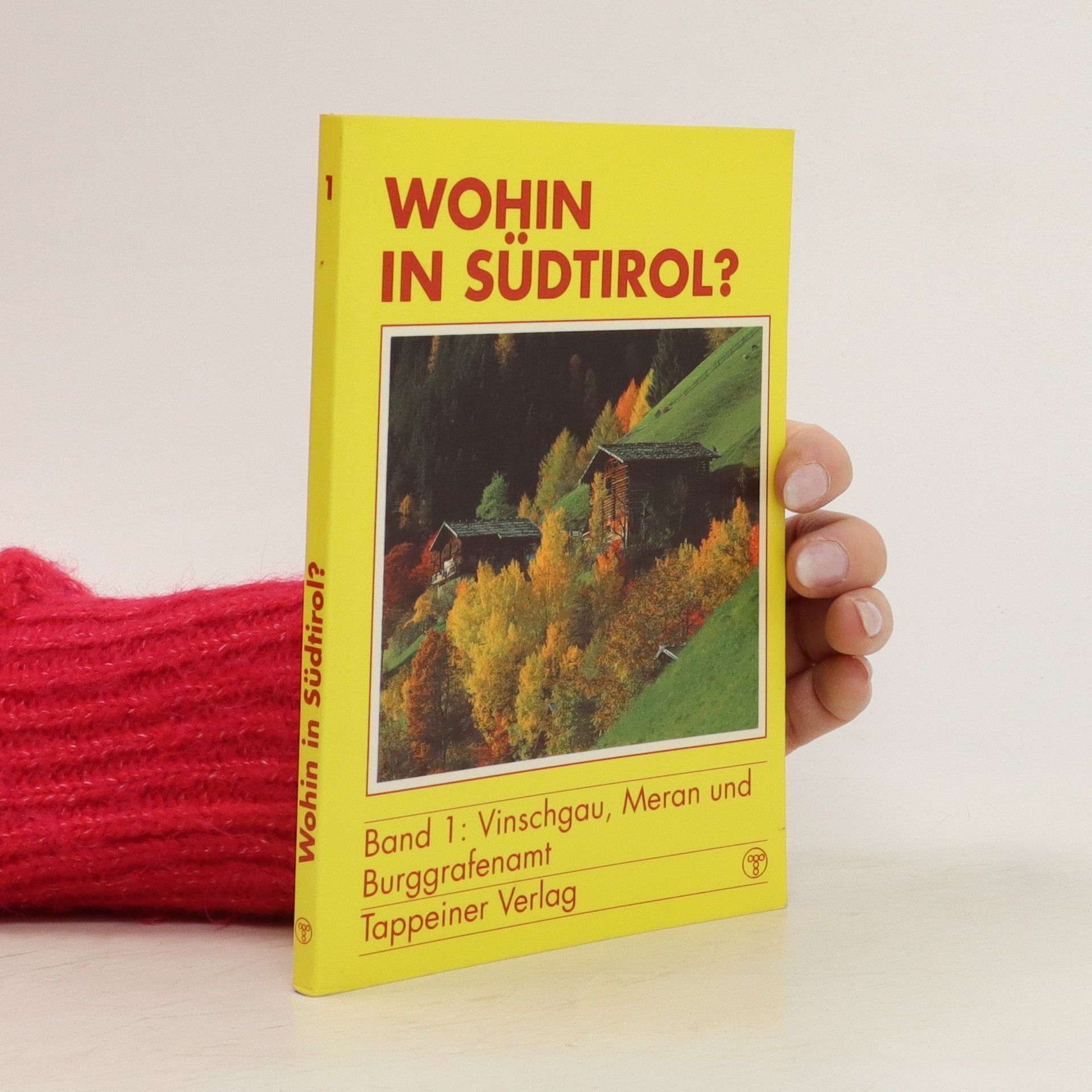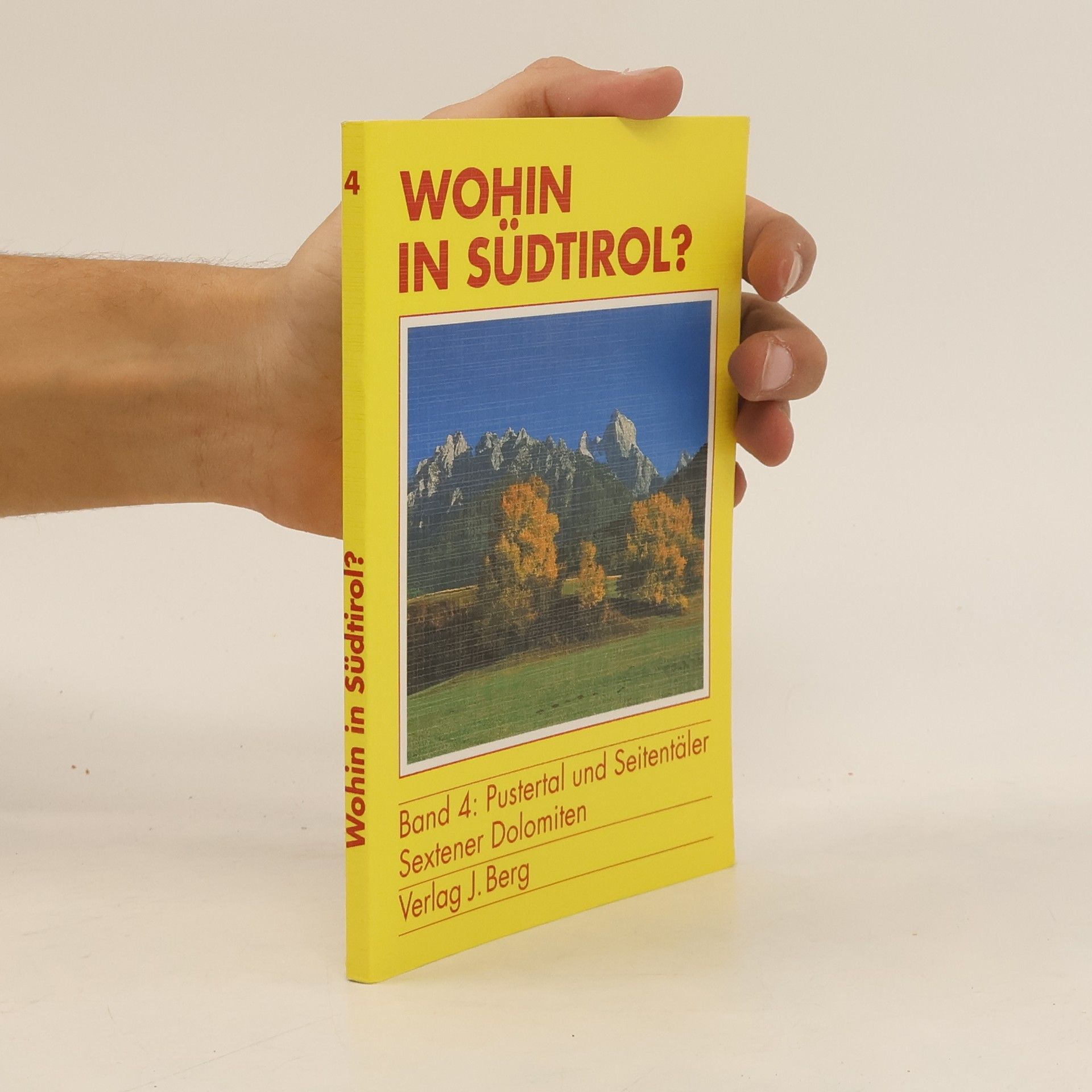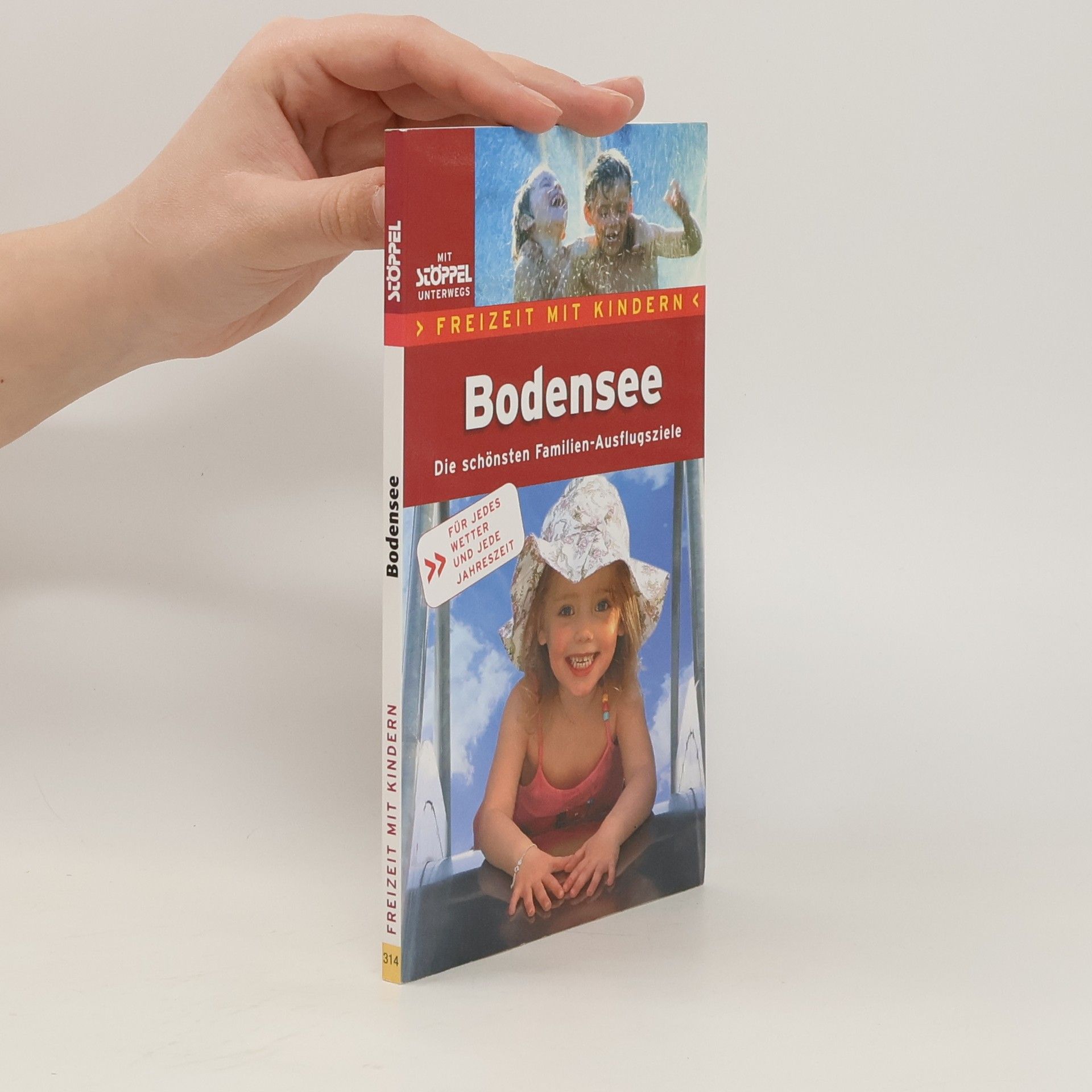Nach Nürnberg und Tokio
"Vergangenheitsbewältigung" in Japan und Westdeutschland 1945 bis 1968
Nach dem Zweiten Weltkrieg standen in Nürnberg und Tokio die Hauptvertreter des Nationalsozialismus und des japanischen Ultranationalismus vor Gericht und mussten sich für die von beiden Diktaturen begangenen Massenverbrechen verantworten. Japan hatte es jedoch schwerer als Westdeutschland, seine Vergangenheit zu bewältigen. Dies lag nicht nur daran, dass die Verbrechen teilweise schwer vergleichbar waren und der Tennô in Tokio nicht angeklagt wurde. Vielmehr konnten die Japaner nach dem Schock der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki einen Opferstatus reklamieren, der ihre eigenen Verbrechen lange Zeit in den Hintergrund drängte. Im Gegensatz dazu blieb den Deutschen, trotz Bombenkrieg und Vertreibung, eine solche Ausflucht verwehrt. Zudem war Japan als von den USA unterstütztes Bollwerk gegen den ostasiatischen Kommunismus einem geringeren äußeren Druck ausgesetzt als die in internationale Wirtschafts- und Verteidigungsgemeinschaften eingebundene Bundesrepublik. Manfred Kittel untersucht die Rolle innerer Kräfte – der konservativen Regierung, der linken Opposition, der Medien und der Geschichtswissenschaft – im Umgang mit der Vergangenheit: bei der Ahndung von Kriegsverbrechen, der Wiedergutmachung für Opfer und der Entwicklung der politischen Kultur in einer shintôistisch bzw. protestantisch geprägten Erinnerungslandschaft bis hin zur Studentenbewegung der 1960er Jahre.