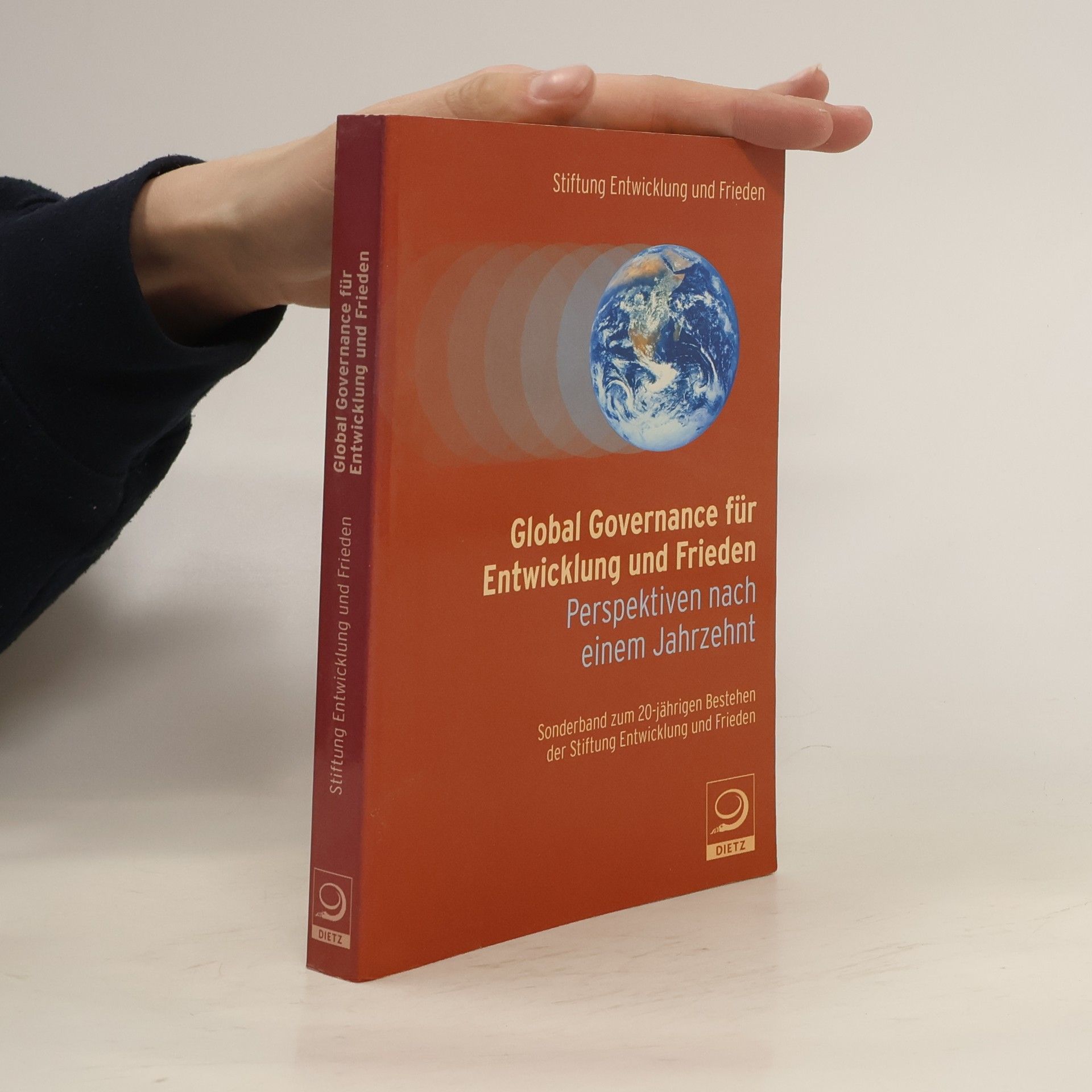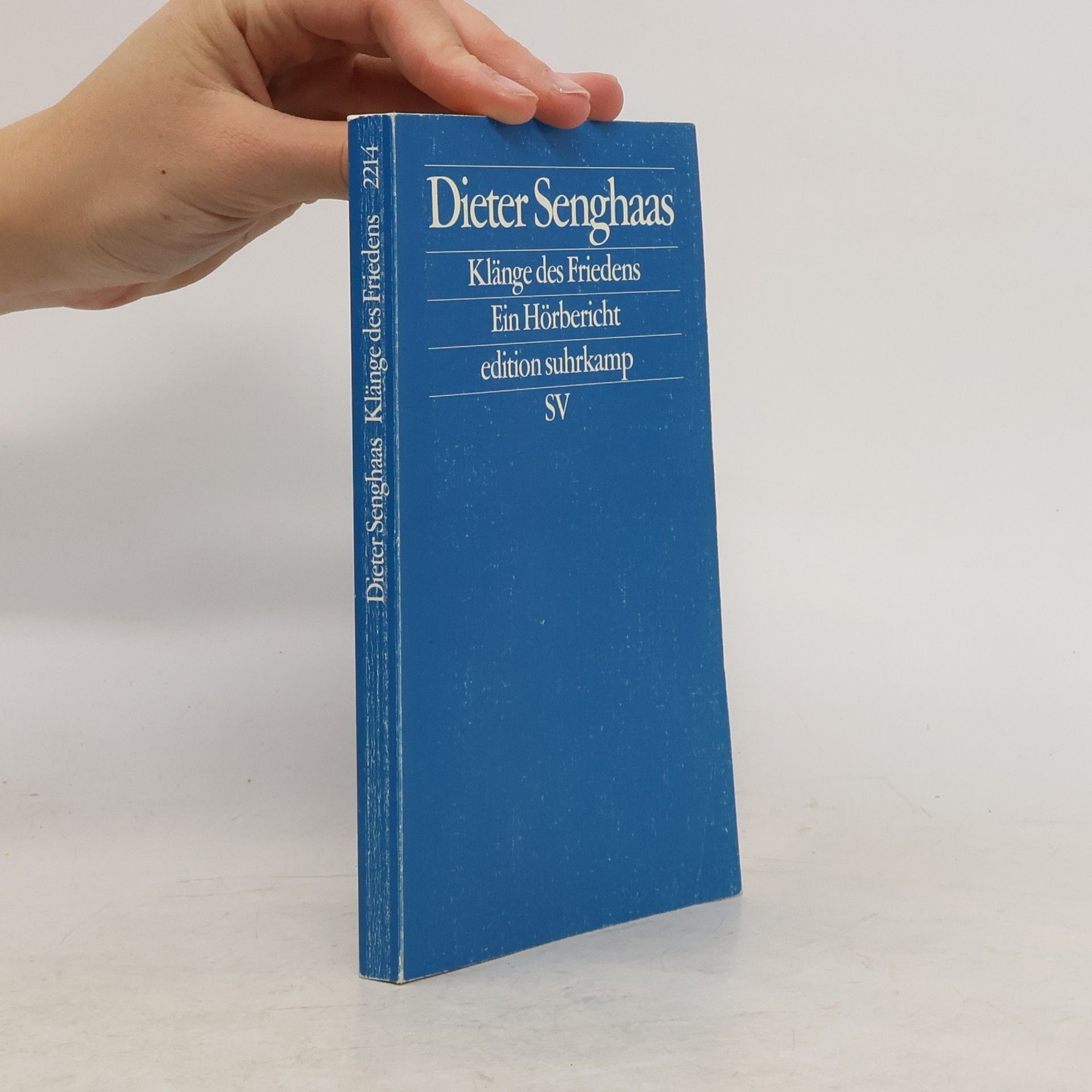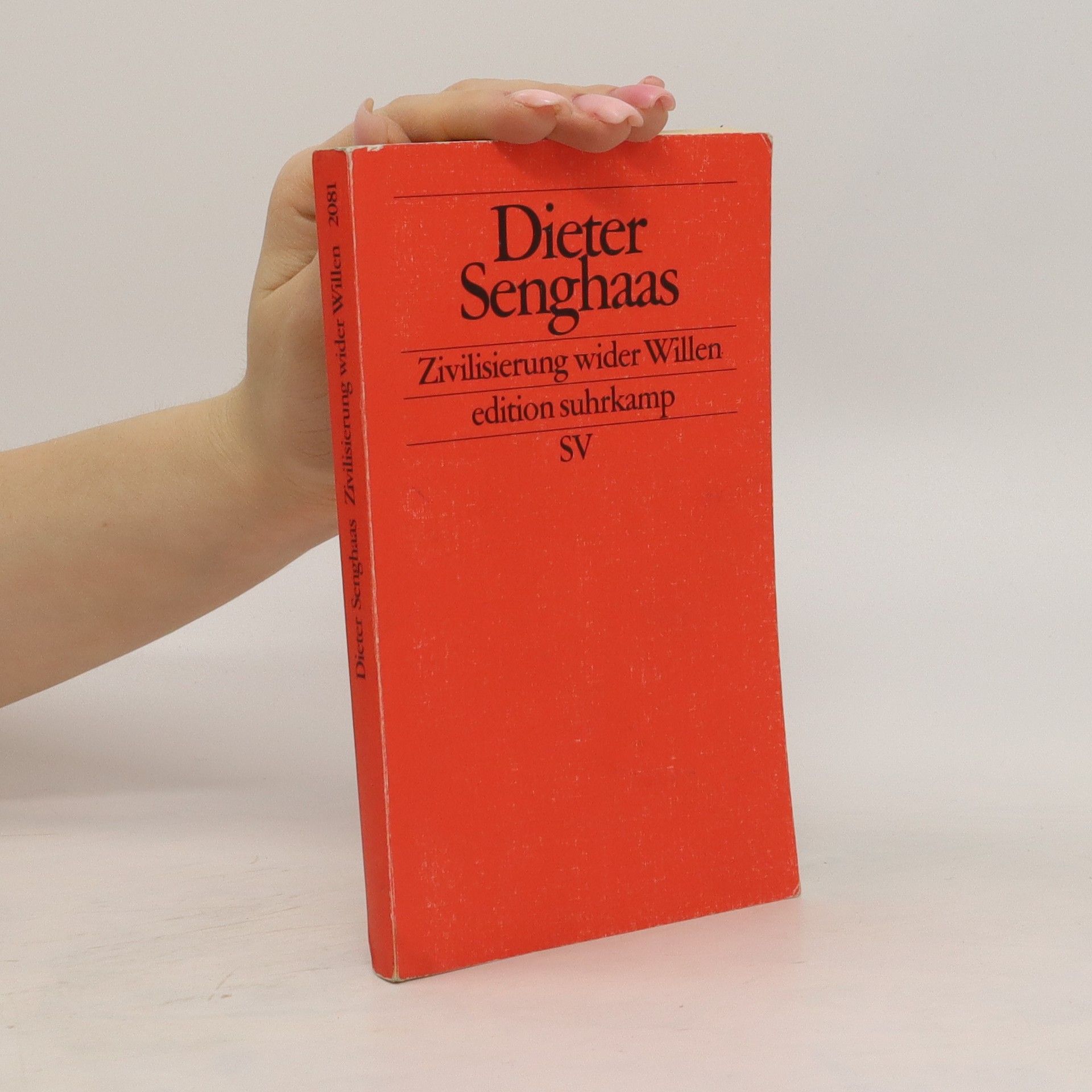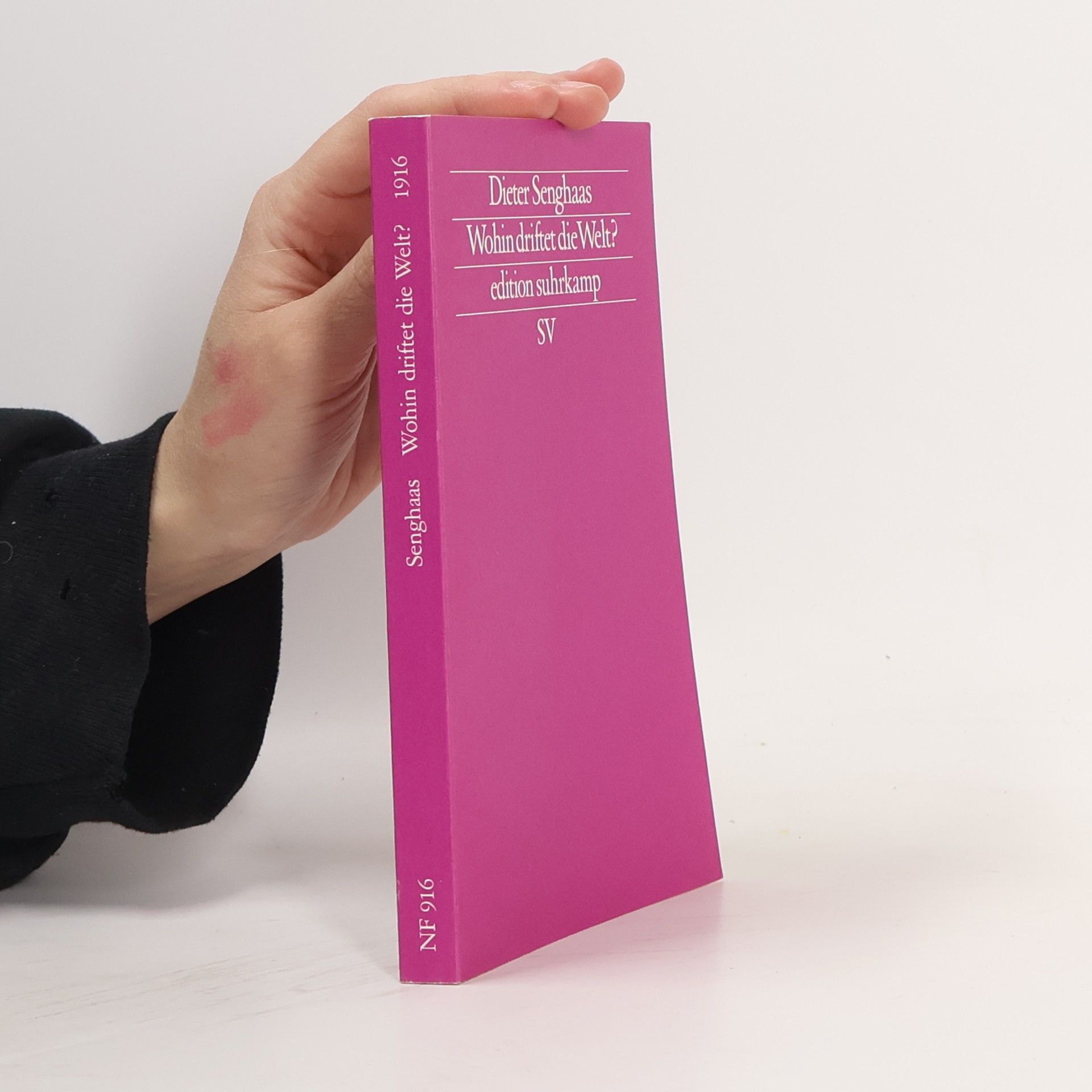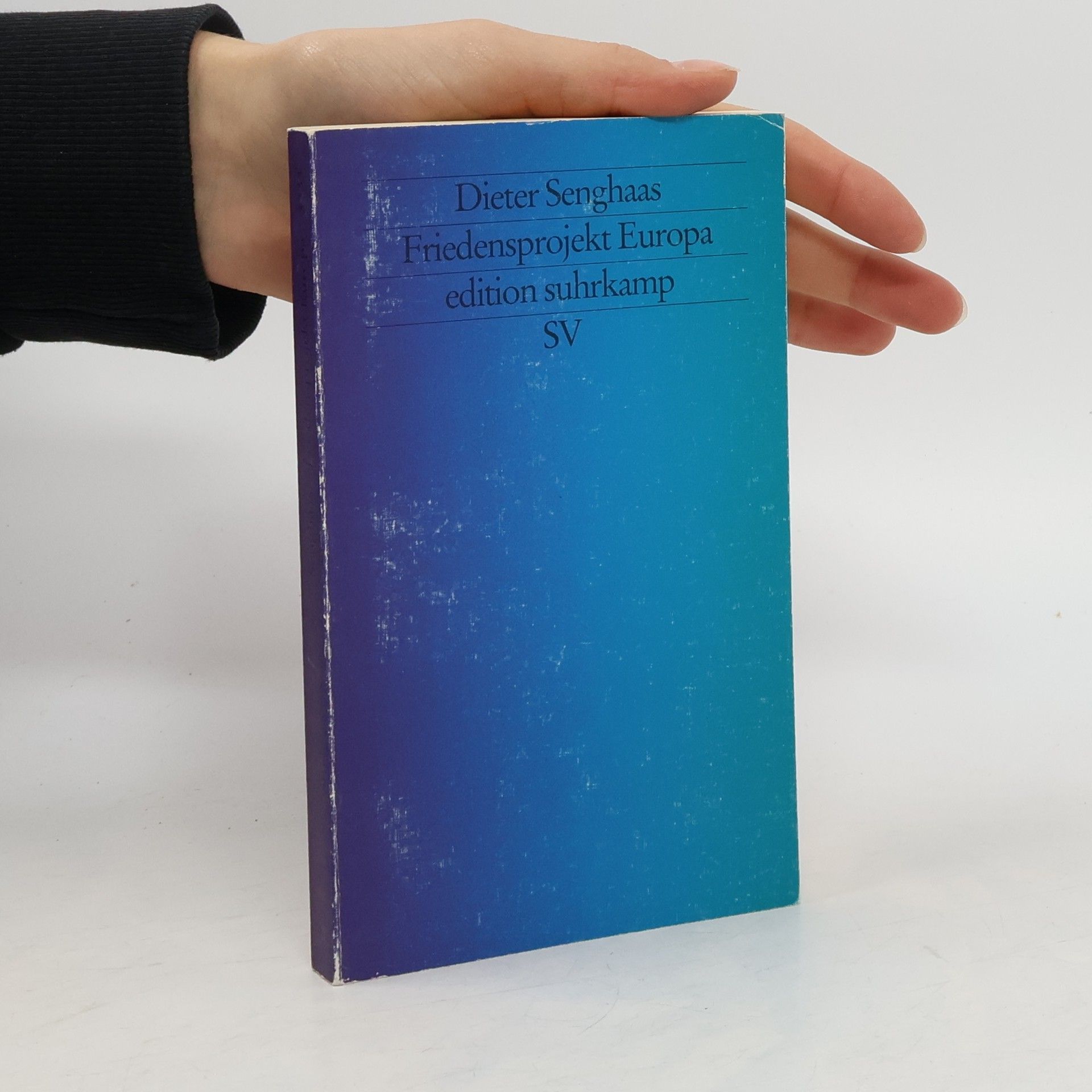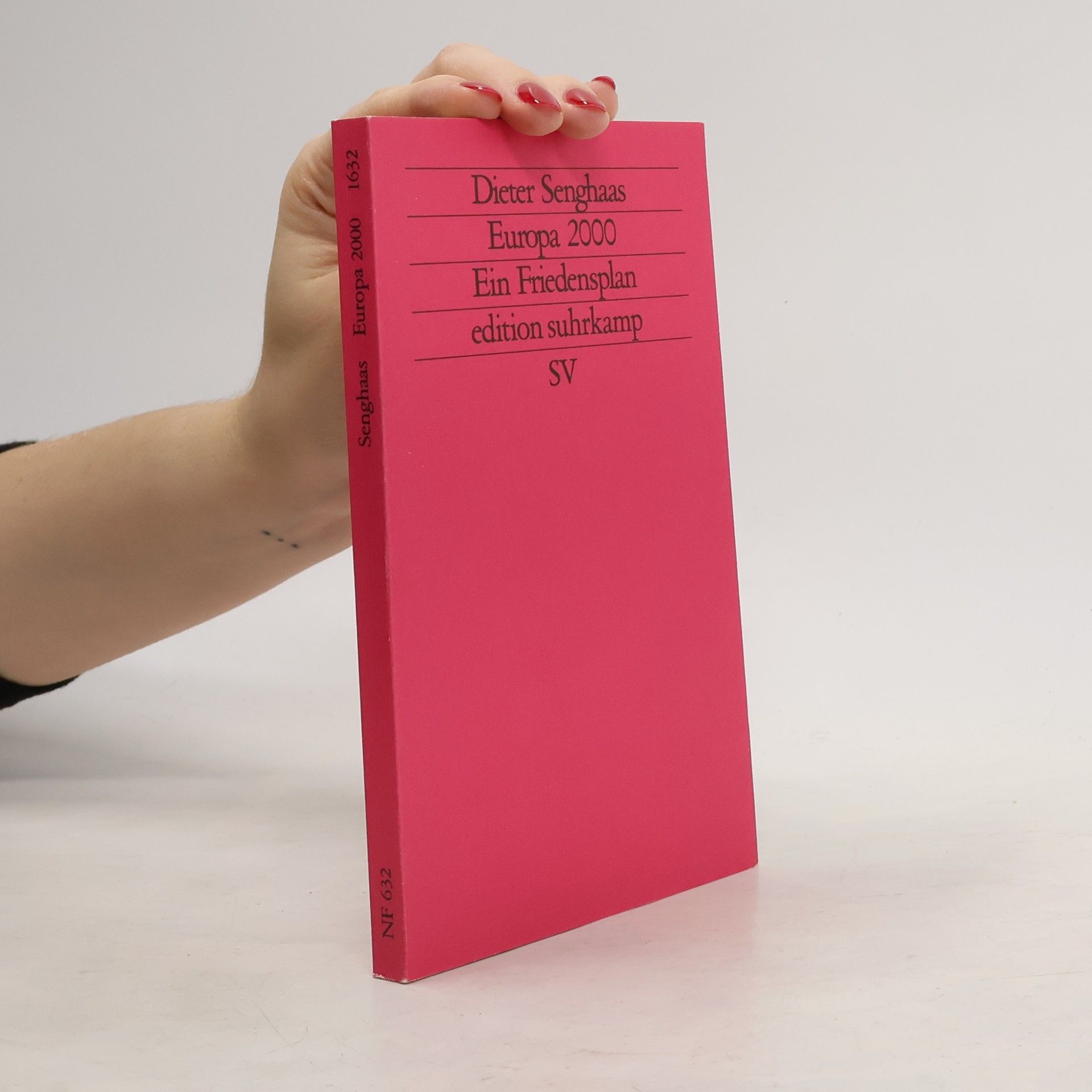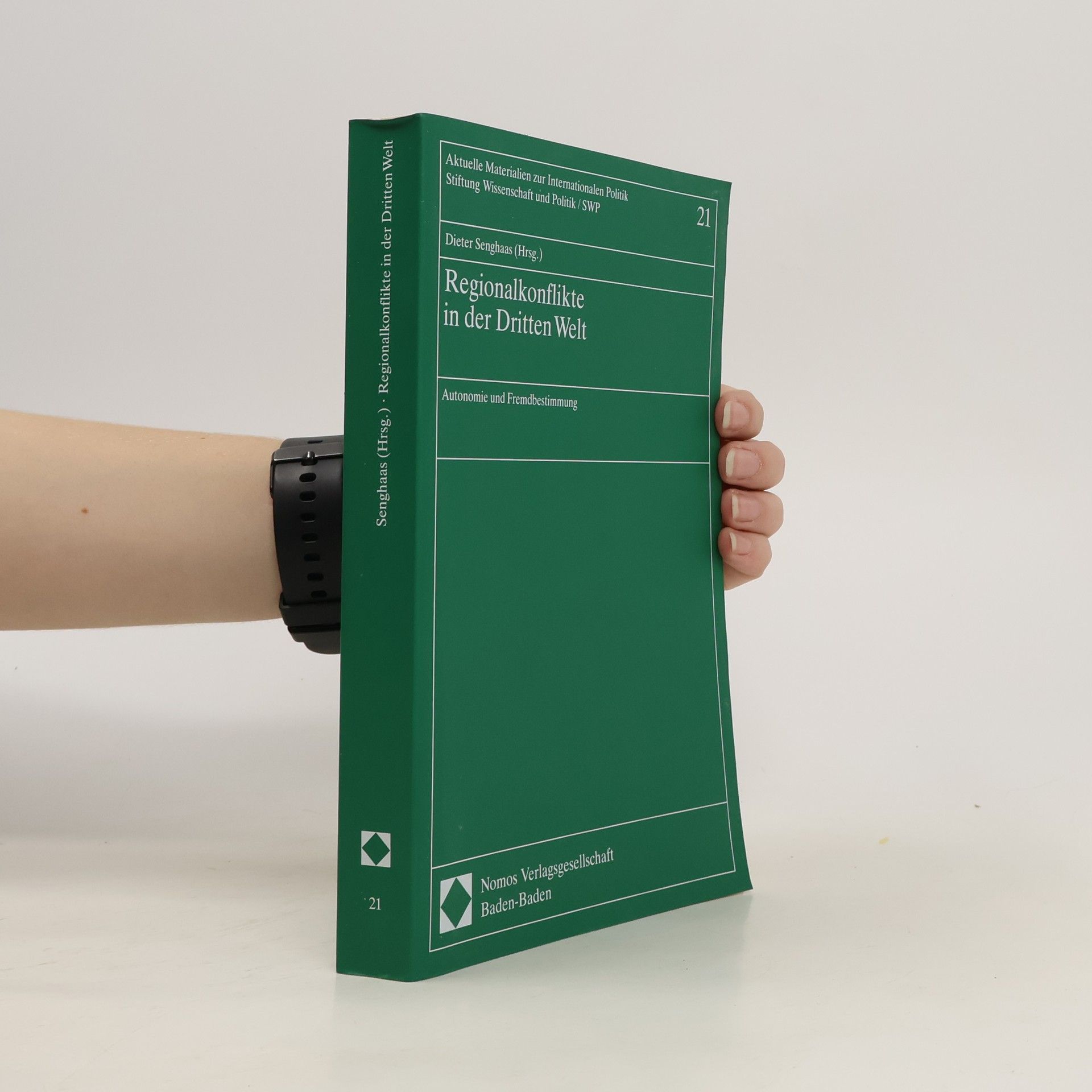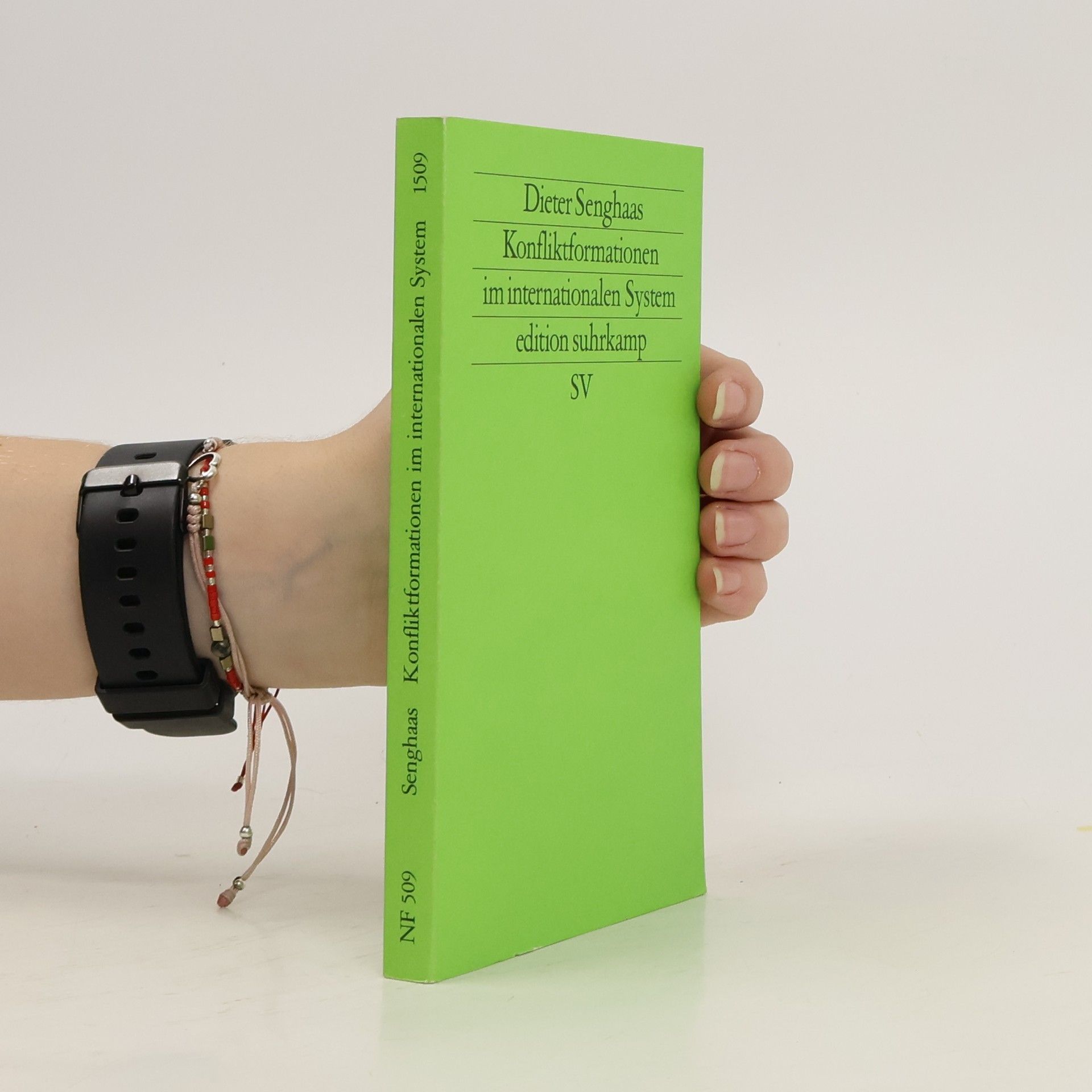Die Struktur der Welt ist durch extreme Hierarchisierung und Abschichtung geprägt, was sich in verschiedenen Dimensionen zeigt. Im Weltwirtschaftssystem klafft eine dramatische Kluft zwischen der OECD-Welt und dem »Rest der Welt«. Während die OECD-Welt eng und relativ symmetrisch vernetzt ist, bleibt der Rest asymmetrisch auf dieses Zentrum ausgerichtet. Dieses politisch dominierende Zentrum, das etwa 16 Prozent der Weltbevölkerung ausmacht, hat kein vergleichbar koordiniertes Machtzentrum als Gegenüber. Auch innerhalb der Nicht-OECD-Welt sind die Zerklüftungen deutlich: Rund zehn Prozent der Weltbevölkerung leben in Staaten, die zusammengebrochen sind oder kurz vor dem Zerfall stehen. 37 Prozent der Menschen leben in China und Indien, während weitere 37 Prozent in etwa 130 Gesellschaften mit begrenzter Staatlichkeit leben. Programmatiken über Weltordnung müssen sich mit diesen grundlegenden Realitäten auseinandersetzen, um nicht abstrakt und analytisch fragwürdig zu bleiben. Eine echte Auseinandersetzung mit der globalen Realität erfordert eine problemadäquate Kontextualisierung der Weltordnungsansätze.
Dieter Senghaas Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
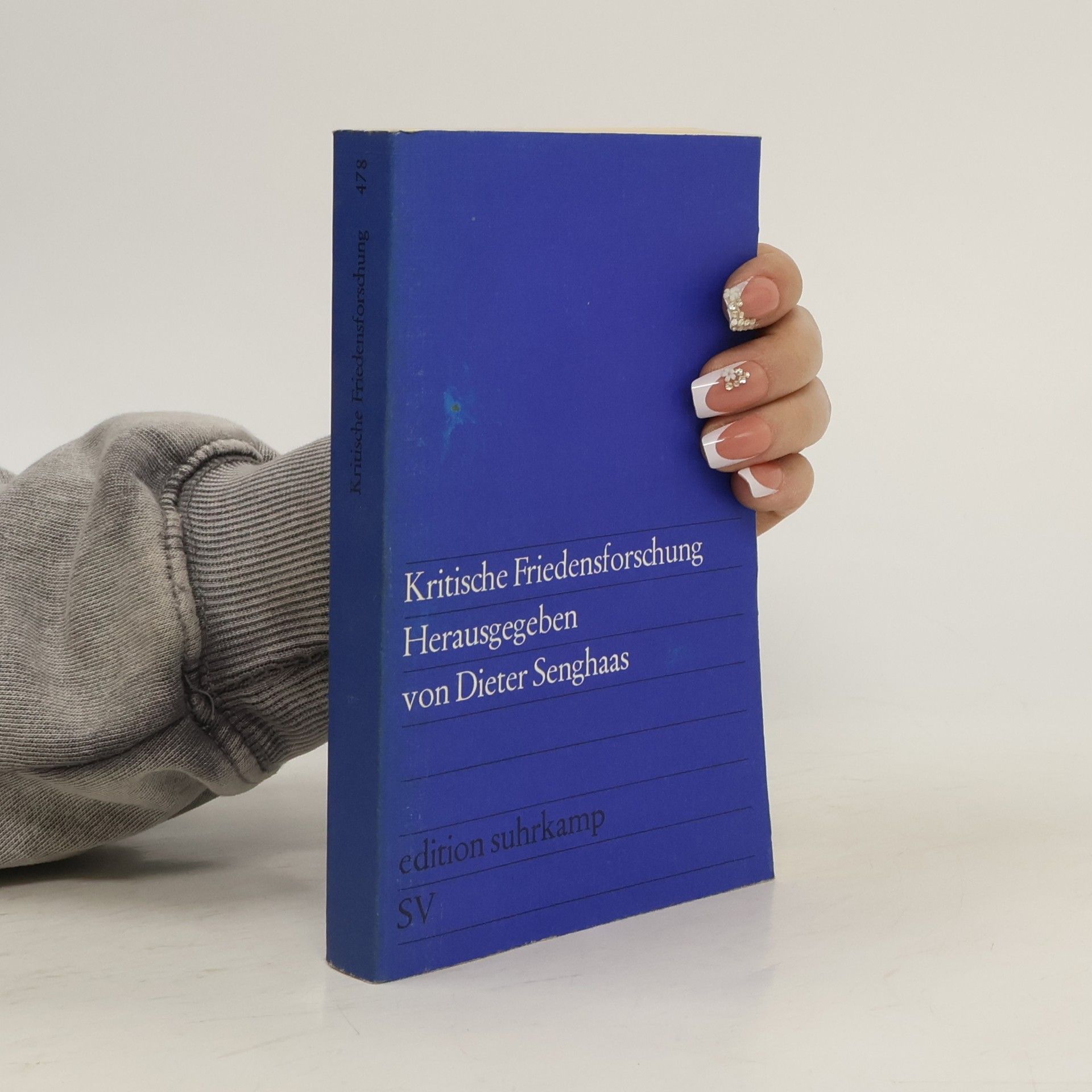
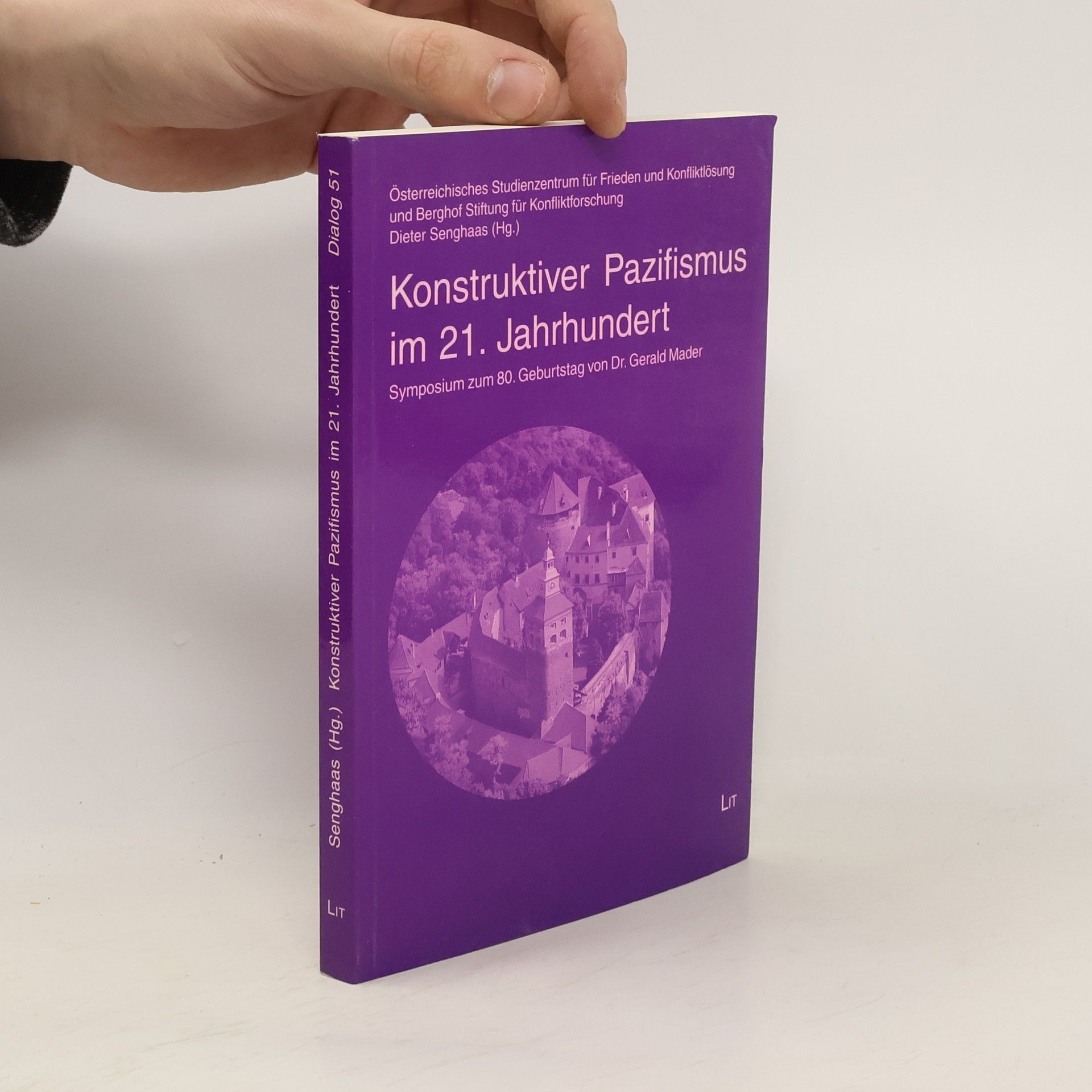
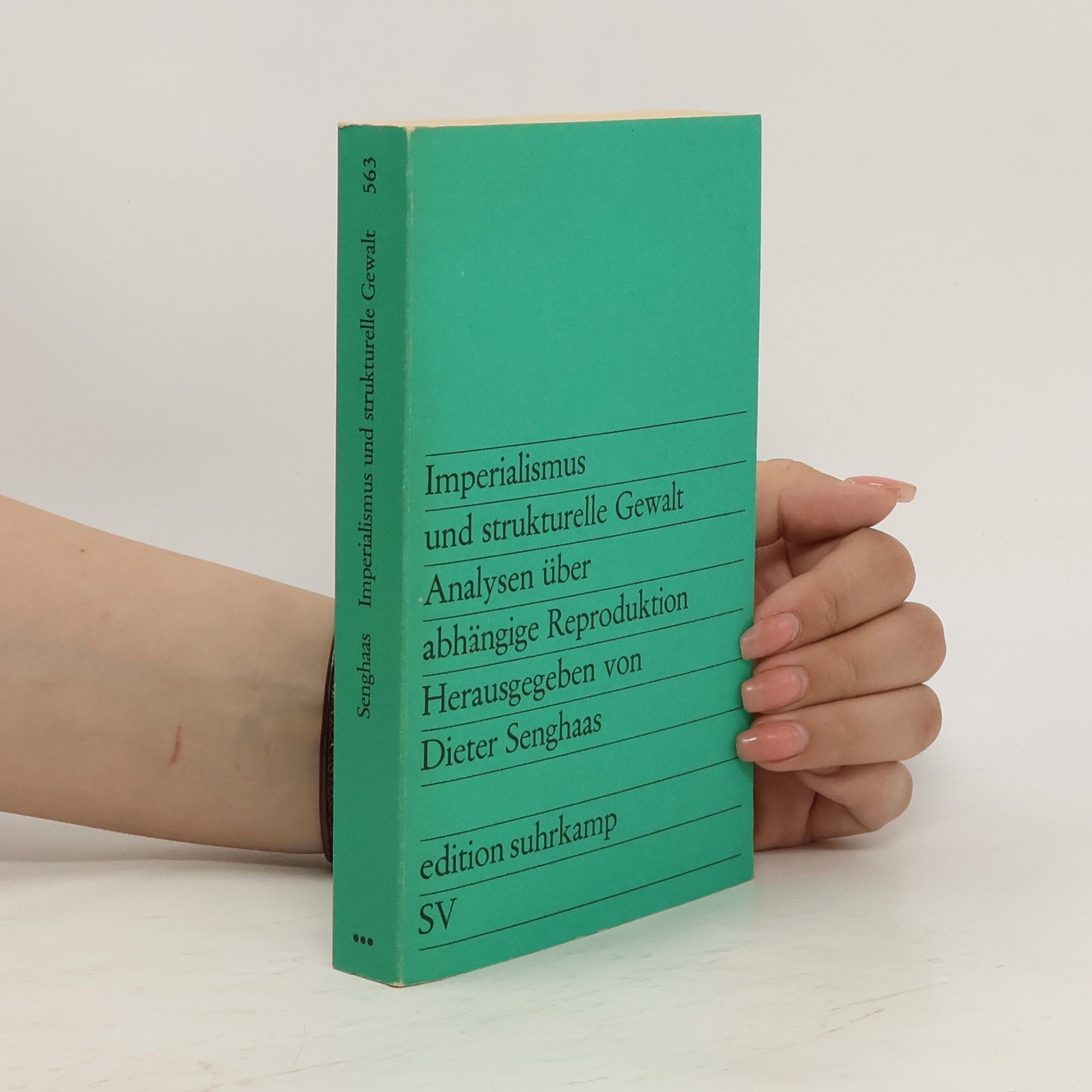
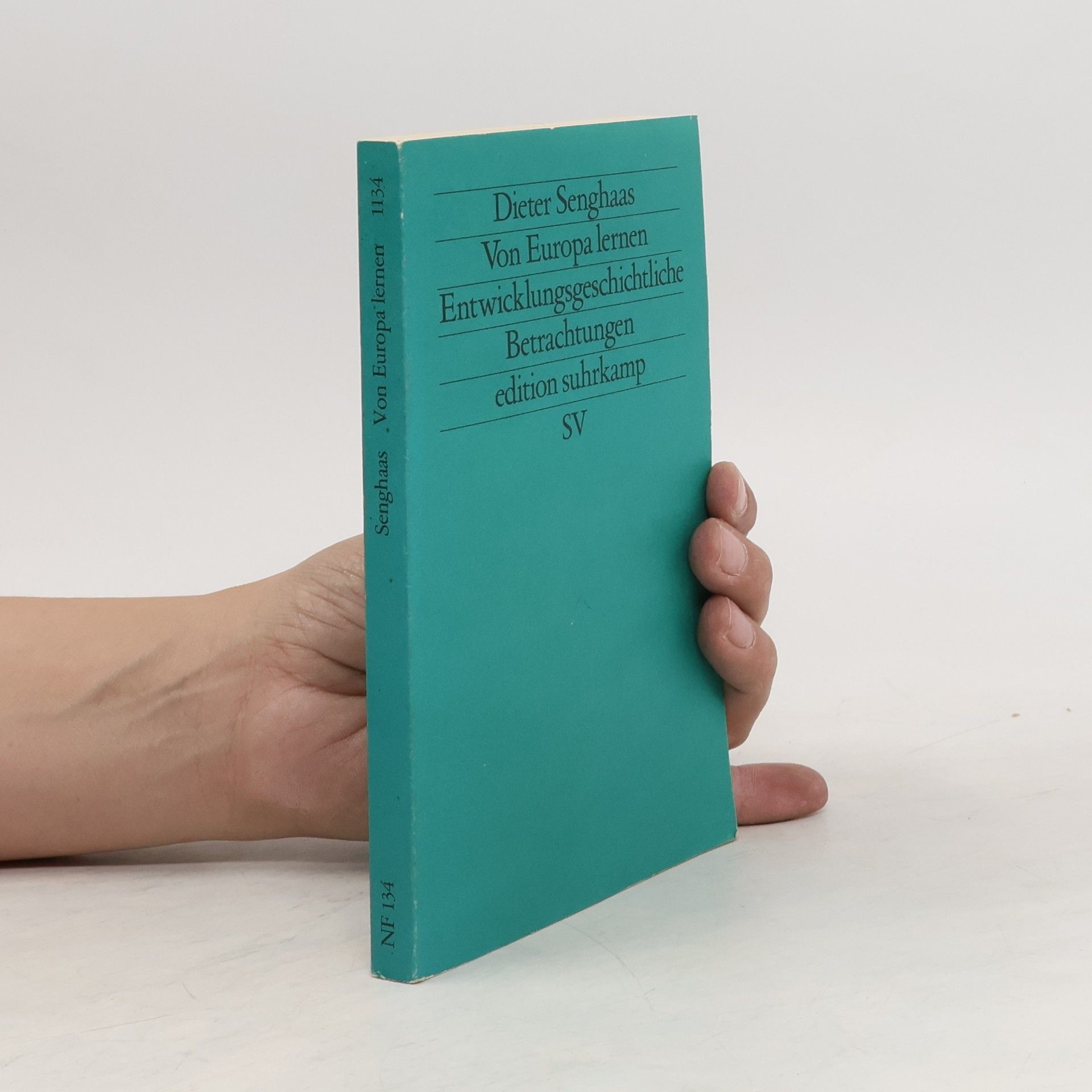
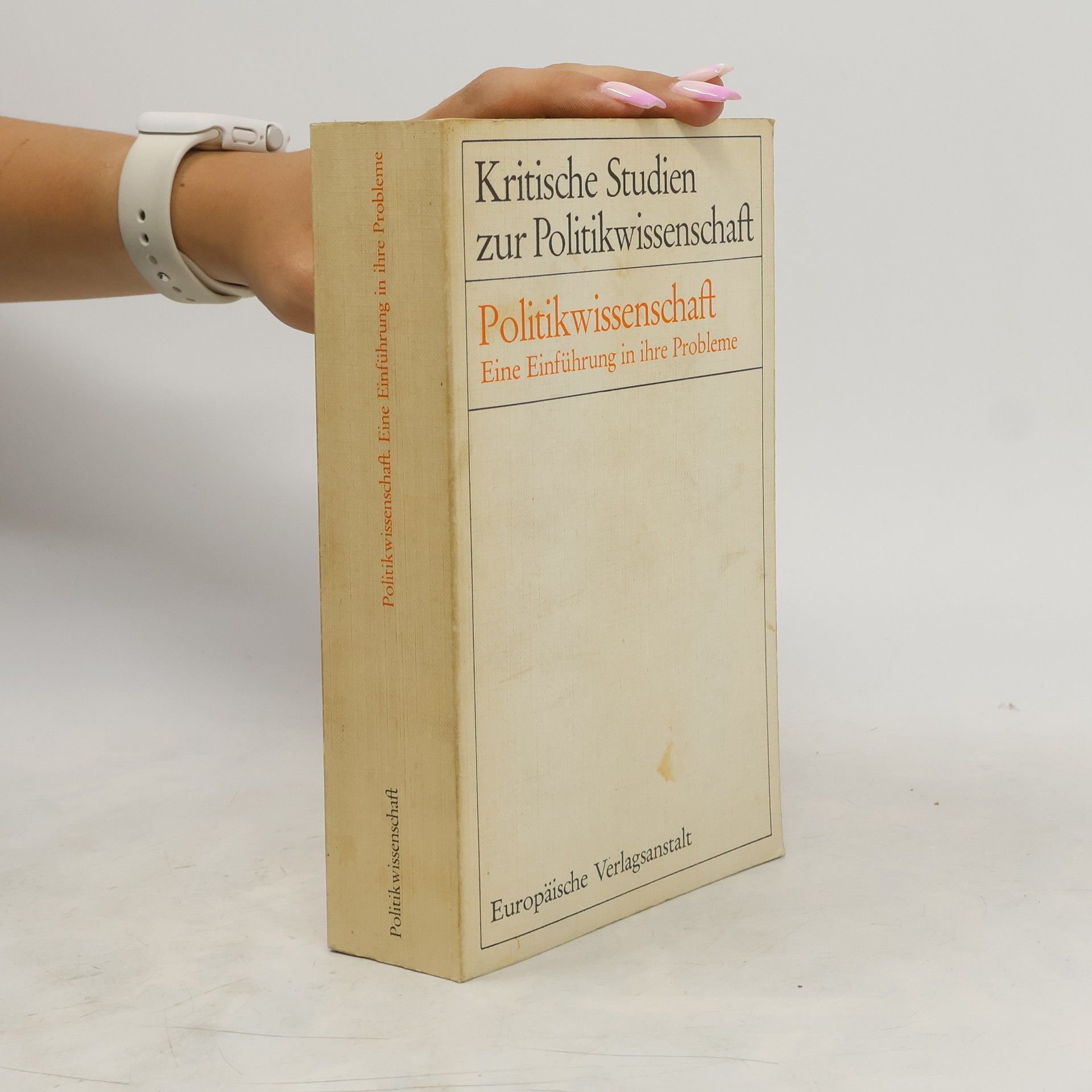

Die Stiftung Entwicklung und Frieden setzt sich seit Mitte der 1990er Jahre für eine Neugestaltung der globalen politischen Ordnung ein: Global Governance wurde zum Leitmotiv der Stiftungsarbeit. Was sind die Ergebnisse dieser Arbeit, und welche Herausforderungen stellen sich in der Zukunft? Die heutige Welt wird immer mehr von Globalisierung geprägt. In der Folge droht überdies ein Verlust an demokratisch fundierter Politik. Die Stiftung Entwicklung und Frieden will Wege für eine Neugestaltung der globalen Ordnung aufzeigen, die menschenwürdige Entwicklung und die Zivilisierung der internationalen Beziehungen ermöglicht. Ihre Aktivitäten sind durch das Global Governance-Konzept und seine Weiterentwicklung auch im Hinblick auf die politische Umsetzbarkeit geprägt. Zu ihrem 20-jährigen Bestehen zieht die Stiftung eine vorläufige Bilanz. Im ersten Teil des Buches dokumentieren Dirk Messner und Franz Nuscheler aus der Innenperspektive den derzeitigen Diskussionsstand über Global Governance. Im zweiten Teil werden die Arbeitsergebnisse der Stiftung aus der Außenperspektive „stiftungsfremder“ Wissenschaftler dahingehend untersucht, inwieweit sich aus ihnen ein umfassendes Global Governance-Modell ableiten lässt und welche Defizite und offene „Baustellen“ sich für eine künftige Bearbeitung aufdrängen.
Seit jeher ließen sich Komponisten angesichts der brutalen Wirklichkeit des Krieges und im Hinblick auf Friedenshoffnungen zu ganz unterschiedlich gearteten Klängen des Friedens inspirieren. Erstmals werden in diesem Buch diese Angebote unter systematischen Gesichtspunkten zusammengetragen und interpretiert. Dabei zeigt sich eine erstaunliche thematische Breite. Sie reicht von Kompositionen der Vorahnung kommenden Unheils bis zu Werken, die die Fülle des Friedens musikalisch darstellen wollen. In einem publizistisch weithin unbearbeitet gebliebenen Themenbereich bietet dieses Buch eine Orientierungshilfe beim Versuch, sich der Friedensproblematik auf ungewöhnliche Weise anzunähern.
Die Transformation traditioneller in moderne Gesellschaften ist ein globaler Prozess, der vielfältige Identitäten und Interessen hervorbringt. Gesellschaften zerfallen, was im Extremfall zu Bürgerkriegen führt. Koexistenz wird zur zentralen Forderung für ein zivilisiertes Zusammenleben, das als Ergebnis eines kollektiven Lernprozesses verstanden werden kann. In zerklüfteten Gesellschaften sind politisierte Identitäten jedoch oft auf hegemoniale Machtansprüche ausgerichtet, wodurch Intoleranz vorherrscht. Diese Problematik wird in traditionellen Kulturen nicht thematisiert, da die Anforderungen der Modernisierung im Widerspruch zu traditionellen Werten stehen. Modernisierungsprozesse führen zu tiefgreifenden Kulturkonflikten, wie am Beispiel der westlichen Welt zu erkennen ist, die erst durch einen langwierigen Zivilisierungsprozess gelernt hat, Koexistenz zu akzeptieren. Diese Herausforderung ist mittlerweile nicht mehr nur europäisch, sondern global. Der Konflikt zwischen Modernisierungserfordernissen und traditionellen Kulturüberlieferungen ist grundlegender, als die These vom „Zusammenprall der Zivilisationen“ nahelegt, da diese fälschlicherweise stabile Kulturprofile unterstellt. Tatsächlich stehen die großen Kulturen der Welt vor internen Konflikten.
Über das Irrationale im Umgang mit Kriminalität. Die Krise des öffentlichen Strafanspruchs. Die Strafzwecke: Übergänge zu Alternativen. Strafrechtliche Sanktionen und ihre Surrogate. Strafjustiz zwischen Gesellschaft und Staat?
Dieses Buch entfaltet die Perspektive einer gesamteuropäischen Friedensordnung. Deren Architektur wird hinsichtlich ihrer wesentlichen Dimensionen diskutiert: Rechtsstaatlichkeit und Demokratisierung, institutionelle Vernetzung auf staatlicher und gesellschaftlicher Ebene, Verteilungsgerechtigkeit und ökonomischer Ausgleich sowie einfühlendes Verstehen (Empathie). Diskutiert werden erforderliche Instrumentarien der Konfliktregelung: friedliche Streitbeilegung und therapeutisch« Konfliktintervention. Schließlich wird Europas Stellung in einem durch das Ende des Ost-West-Konfliktes veränderten internationalen System umrissen.
Das Jahr 1989 bedeutet einen für die Nachkriegszeit beispiellosen Umbruch in Europa und führt zu tiefgreifenden Veränderungen in den Ost-West-Beziehungen. Das vorliegende Buch analysiert die Gründe für diese tiefe Zäsur und entfaltet eine friedenspolitische Perspektive für Gesamteuropa: Rechtsstaatlichkeit, ökonomischer Ausgleich, unreglementierter Austausch, institutionalisierte Kooperation, Konfliktregelung durch friedliche Streitbeilegung und ein System kollektiver Sicherheit sowie die Lösung von europäischen Gemeinschaftsaufgaben werden als Bauelemente einer Struktur dauerhaften Friedens in Europa diskutiert. Ein Rückblick aus dem Jahr 2000 auf die neunziger Jahre läßt erkennen, daß das entfaltete Szenario bei gezielten politischen Anstrengungen erreichbar ist.