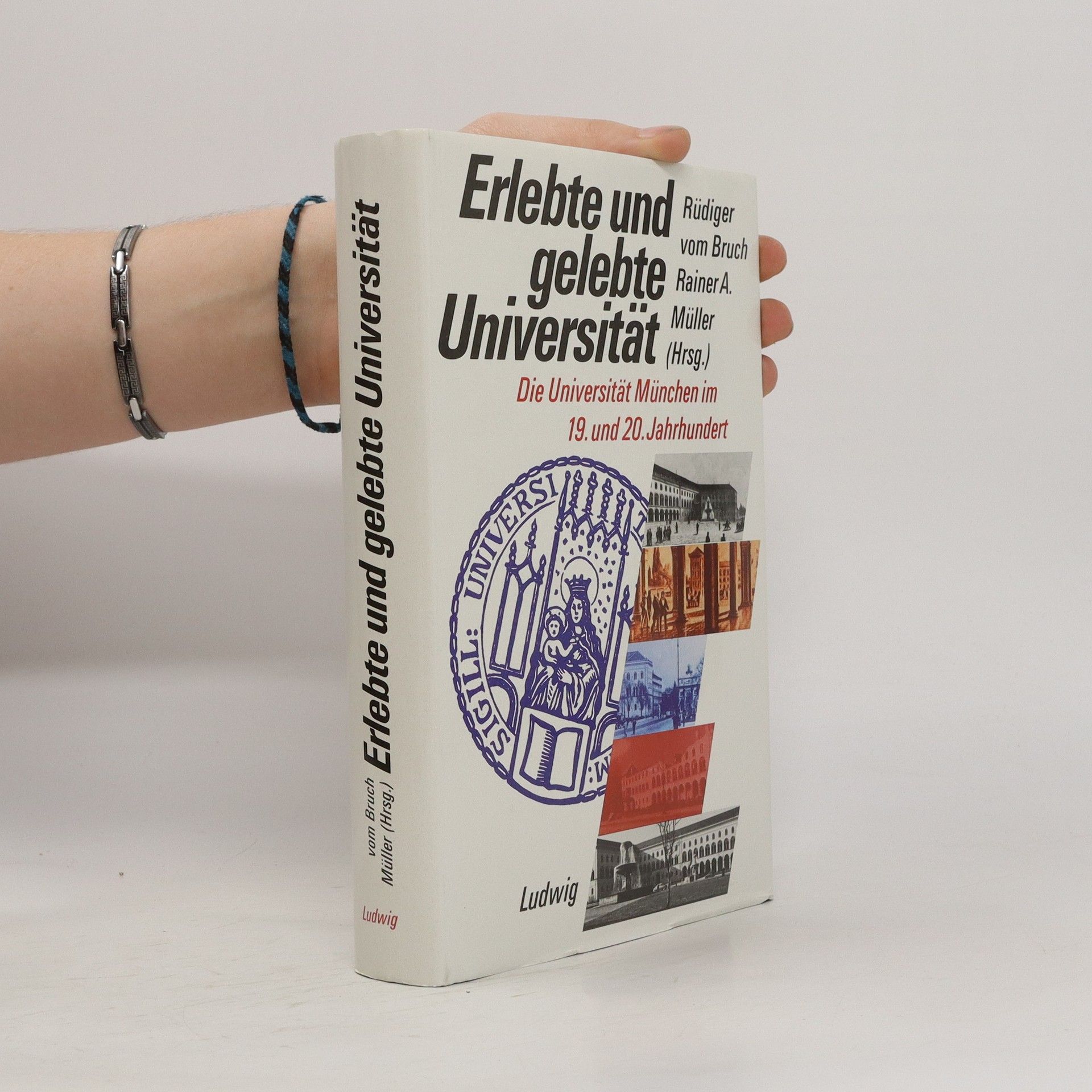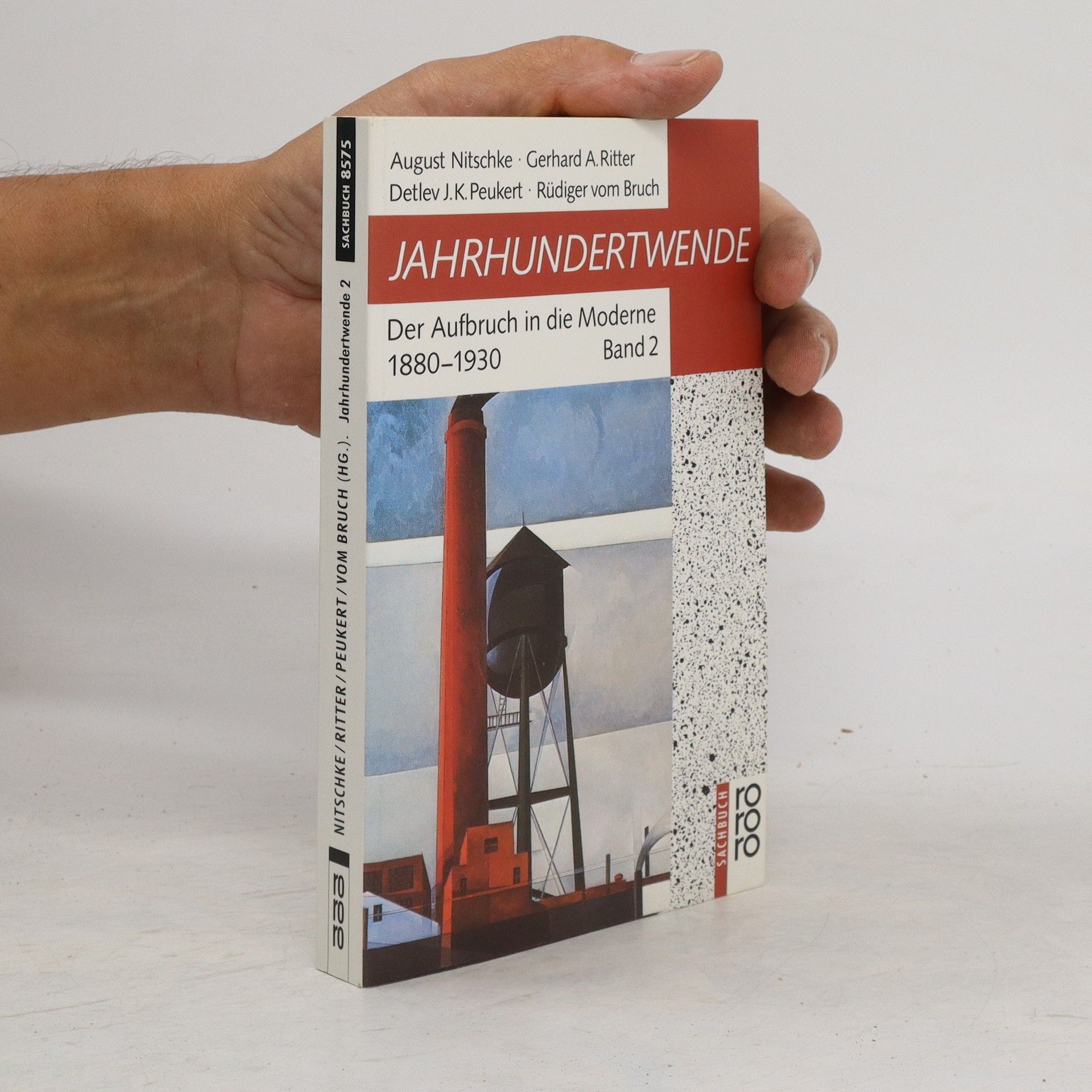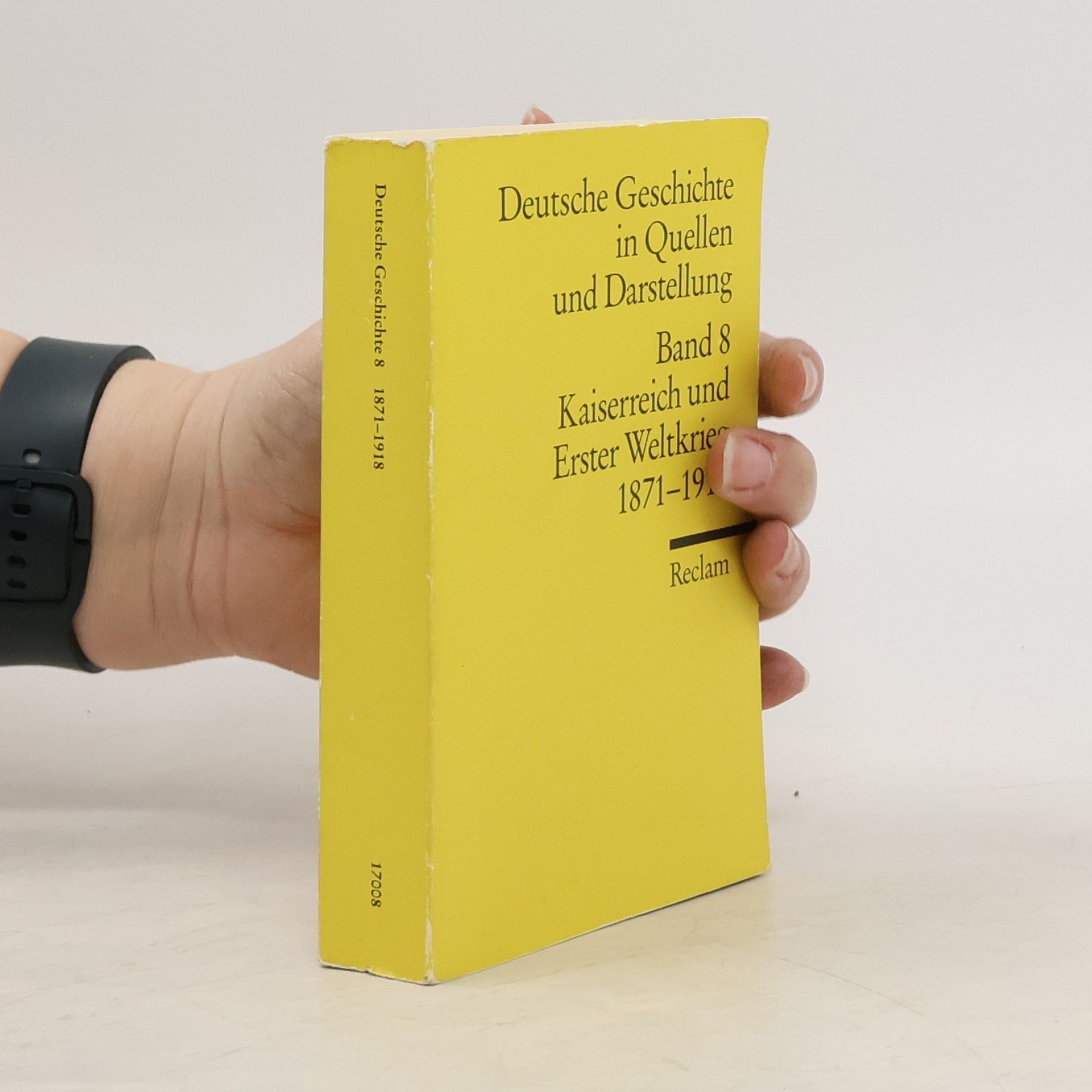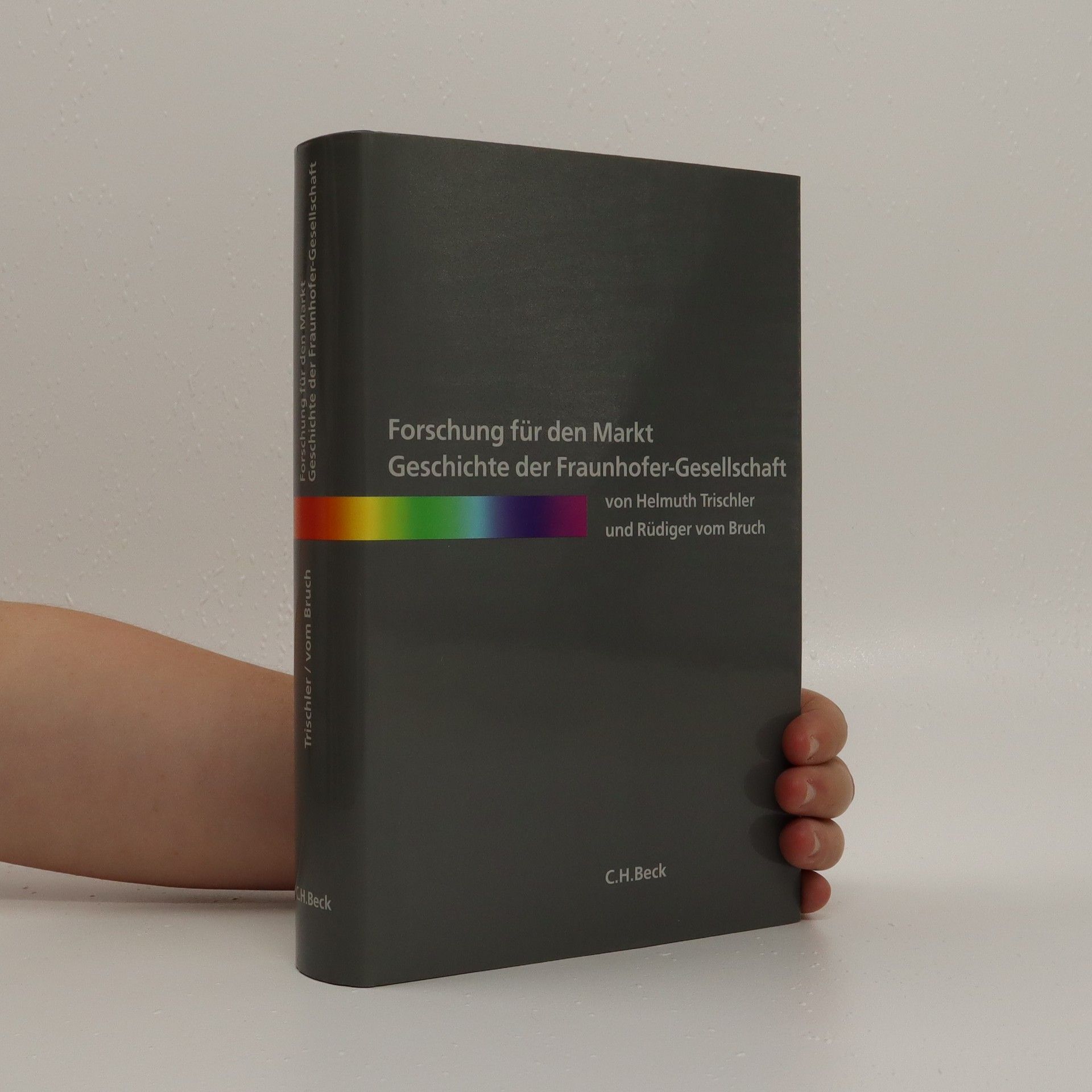Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung
- 511 Seiten
- 18 Lesestunden
Dieser Band schließt die Lücke der Reihe im späten 19. Jahrhundert. In 130 prägnant ausgewählten und konzentriert eingeleiteten Dokumenten der Zeit stellen die Herausgeber die äußeren Beziehungen und inneren Verhältnisse des Reiches dar, charakterisieren seine Entwicklungstendenzen und zeichnen die Linien nach, die vom siegestrunkenen Beginn im Spiegelsaal von Versailles bis zum Ende in der Niederlage des Ersten Weltkriegs führen.