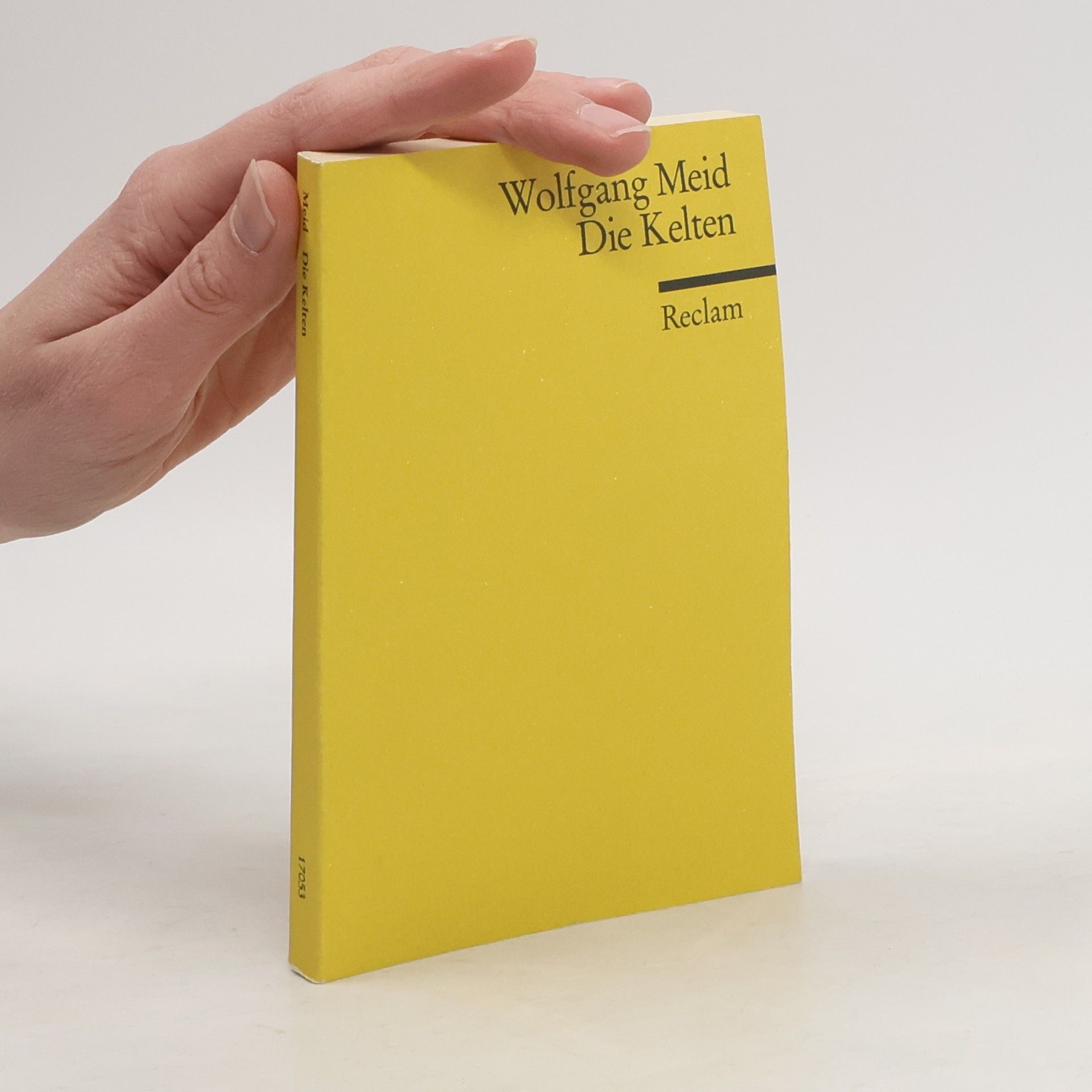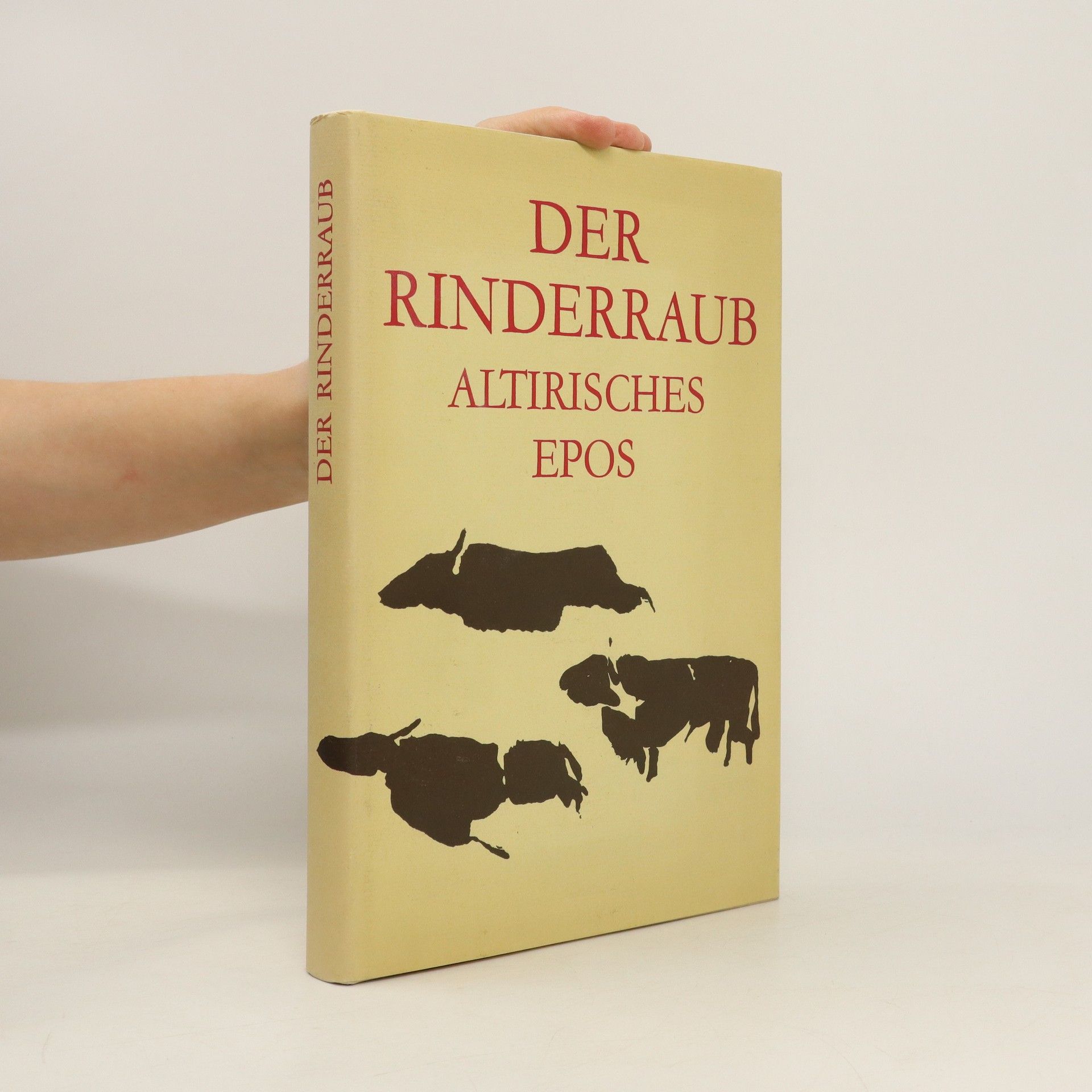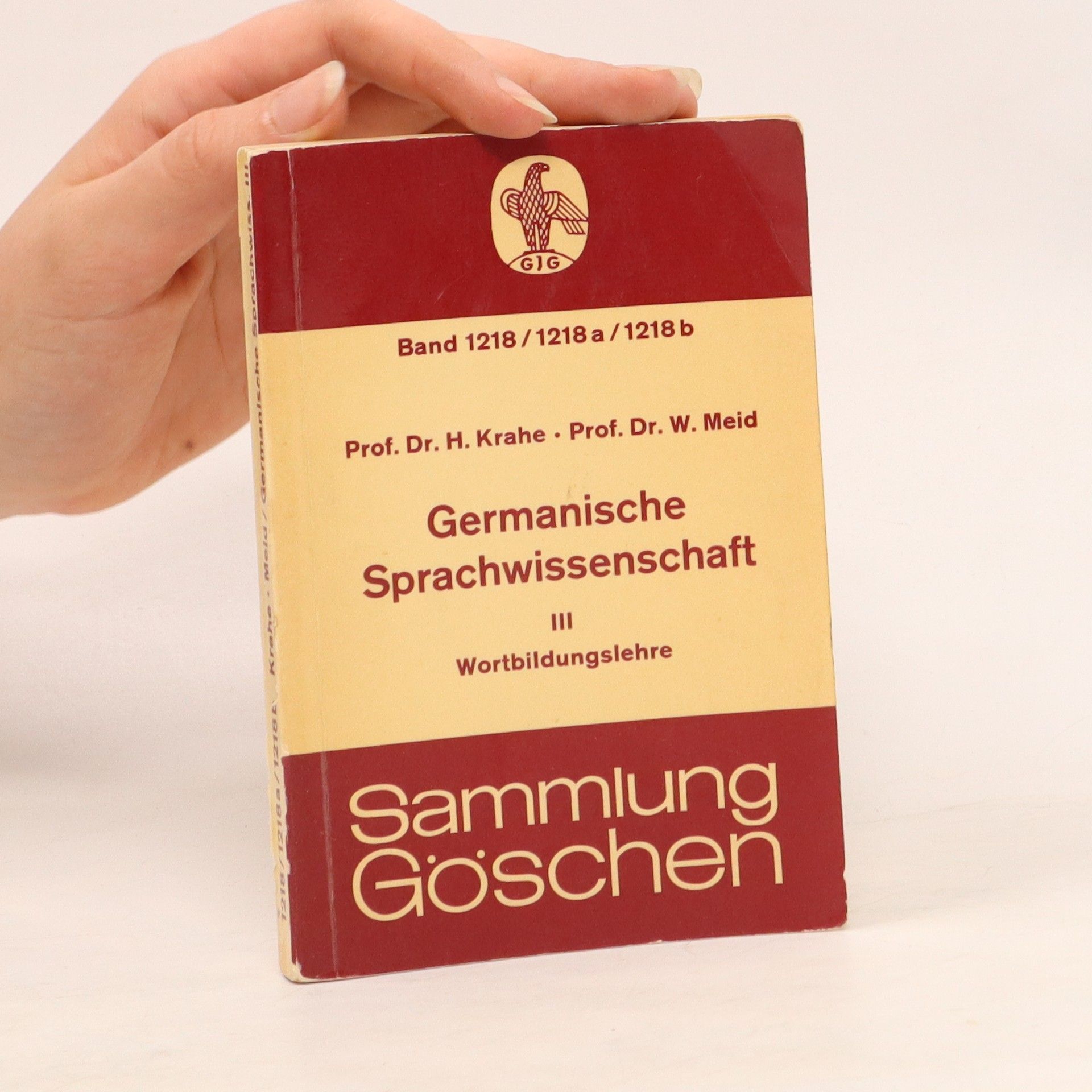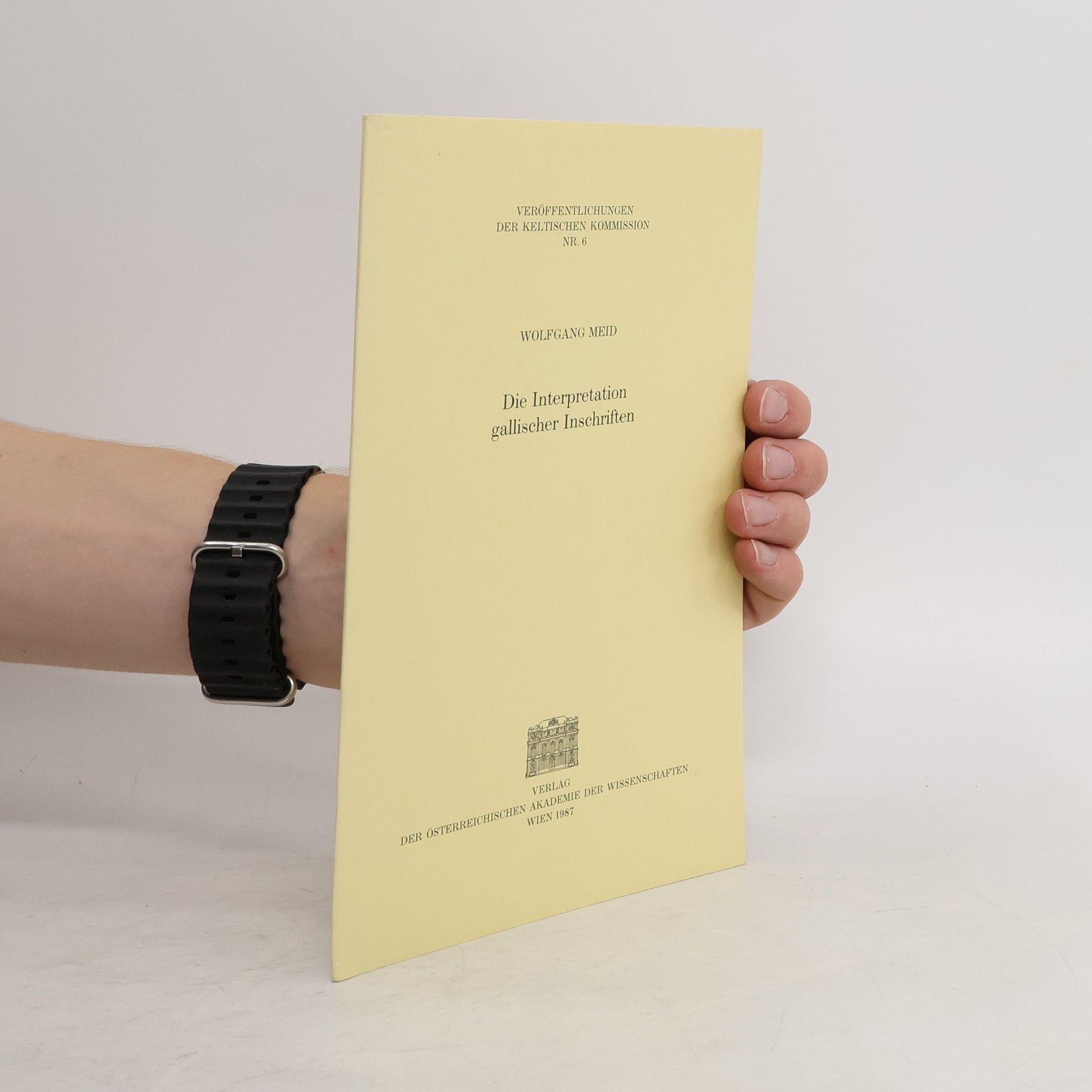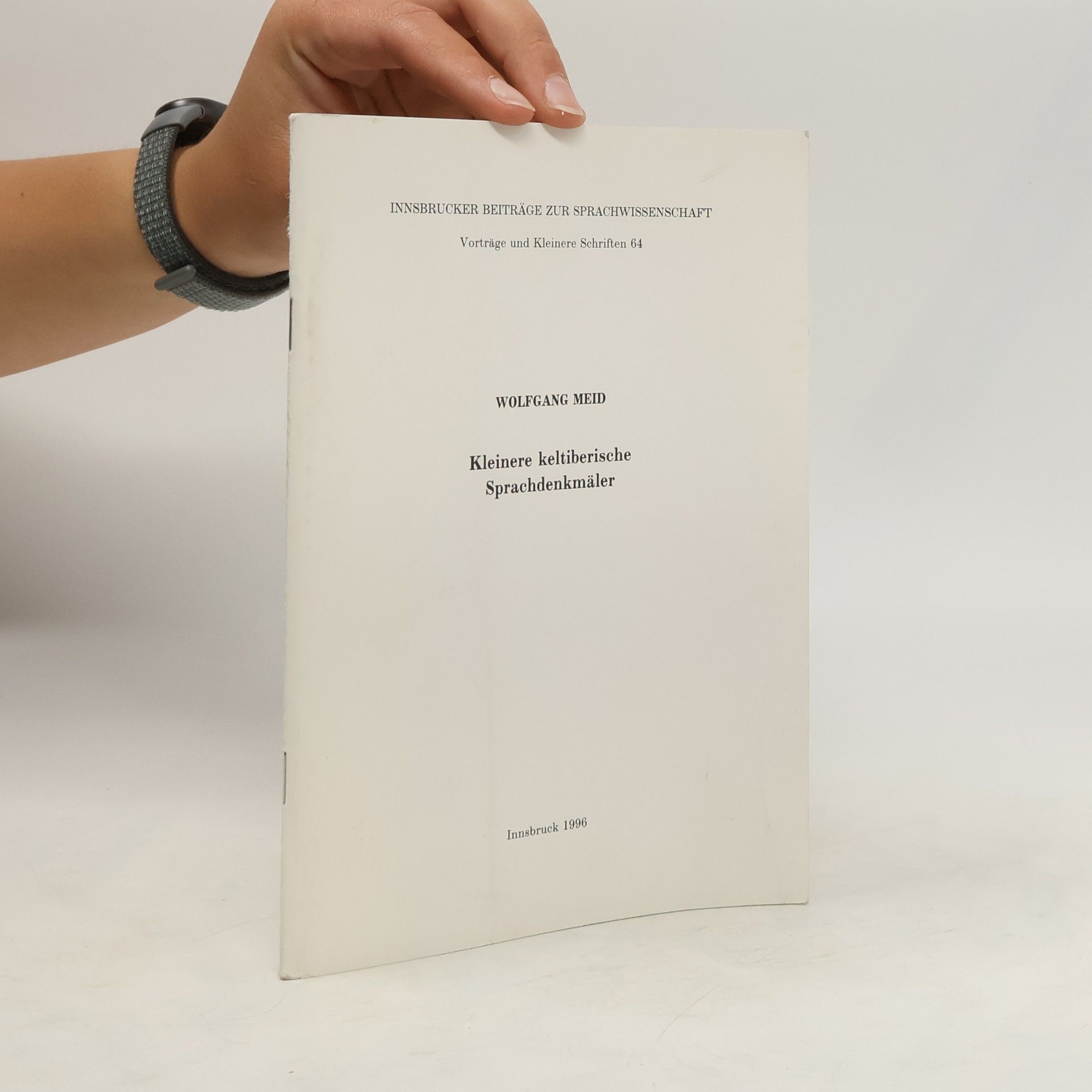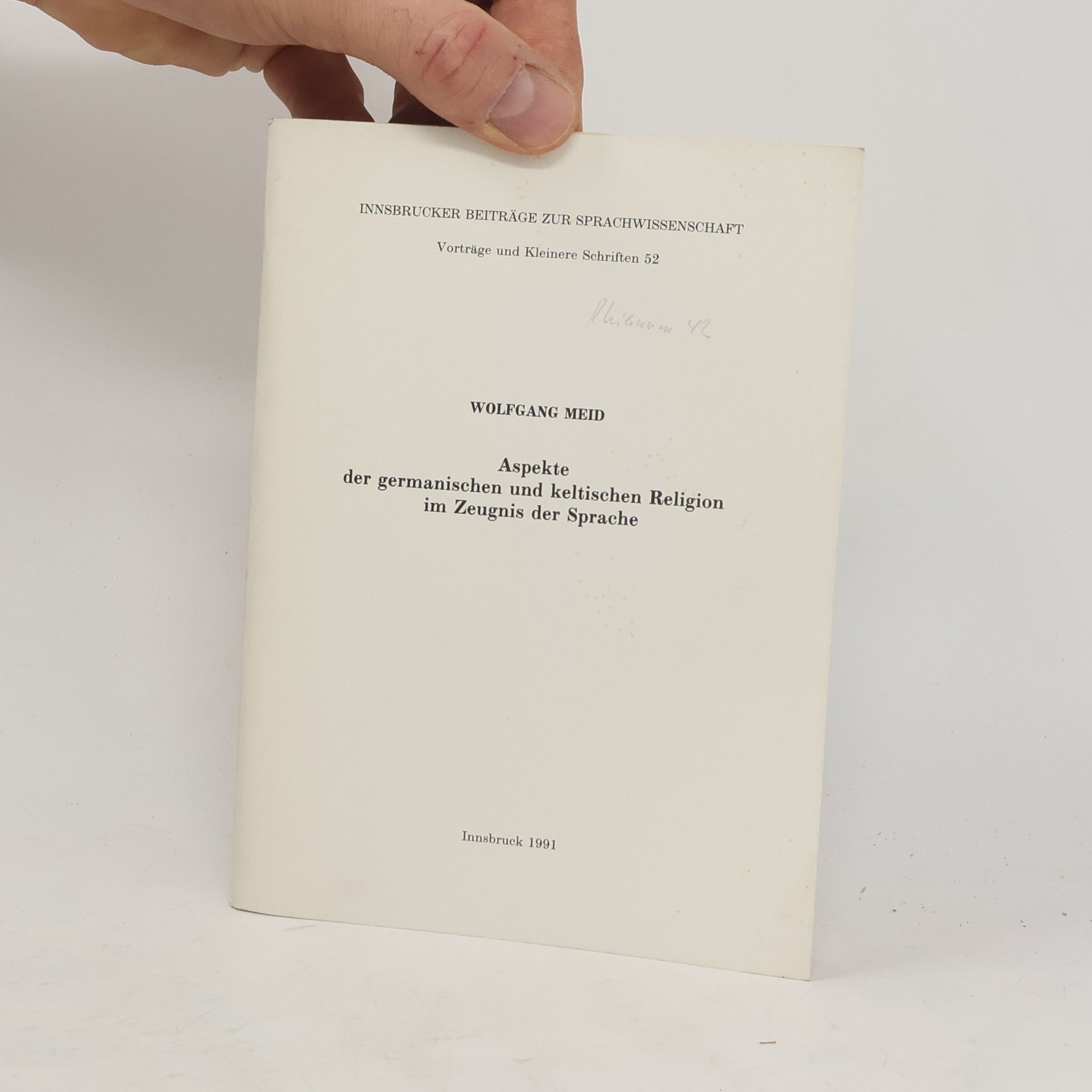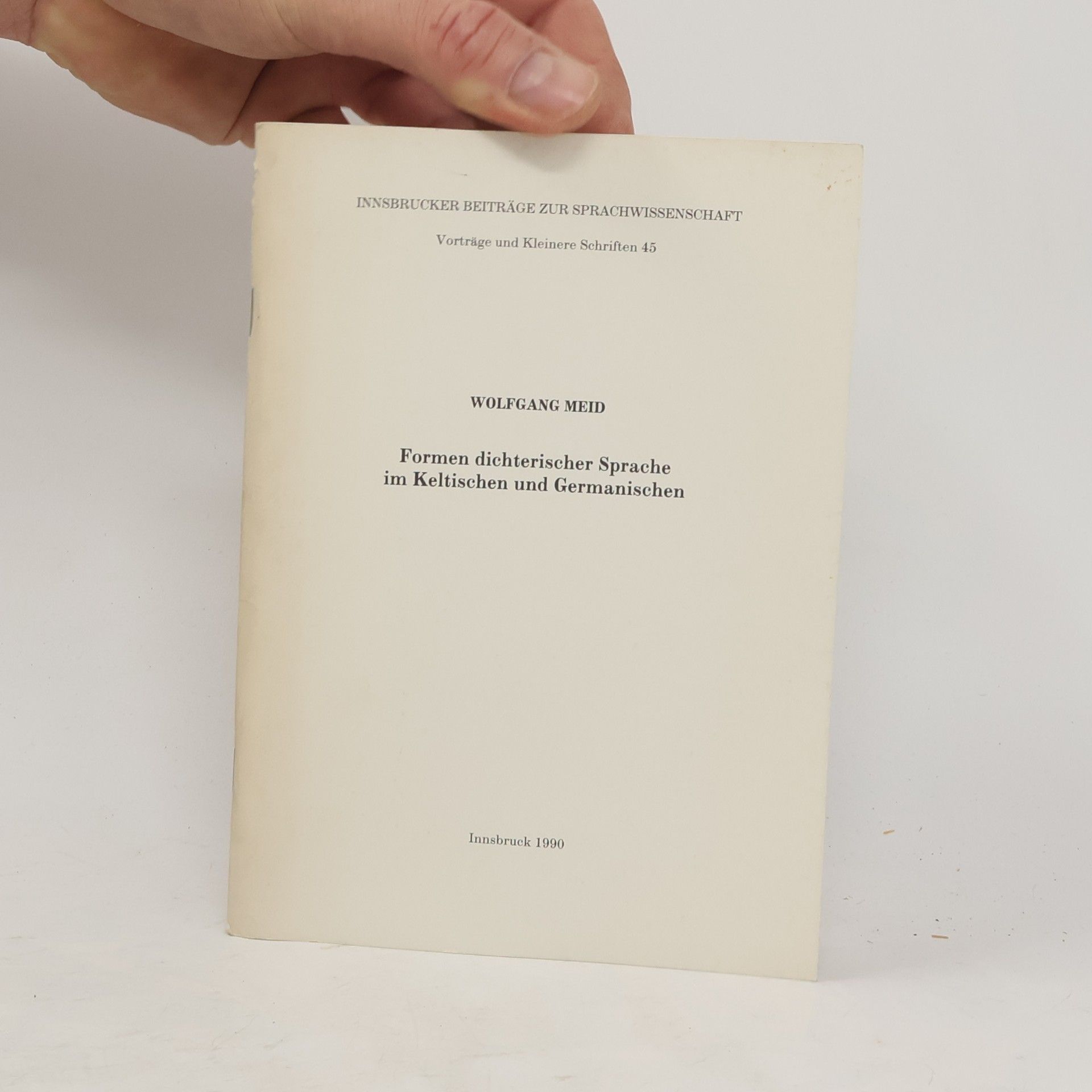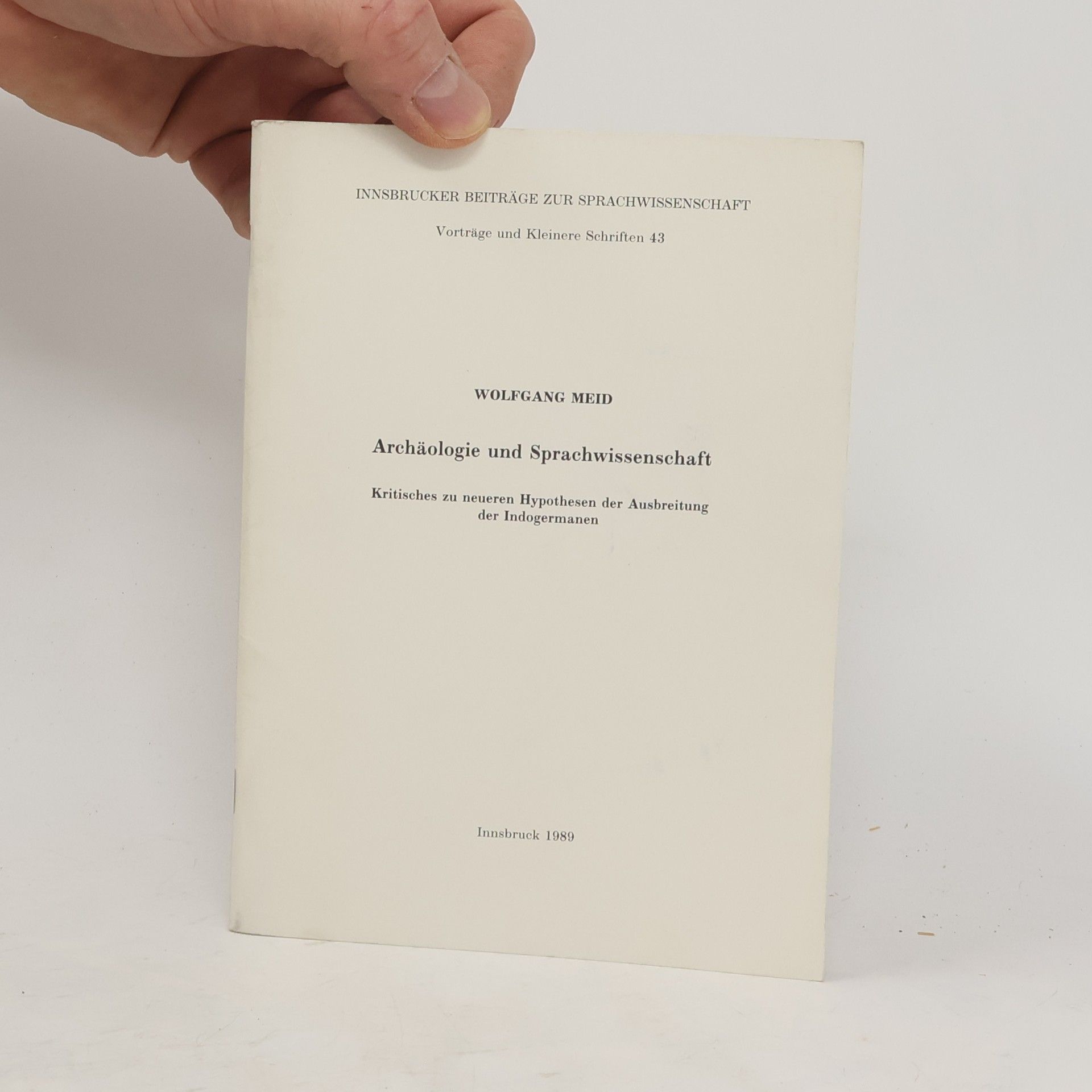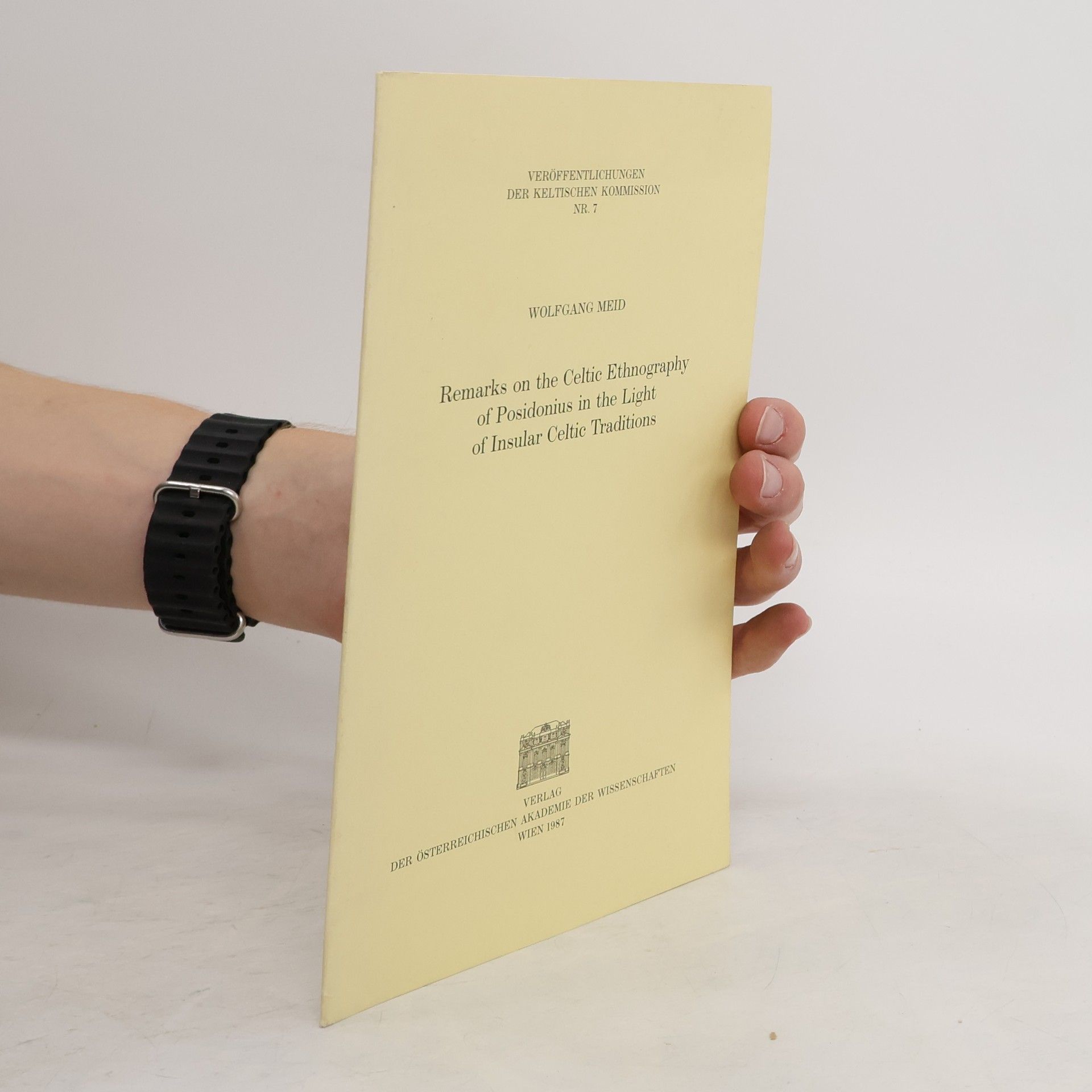Aislinge Óenguso
- 183 Seiten
- 7 Lesestunden
Aislinge Óenguso? ist eine Liebesgeschichte, die im Milieu der Götterwelt angesiedelt ist, die ? wie man glaubte ? Irland in der Vorzeit beherrschte. Oengus, auch Macc Óc genannt, ist der Sohn der Boand, der ?Weissen Kuh?, einer Form der unter vielen Namen erscheinenden ?Grossen Mutter?. Sein Vater ist der oberste Gott dieses Pantheon, de Dagdae, der ?Gute Gott?. 0Oengus erscheint im Traum eine wunderschöne junge Frau, in die er sich heftig verliebt, die ihm aber stets entschwindet. Darüber verfällt er in eine lang anhaltende Depression, deren Heilung nur durch die Vereinigung mit der real entsprechenden Person erhofft werden kann. Die Suche nach der Traumfrau, einer Elfin, bei der sowohl der Dagdae als auch der Elfenkönig von Munster, und schliesslich auch Ailill und Medb, das Königspaar von Connacht, behilfkich sind, bildet den weiteren Verlauf der Geschichte, die schliesslich met der Vereinigung beider glücklich endet. 0Der Text, nur in einer einzigen Handschrift des frühen 16. Jahrhunderts überliefert, weist nach dem inneren Zeugnis seiner Sprache in die altirische Epoche ? das 8. Jahrhundert ? zurück und ist hier in der entsprechenden Sprachform restauriert. Stilistische Reinheit und lebhafte Erzählweise machen bei vergleichsweise geringem sprachlichen Schwierigkeitsgrad den sympathischen Text zu einer besonders geeigneten Einführung in die altirische Erzählliteratur.