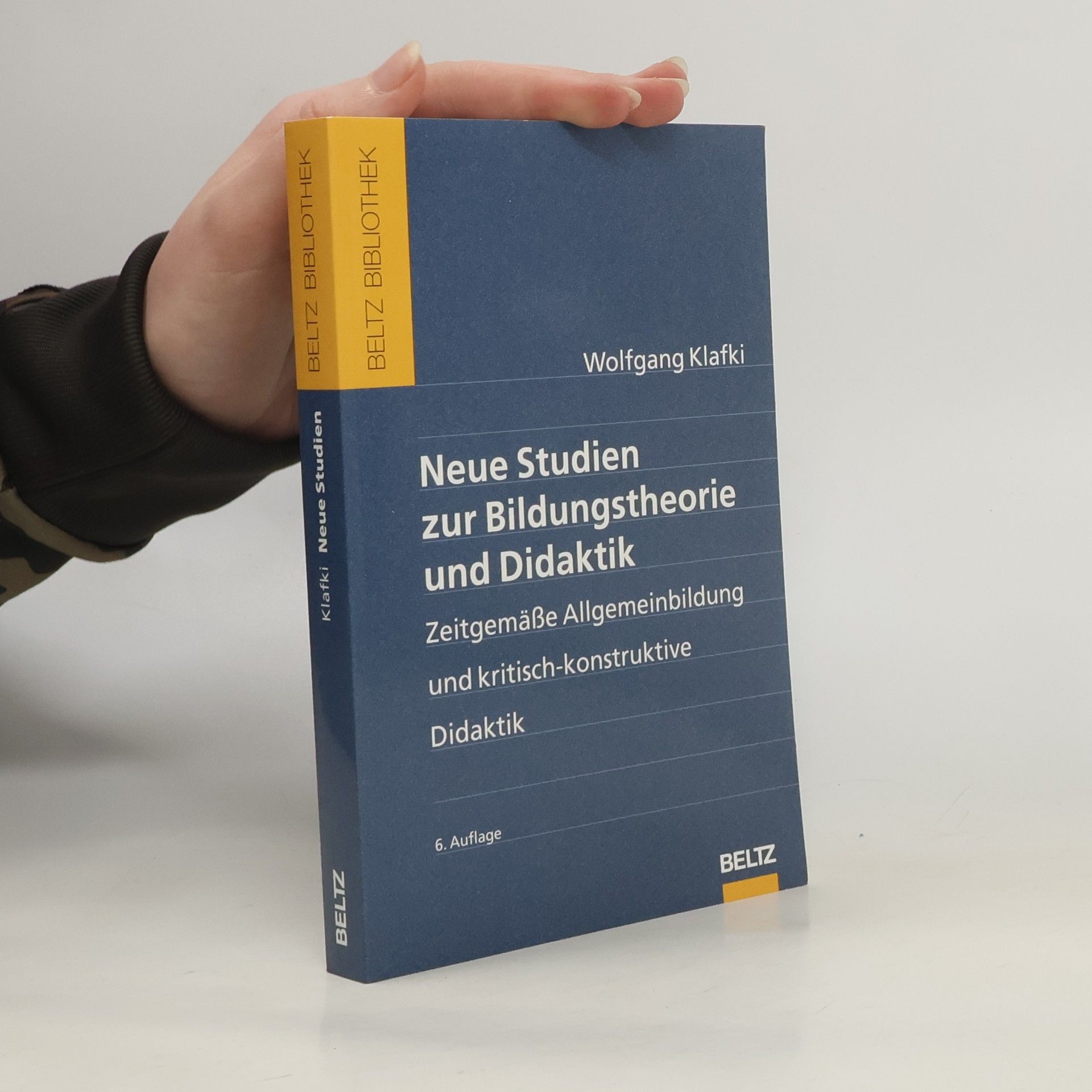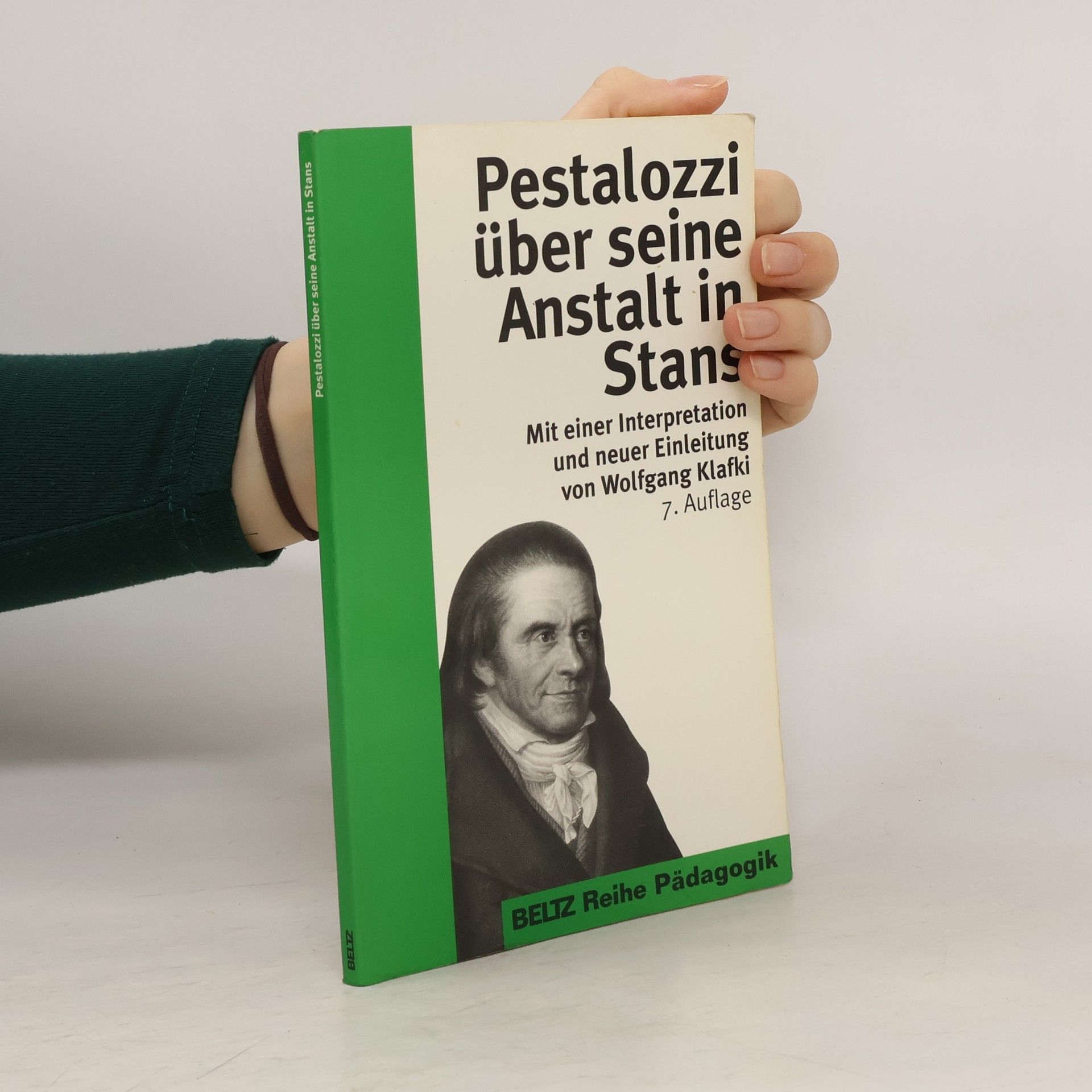Geisteswissenschaftliche Pädagogik
Fünf Studienbriefe für die FernUniversität in Hagen. Herausgegeben von Cathleen Grunert und Katja Ludwig
Wolfgang Klafki führt in seinen fünf Studienbriefen, die er Ende der 1970er-Jahre verfasst hat und die mit diesem Band erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, umfassend in die Ursprünge, Grundfragen und theoretischen Linien der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik ein. Bis heute hat diese Einführung nichts an Aktualität verloren und bietet im didaktisch aufbereiteten Format von Studienbriefen zum einen eine überzeugende Möglichkeit für die Auseinandersetzung mit einer der zentralen Theorieströmungen der Erziehungswissenschaft. Zum anderen bietet sie einen spannenden Einblick in Klafkis Denkbewegungen zwischen Geisteswissenschaftlicher Pädagogik und kritisch-konstruktiver Erziehungswissenschaft.