Karl Dieter Opp Bücher

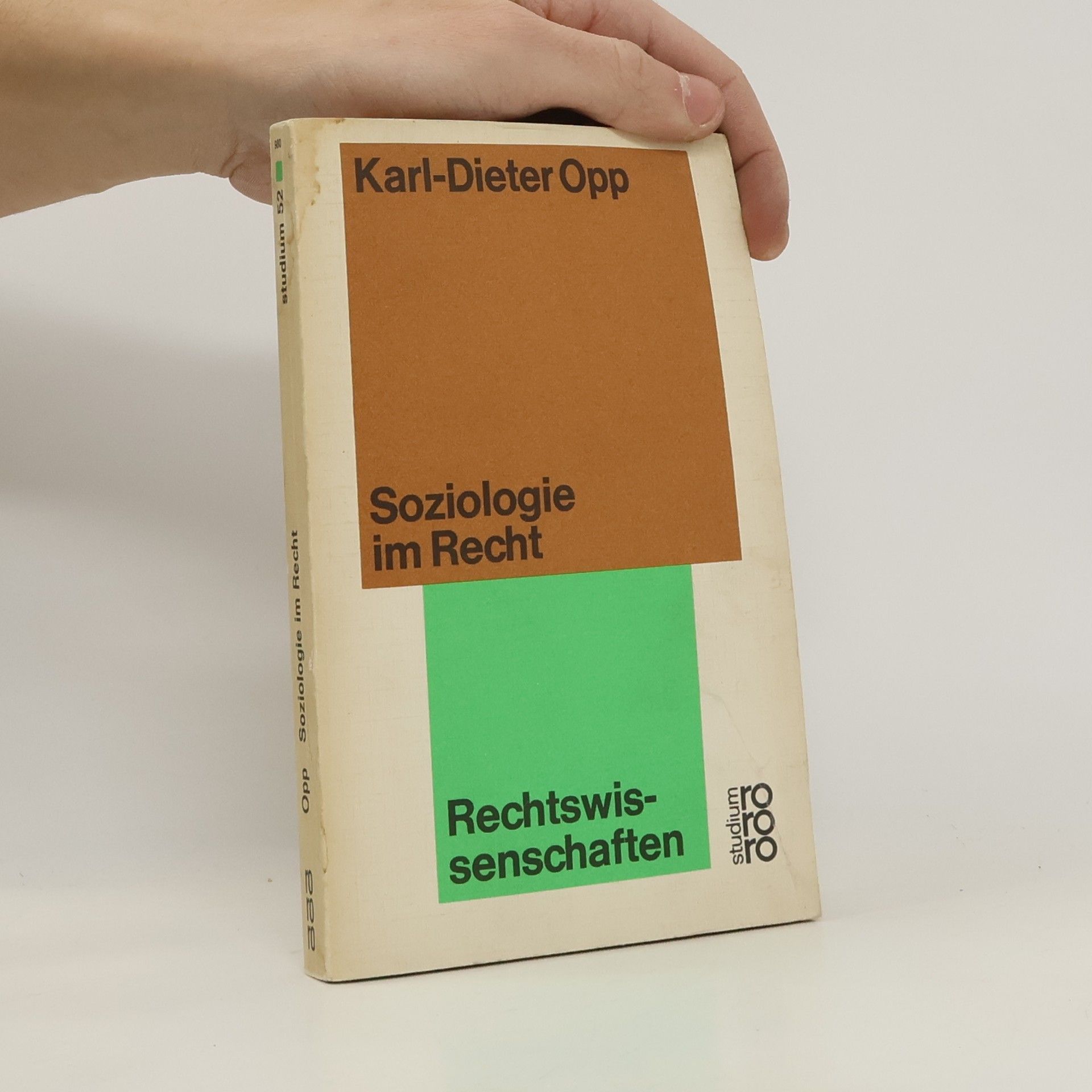
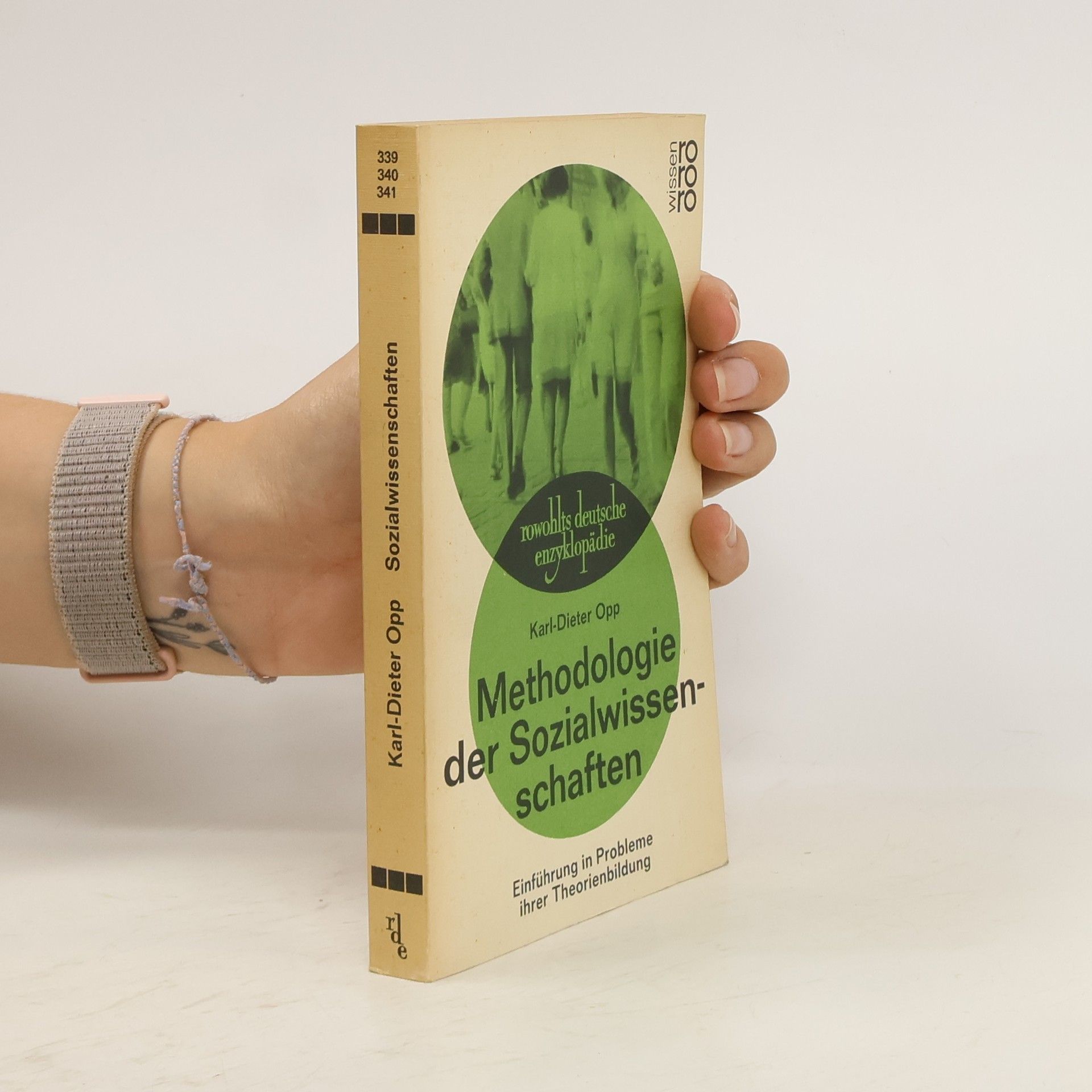
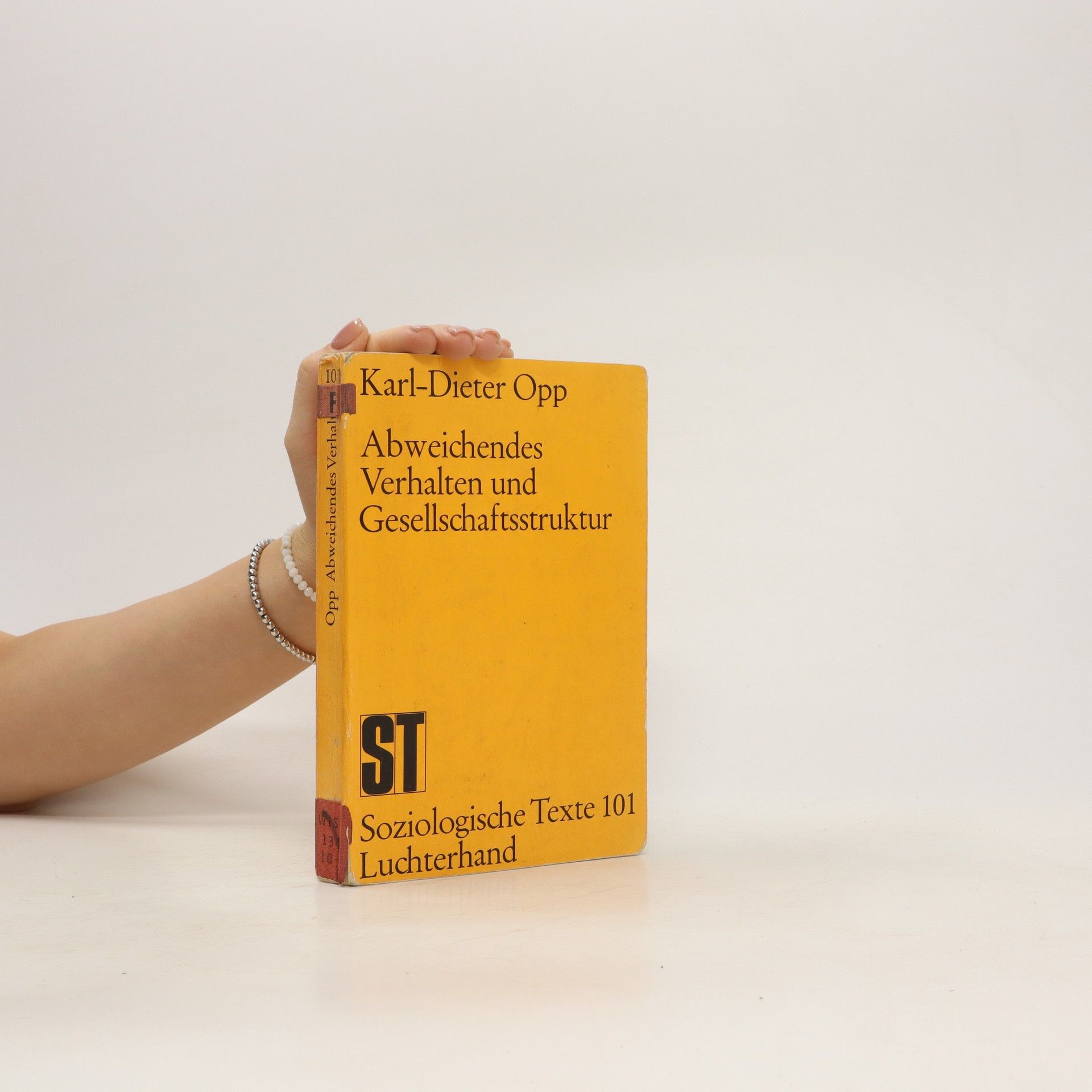
Dieses Buch bietet eine elementare, kritische und leicht verständliche Einführung in die zentralen Probleme der Methodologie der Sozialwissenschaften. Dabei wird ein Einblick in die konkrete Arbeitsweise und die Probleme einer modernen empirisch-theoretischen Sozialwissenschaft gegeben. U. a. werden folgende Fragen behandelt: Wie geht man bei einer Erklärung konkreter sozialer Sachverhalte vor? Wie unterscheidet sich das Verstehen sozialer Sachverhalte von deren Erklärung? Welche Probleme treten bei einer Prognose auf? Wie definiert man Begriffe? Wie kritisiert man eine sozialwissenschaftliche Theorie? Welche Rolle spielen Logik und Mathematik in den Sozialwissenschaften? Sollen und können Sozialwissenschaften wertfrei sein? Wie diskutiert man Werte? Inwieweit sind Ergebnisse der Sozialwissenschaften für die Lösung praktischer Probleme verwendbar?
Political protest and social movements are ubiquitous phenomena. This book focuses on the current theoretical approaches that aim at explaining them: the theory of collective action, the resource mobilization perspective, political opportunity structure theory, the identity approach, the framing perspective, and the dynamics of contention approach. The book has three objectives: (1) Many basic concepts like political opportunities or identity are not clearly defined. It is further often a matter of interpretation what factors are supposed to affect which phenomena. The first aim is therefore to provide a detailed introduction to and a clear restatement of the theories. Only then is it possible to assess and improve them. (2) For each theory the major strengths and weaknesses are discussed, and various modifications and extensions are suggested. (3) Building on these analyses, it is shown how the theories can be integrated into a single theoretical paradigm: the structural-cognitive model.