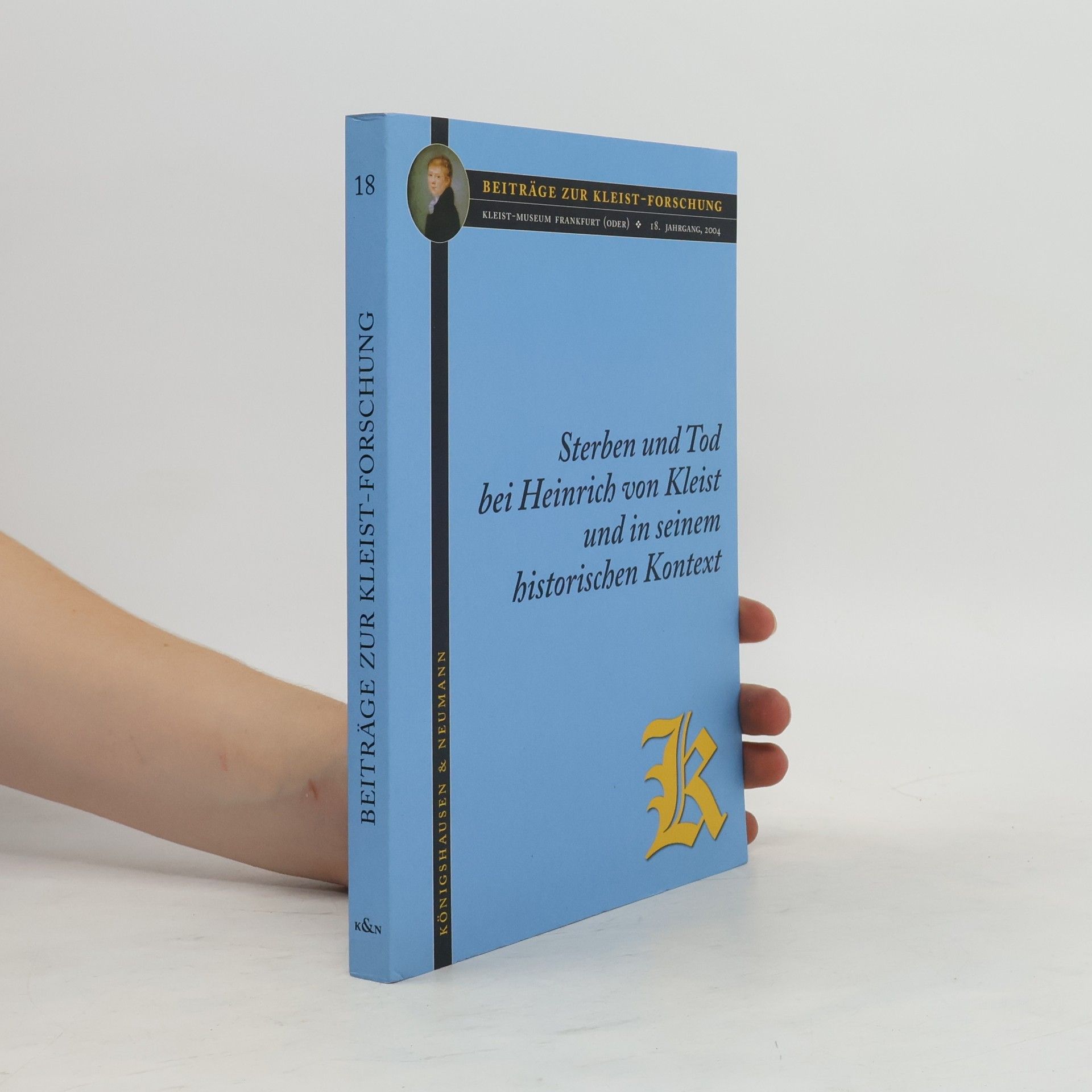Dietrich von Engelhardt Bücher


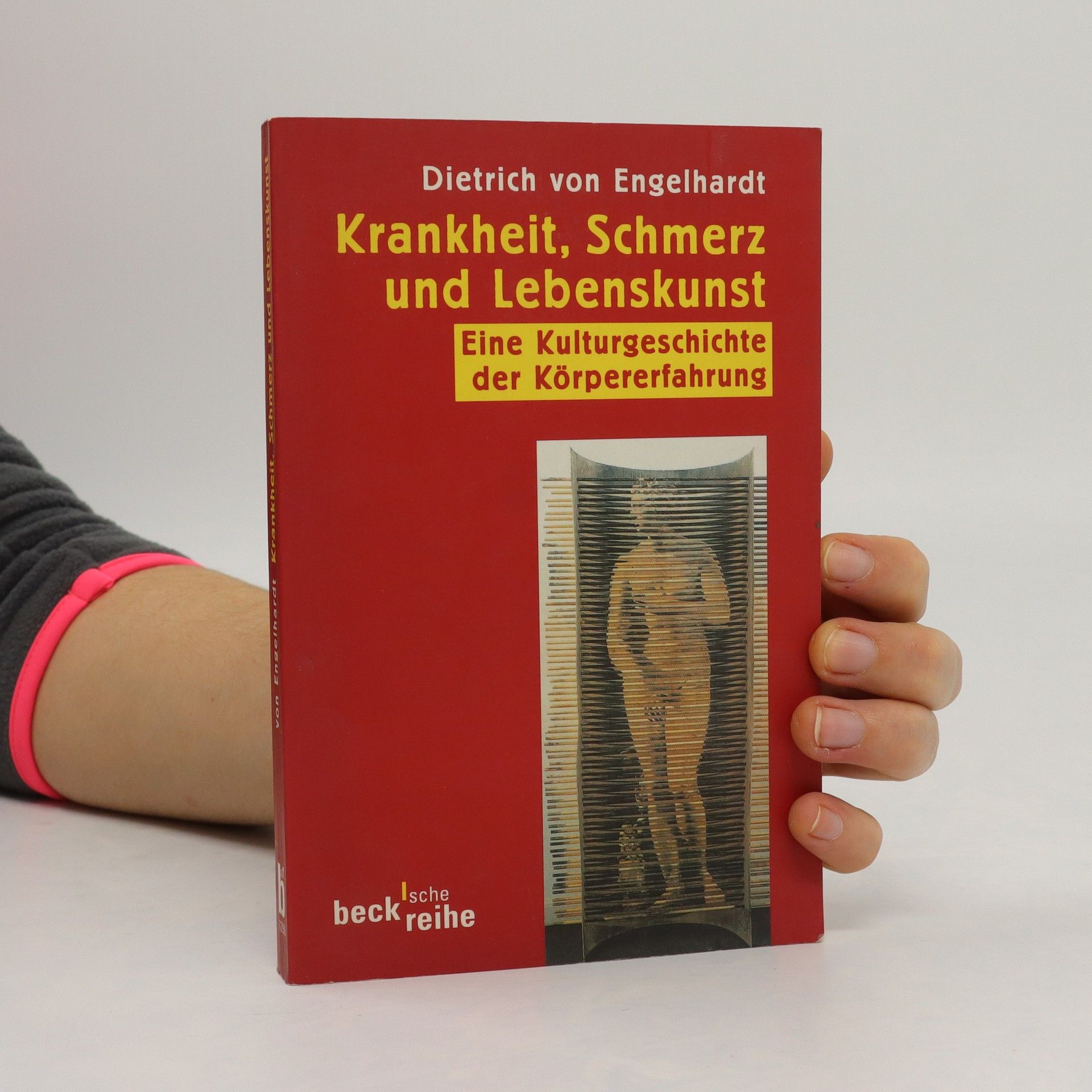



Diabetes in Medizin- und Kulturgeschichte behandelt die Geschichte der wissenschaftlichen Erforschung dieses Leidens von der Antike bis zur Entdeckung des Insulins (1921) unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Geschichte des Patienten und kulturhistorischer Hintergründe. Die abgedruckten medizinhistorischen Studien erörtern sowohl allgemeine Zusammenhänge wie spezifische Details und besondere Forschungsleistungen der Vergangenheit. In der Bibliographie der Quellen werden die wesentlichen historischen Beiträge der Diabetesforschung und Diabetestherapie mit den Autoren und der Angabe der Druckorte zusammengestellt. Die Bibliographie der Sekundärliteratur vereinigt internationale Studien seit dem vergangenen Jahrhundert bis in die jüngste Gegenwart über die Geschichte der Theorien des Diabetes und der therapeutischen Ansätze. Abbildungen und literarische Texte dokumentieren kulturhistorische Zusammenhänge. Ein Personen- und Sachregister erleichtert die Benutzung dieses Bandes, der insgesamt Mediziner, Medizinhistoriker, Medizinstudenten, Allgemeinhistoriker wie auch Diabetespatienten anregen möchte.
Der Band beleuchtet Goethes Einfluss als Naturforscher im 19. Jahrhundert und bietet eine umfassende Bibliographie von 260 Titeln sowie 48 internationalen Arbeiten. Er schließt eine Lücke in der Forschung, die Goethes naturwissenschaftliche Beiträge und deren Rezeption in den Naturwissenschaften und der Medizin behandelt.
Während eine Krankheit in der Frühzeit als göttliches Zeichen und in der Antike im kosmologischen Zusammenhang interpretiert wurde, wird sie heute oft nur als Störung oder Defekt des Organismus gesehen. An die Stelle der Diätetik im Sinne einer Lebenskunst, die einen ganzheitlichen Umgang mit Gesundheit und Krankheit anstrebt, tritt daher die medizinische 'Reparatur'.Krankheit, Schmerz und Diätetik werden in diesem Buch nicht nur als Begriffe der Medizin, sondern auch als zentrale Themen der Künste und Literatur, der Philosophie und Theologie behandelt. Der Autor richtet sich - ohne die Erfolge der Schulmedizin abzustreiten - gegen ihre einseitig naturwissenschaftliche Entwicklung und stellt die Körpererfahrung des Menschen in den Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Natur. [Ed.]
Medizin in Romantik und Idealismus.
Gesundheit und Krankheit in Leib und Seele, Natur und Kultur
Mit der deutschen Romantik verbinden sich nicht nur Kunst, Geschichte, Theologie und Philosophie, sondern – weitaus weniger beachtet – auch Medizin und Naturwissenschaften. Im Gegensatz zu den empirischen Wissenschaftstendenzen der Frühen Neuzeit und Aufklärung entwickeln Mediziner um 1800 philosophische Konzepte zur Überwindung der Gegensätze von Leib und Seele, Gesundheit und Krankheit, Natur und Kultur. Das metaphysische Naturverständnis dieser Mediziner beeinflusst bis heute die Suche nach Bewahrung und Pflege der Natur und einer ›humanen‹ Humanmedizin. In einem bislang nicht vorliegenden Umfang dokumentiert und interpretiert der Medizin- und Wissenschaftshistoriker Dietrich von Engelhardt in vier Bänden diese faszinierende Epoche mit ihren Positionen, Personen und Quellen im Horizont der international-interdisziplinären Forschung.
Medizin in Romantik und Idealismus. Band 4: Forschungsbibliographie
Gesundheit und Krankheit in Leib und Seele, Natur und Kultur
Band 4 bietet mit 6.400 Titeln die umfangreichste internationale und interdisziplinäre Forschungsbibliographie zur Medizin und Naturwissenschaft der deutschen Romantik sowie zur Naturphilosophie des Deutschen Idealismus seit 1800 bis heute. Dietrich von Engelhardt berücksichtigt Beiträge aus verschiedenen Disziplinen von deutschen, romanischen, slawischen, skandinavischen und asiatischen sowie angloamerikanischen Forschern. Diese erhalten dadurch Beachtung und Anerkennung. Die fachübergreifende Orientierung dieser Bibliographie im Geist der Romantik wirkt der heutigen Spezialisierung in den Wissenschaften entgegen und fördert den Dialog zwischen den Kulturen der Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, der Künste und des Lebens.
Medizin in Romantik und Idealismus. Band 3: Mediziner der Romantik
Gesundheit und Krankheit in Leib und Seele, Natur und Kultur
In Band 3 stellt Dietrich von Engelhardt die wichtigsten Mediziner der deutschen Romantik mit ihrem Leben und Werk vor. Ergänzt werden diese Informationen durch eine umfassende Bibliographie ihrer Monographien, Aufsätze und Rezensionen. Eindrucksvoll sind Gewicht und Umfang des empirischen Gehaltes der Theorien und Begriffe, Diagnostik und Therapie – eine unbestreitbare Widerlegung der den Medizinern vorgeworfene Vernachlässigung der Realität. Physik und Metaphysik, Theorie und Praxis, Gefühl und Verstand, Humanität und Wissenschaft sind für sie keine Alternativen; ihr Ziel ist die Überwindung der Trennung von Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, Kunst und Leben. Weitreichend ist die Resonanz der romantischen Orientierung in der Medizin um 1800, offensichtlich die Bedeutung für die Gegenwart.
Medizin in Romantik und Idealismus. Band 1: Darstellung und Interpretation
Gesundheit und Krankheit in Leib und Seele, Natur und Kultur
Band 1 bietet die derzeit umfassendste Darstellung und Interpretation der Medizin der deutschen Romantik. Dietrich von Engelhardt zeigt, wie Philosophen, Naturforscher und Mediziner von Kant, Schelling, Hegel, Goethe, Novalis über Carus, Heinroth, Eschenmayer, Kerner, Reil und Schubert bis zu Müller und Purkyně Empirie und Philosophie, Praxis und Theorie, Wissenschaft, Kunst und Leben sowie Geschichte und Zukunft zu verbinden suchen, was sie unter Gesundheit, Krankheit und Therapie, Arzt und Patient, Natur und Kultur verstehen. Dabei werden historische und philosophische Voraussetzungen beachtet, unterschiedliche Orientierungen und Schwerpunkte beschrieben, die zeitgenössische Rezeption im In- und Ausland verfolgt sowie auf ihre Nachwirkung und Anregungen für die Gegenwart eingegangen.
Medizin in Romantik und Idealismus. Band 2: Anthologie historischer Texte
Gesundheit und Krankheit in Leib und Seele, Natur und Kultur
Teilband 2 enthält eine Anthologie zentraler Texte der Medizin der deutschen Romantik und idealistischen Naturphilosophie zur unmittelbaren Auseinandersetzung mit den präsentierten Quellen in ihrer historischen und gegenwärtigen Bedeutung. Die von Dietrich von Engelhardt ausgewählten Texte veranschaulichen die Welt der romantischen Medizin um 1800 in Theorie und Praxis, Diagnostik und Therapie der verschiedenen medizinischen Disziplinen, in der Beziehung zwischen Arzt und Patient, im Verhältnis zur Philosophie, den Geisteswissenschaften, den Künsten sowie im Horizont der historischen und zukünftigen Entwicklung. Zur Geltung kommen die Naturphilosophen Kant, Schelling und Hegel und vor allem romantische Mediziner, unter ihnen Carus, Kerner, Oken, Schubert, Heinroth, Ringseis und Kieser.