Geschichte der Stadt Konstanz - 1: Konstanz im Mittelalter
I. Von den Anfängen bis zum Konzil
- 296 Seiten
- 11 Lesestunden
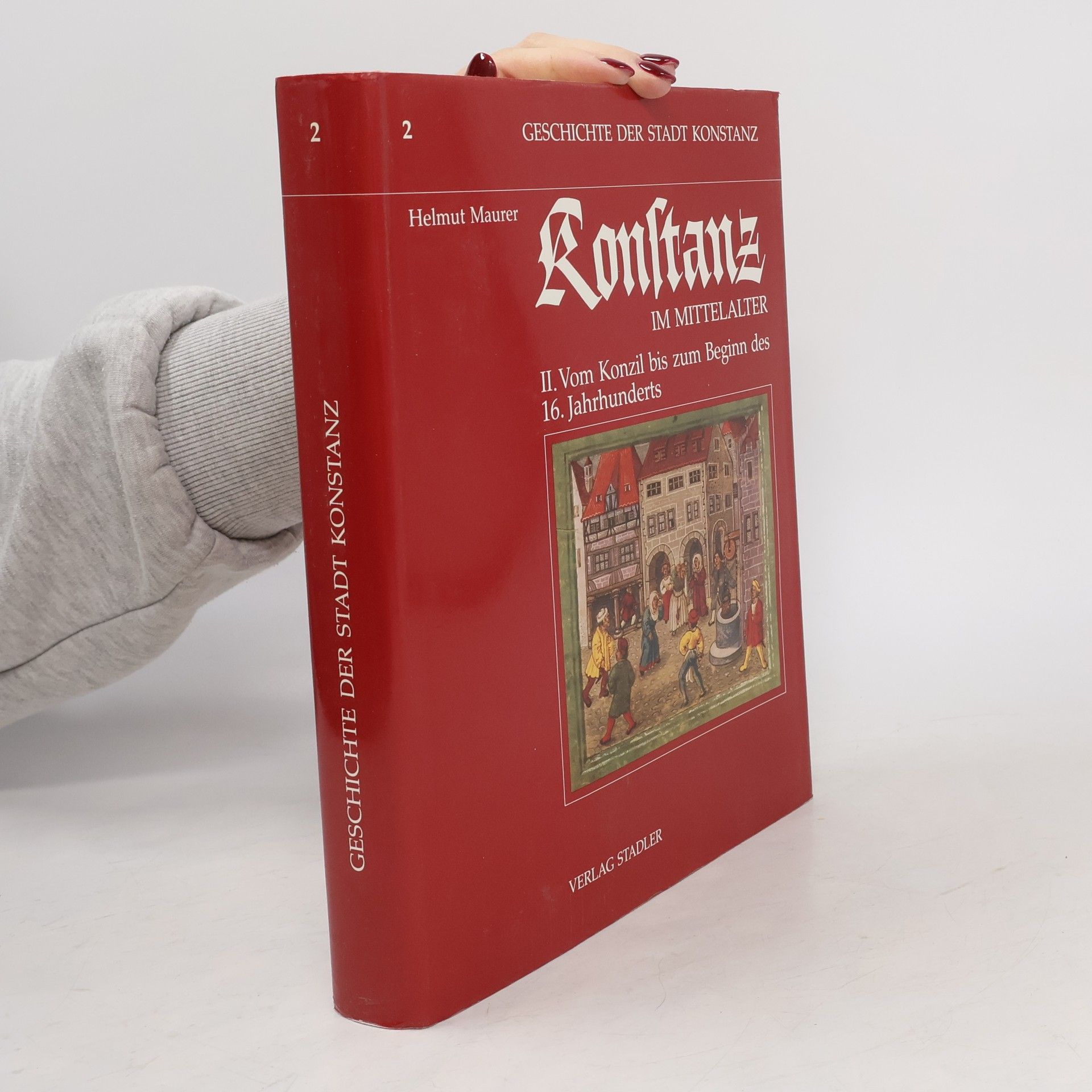
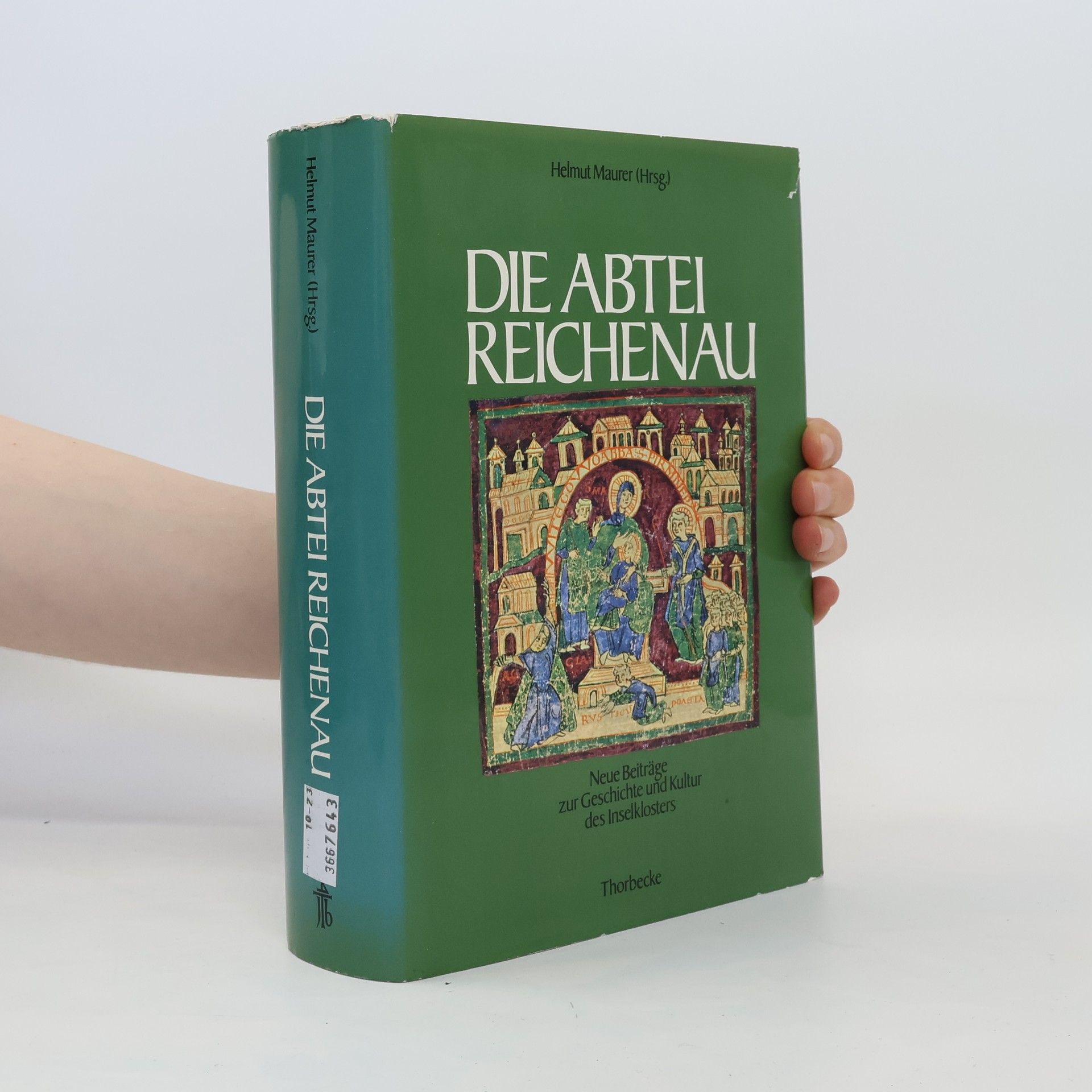

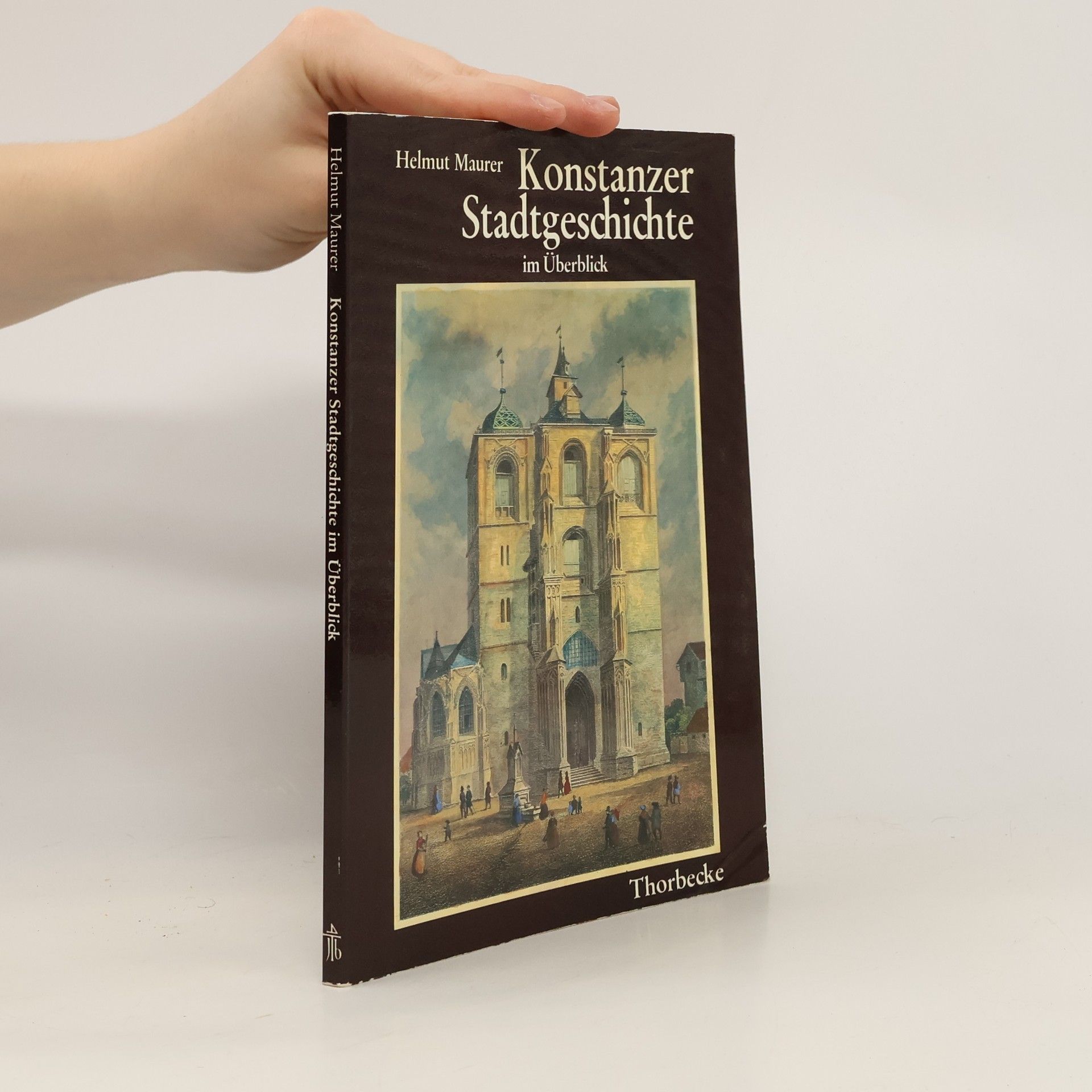

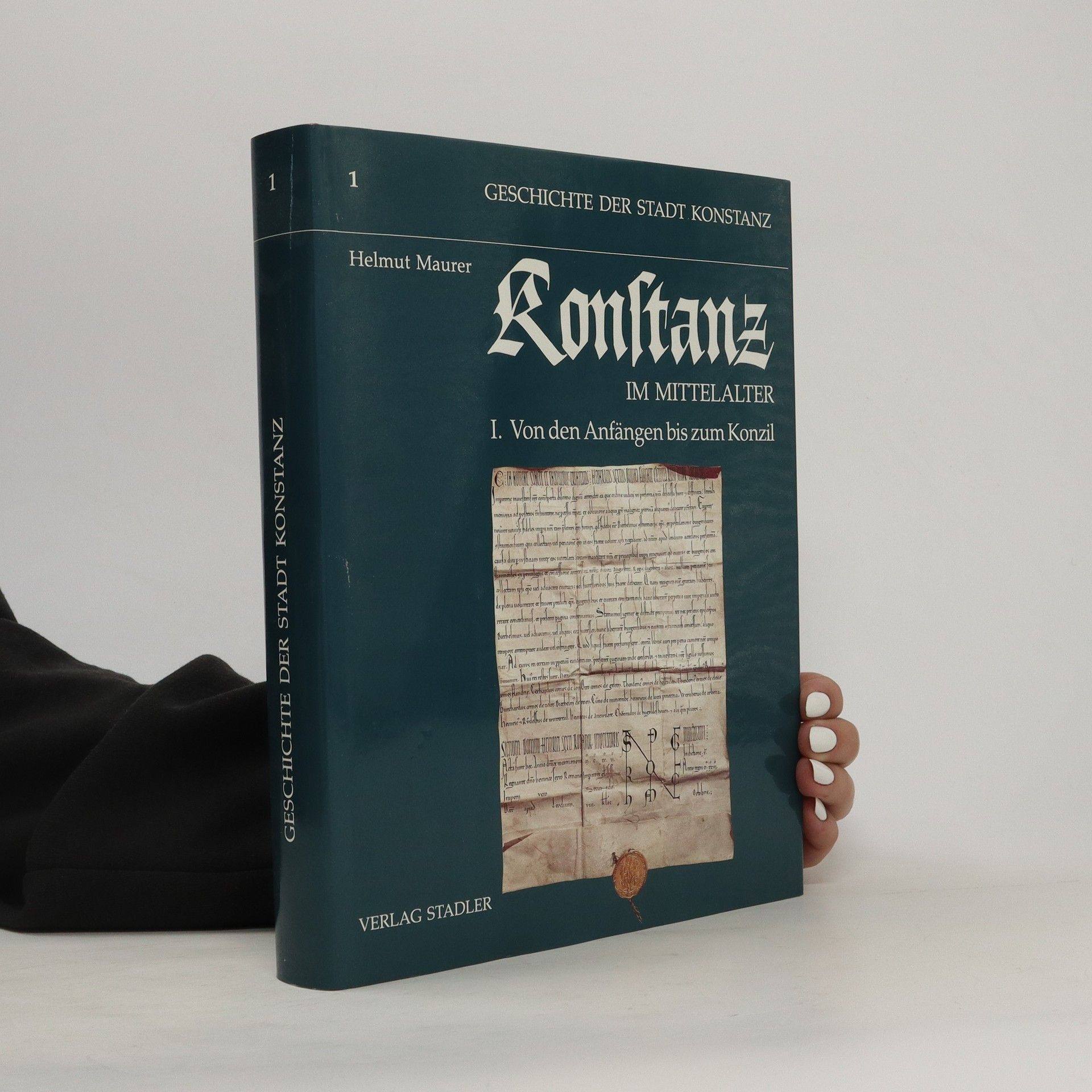
I. Von den Anfängen bis zum Konzil
II. Vom Konzil bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts
Konstanz im Mittelalter
Neue Beiträge zur Geschichte und Kultur des Inselklosters. Sigmaringen. (Thorbecke). 1974. Ln.mSU. 624 S. m.zahlr.Faltktn.