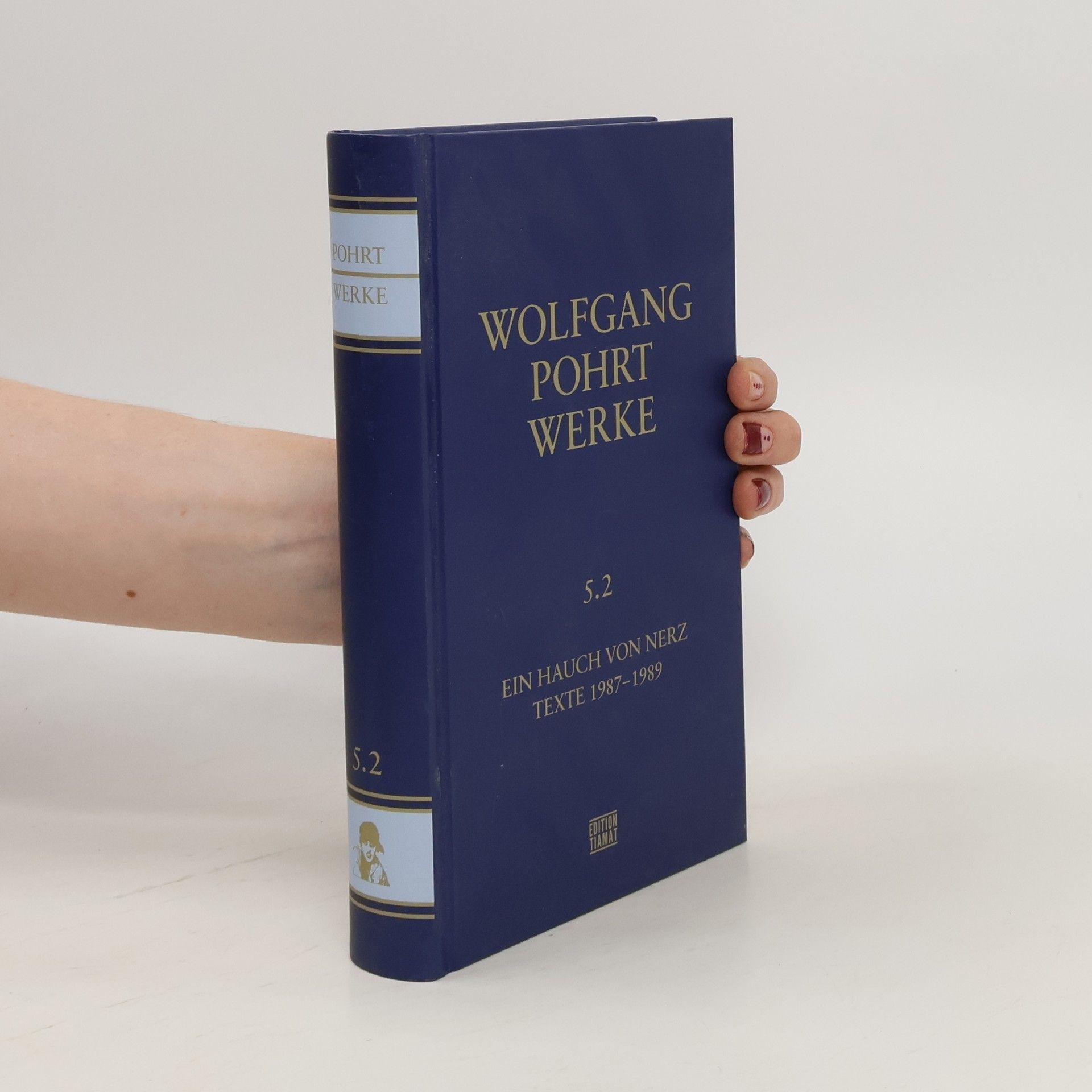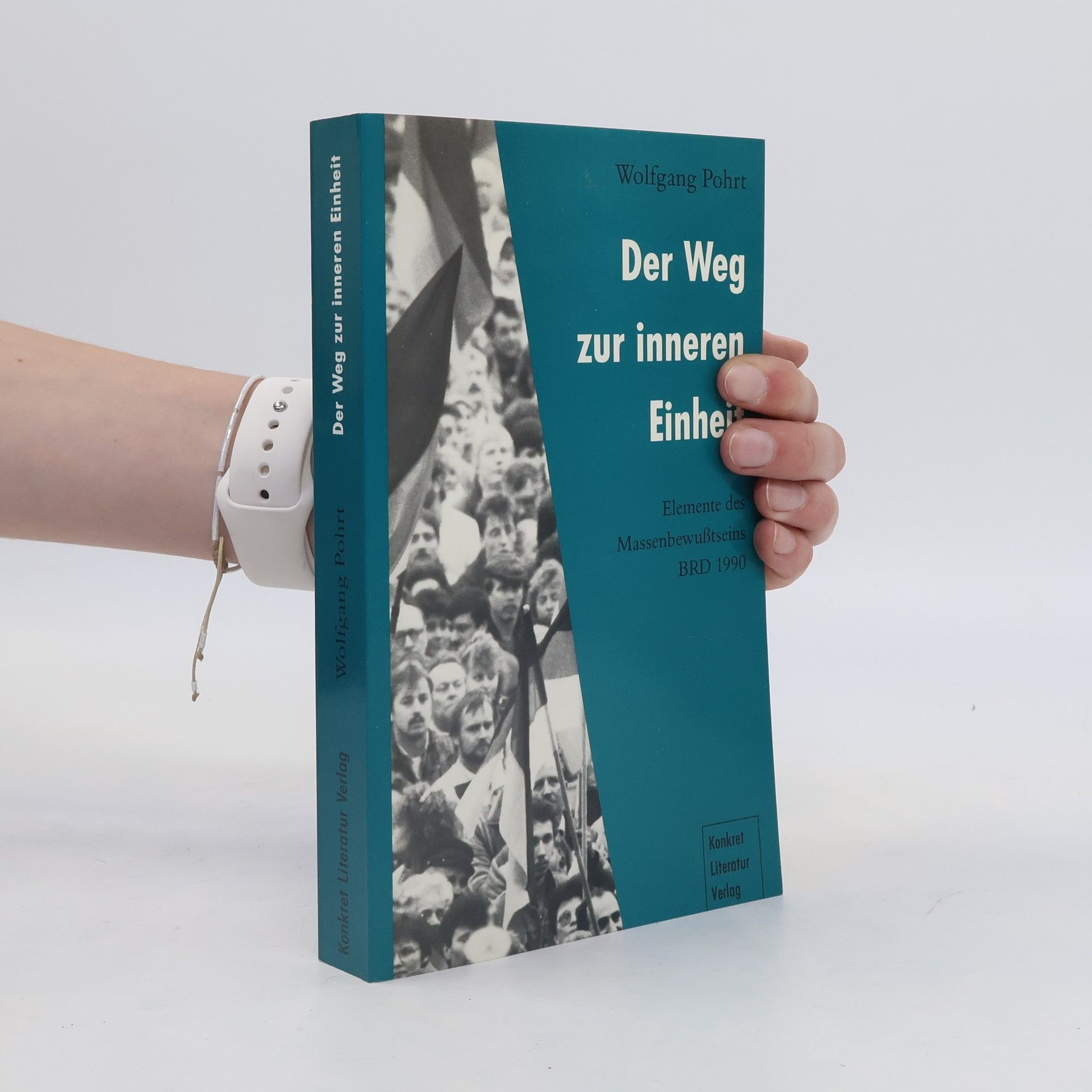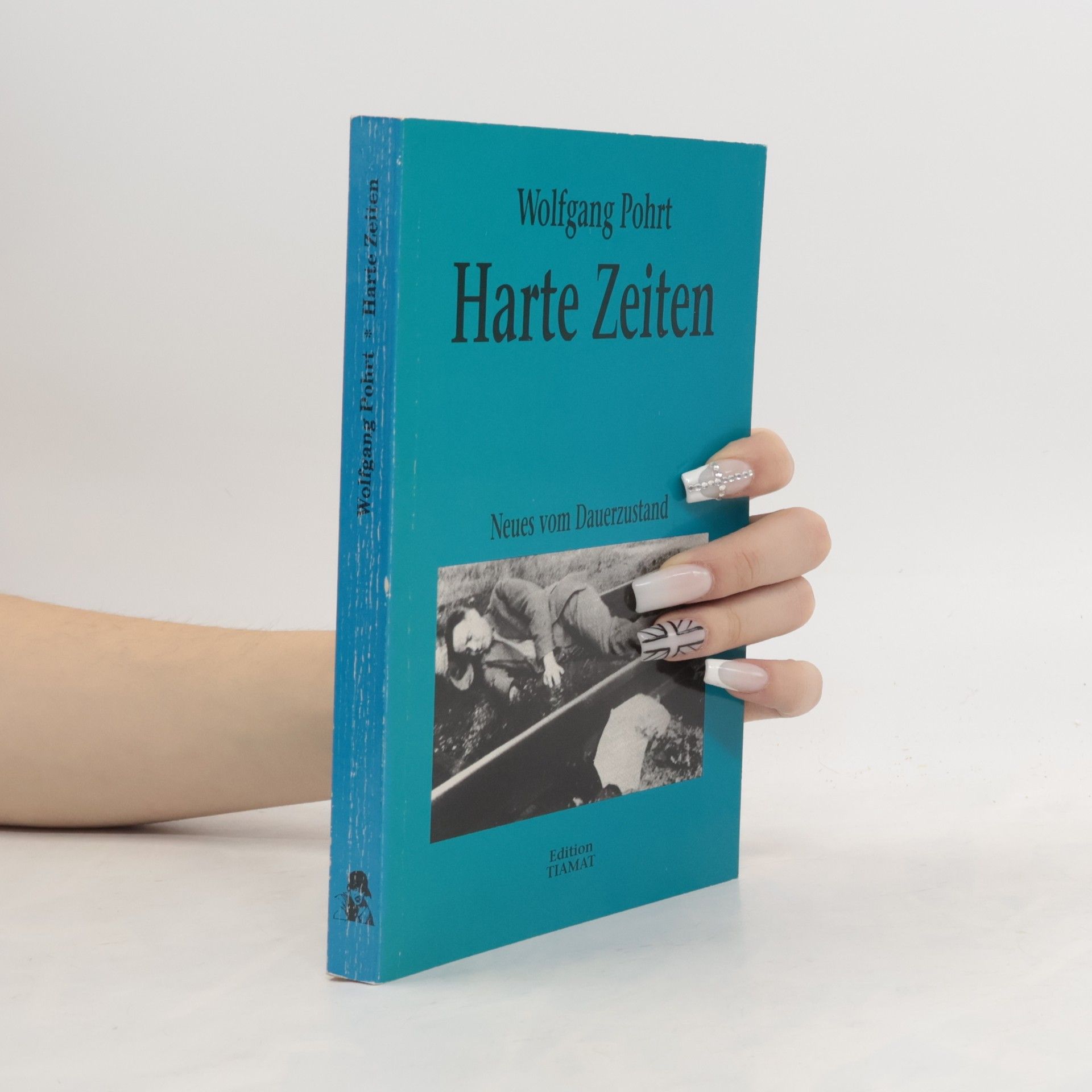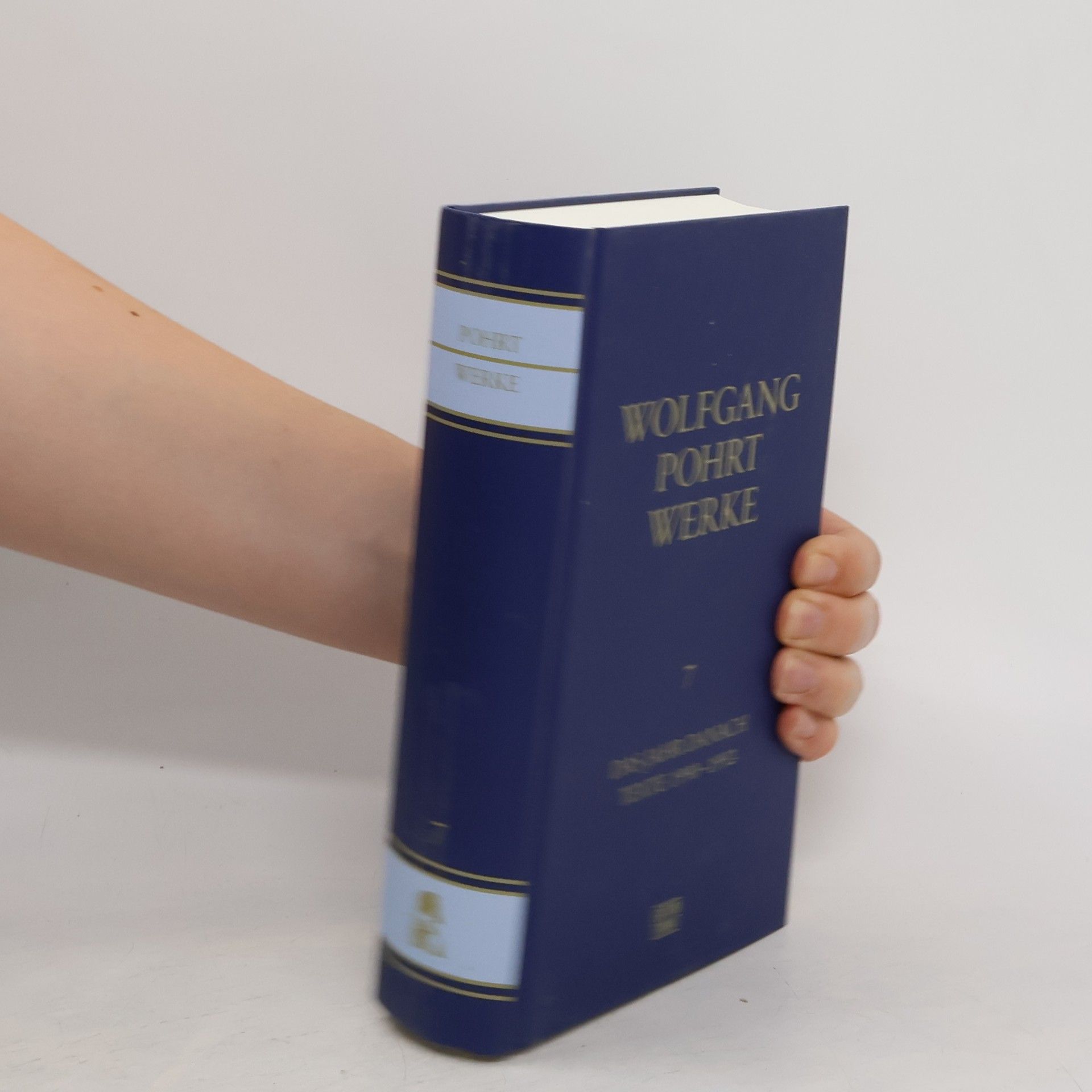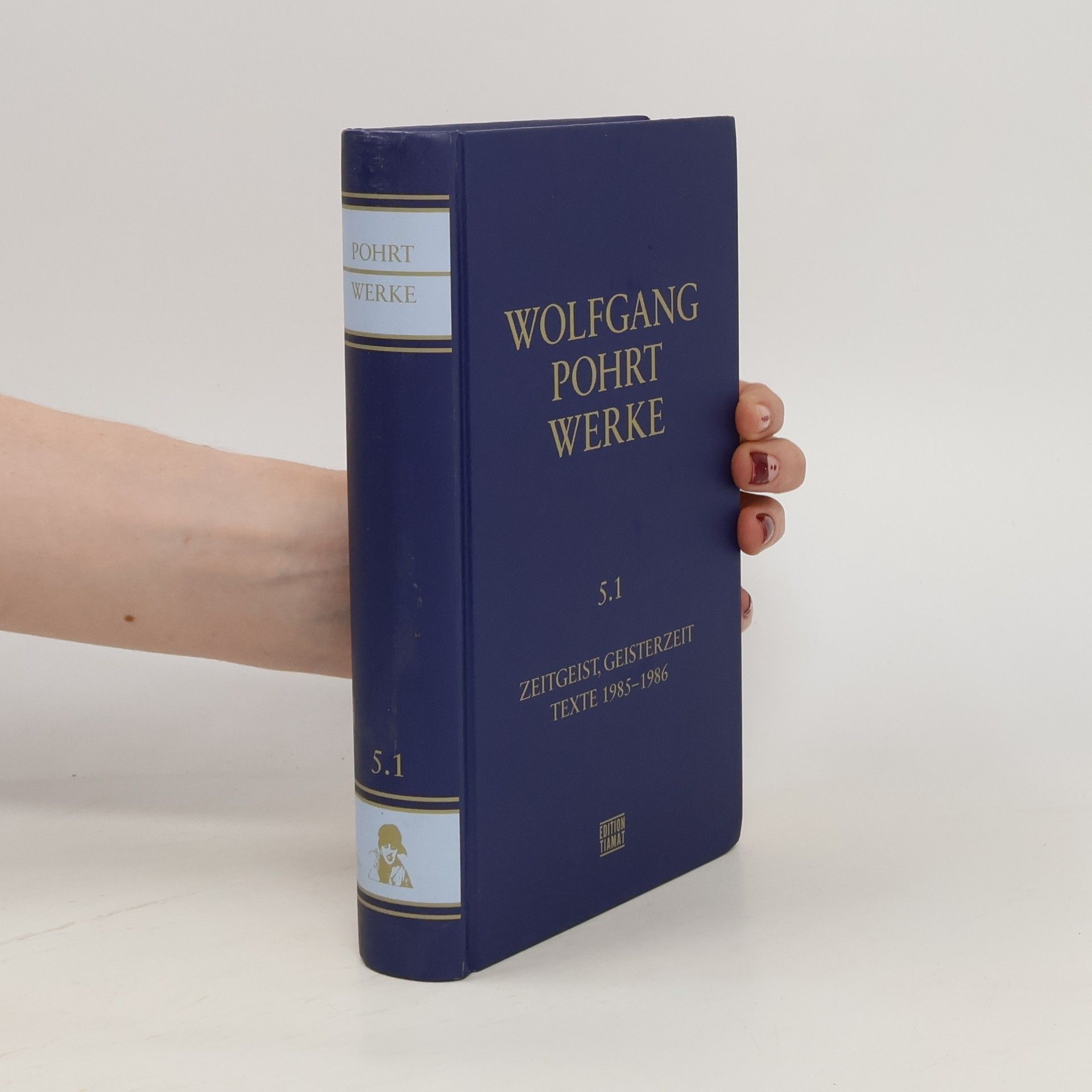Briefe & Mails 1976-2016
- 727 Seiten
- 26 Lesestunden
In seinen Briefen aus 40 Jahren lassen sich einzelne Aspekte seines Denkens besser verstehen, und man kann anhand seiner Korrespondenz nachvollziehen, was ihn als unabhängigen Geist antrieb, der kein Blatt vor den Mund nahm und den großen Teil des Kulturbetriebs gegen sich aufbrachte. Unfreundliche, lustige, polemische und liebenswerte Briefe u.a. an Wolfram Schütte, Henryk M. Broder, Ulrich Greiner, Hermann L. Gremliza und Konkret, Günther Anders, Oliver Tolmein, Dietmar Dath, Jürgen Elsässer, Götz Aly, Mathias Greffrath, Manfred Bissinger. Vor allem die Briefe in den Knast an Christoph Wackernagel geben Aufschluss über die RAF-Ideologie und die Amnestiekampagne Mitte der achtziger Jahre. Die Briefe an Jan Philipp Reemtsma sind Zeugnisse einer intensiven Auseinandersetzung über Folter, die Mentalität der Wiedervereinigungsdeutschen und die Berechtigung eines internationalen Strafgerichtshofs. Seine Entwicklung vom Journalisten und Sozialwissenschaftler bis hin zum desillusionierten Einsiedler lässt sich am besten an den Briefen an seinen Verleger ablesen, der ihm bis zu seinem Tod freundschaftlich verbunden war.