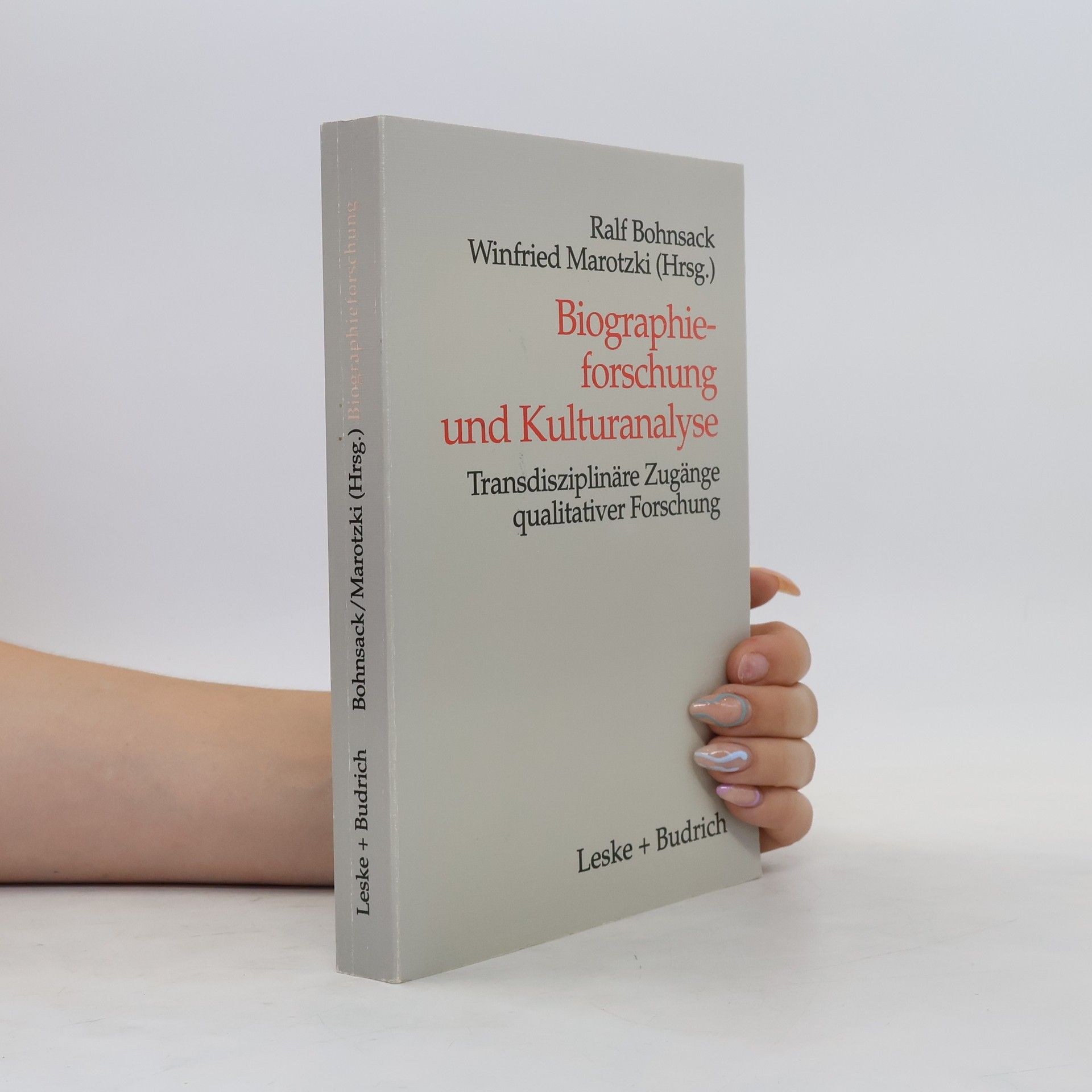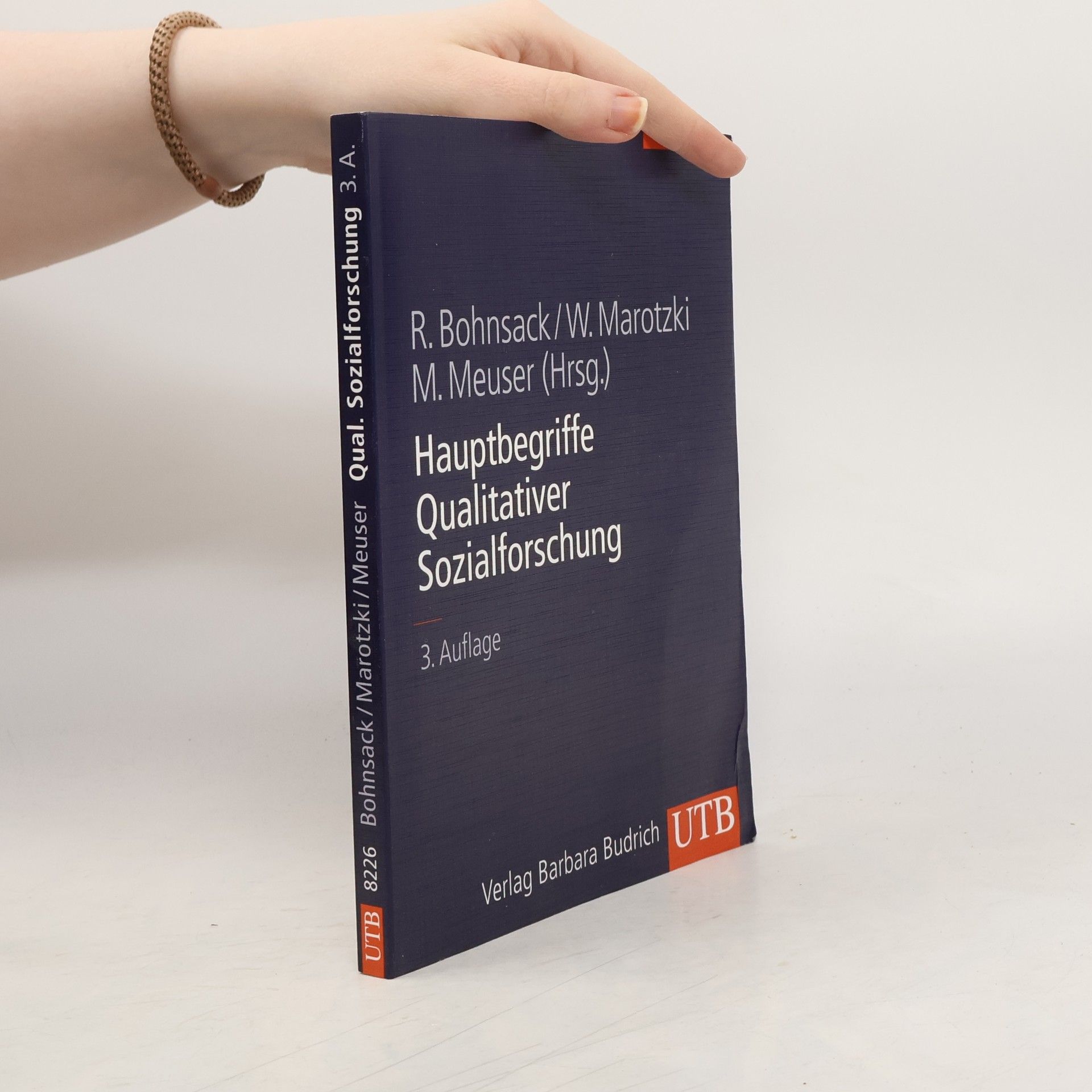Ralf Bohnsack Bücher






Professionalisierung in praxeologischer Perspektive
Zur Eigenlogik der Praxis in Lehramt, Sozialer Arbeit und Frühpädagogik
Praxeologie - die sozialwissenschaftliche Erforschung der Praxis alltäglichen Handelns Ralf Bohnsack skizziert bedeutsame Ansätze zur Professionalisierungstheorie und beleuchtet sie aus dem Blickwinkel der Praxeologie. Die Praxis in Lehramt, Sozialer Arbeit und der Frühpädagogik steht dabei im Fokus. Die Praxeologie gewinnt in den Sozialwissenschaften zunehmend an Bedeutung: Sie zeigt Wissenschaftler*innen die Logik ihrer eigenen Theorie auf und verdeutlicht, mit welchen Wirkmechanismen diese inhärente Logik in die Praxis hinein projiziert wird. Der Band bietet sowohl eine systematische Verknüpfung der Professionalisierungstheorie mit der Praxeologie als auch Lösungsvorschläge für die Praxis.
Die Gegenüberstellung von „qualitativ“ und „quantitativ“, die als zentrale Leitdifferenz die Auseinandersetzung in der empirischen Sozialforschung bestimmt, erscheint methodologisch wenig begründet. Zentrale Differenzen lassen sich eher mit der Gegenüberstellung von rekonstruktiven und standardisierten Verfahren fassen. Das Buch stellt drei zentrale Wege der rekonstruktiven Sozialforschung mit ihren Unterschieden und Gemeinsamkeiten vor (narratives Interview, objektive Hermeneutik und dokumentarische Methode) und diskutiert grundlegende Anforderungen, die an Methodologie und Forschungspraxis der rekonstruktiven Sozialforschung gestellt werden. Im Zentrum steht die vom Verfasser selbst als Forschungspraxis entwickelte dokumentarische Methode in ihren Anwendungsbereichen der Text und Bildinterpretation. Der Autor: Prof. Dr. rer. soc., Dr. phil. habil. Ralf Bohnsack, Dipl.-Soz., Leiter des Arbeitsbereichs Qualitative Bildungsforschung an der Freien Universität Berlin.
Die Theorie der Praxis und die Praxis der Forschung
Ralf Bohnsack im Gespräch mit Vera Sparschuh
Der Band bietet Einblicke in die Entstehungsgeschichte und die Grundgedanken der Rekonstruktiven Sozialforschung, insbesondere der Dokumentarischen Methode und ihrer Grundlagentheorie, der Praxeologischen Wissenssoziologie. Dies wird in der Form eines Dialogs und partiell in erzählerischer Form entlang der Biografie Ralf Bohnsacks entfaltet und eröffnet einen lebendigen Zugang zu methodischen und theoretischen Fragen gerade auch für deren Vermittlung in der Lehre. Im Zentrum steht dabei die Bedeutung der Praxis: Damit ist sowohl die Forschungspraxis, inkl. der Lehrforschung, gemeint als auch die Praxis derjenigen, die Gegenstand der Forschung sind. Erläutert wird dies an Beispielen aus den Forschungsbereichen Jugend, Jugendkriminalität und Jugendgewalt sowie Organisation und Professionalisierung.Im Zentrum stehen dabei die Forschungsmethoden der Gesprächsanalyse, der Bildinterpretation sowie der Video- und Filmanalyse
Praxeologisch-wissenssoziologische Professionsforschung
Perspektiven aus Früh- und Schulpädagogik, Fachdidaktik und Sozialer Arbeit
Konstituierende Rahmung und professionelle Praxis
Pädagogische Organisationen und darüber hinaus
Die Praxeologische Wissenssoziologie sowie die Dokumentarische Methode zeichnen sich durch fortdauernde Reflexion, Ausdifferenzierung und Weiterentwicklung ihrer Kategorien in der empirischen Auseinandersetzung aus. Im Zentrum stehen das Verhältnis zwischen propositionaler und performativer Logik sowie die Kategorie des konjunktiven Erfahrungsraums. Die Autor*innen bearbeiten dies für organisationale konjunktive Erfahrungsräume und fokussieren pädagogische Felder und solche der sozialen Arbeit.
Biographieforschung und Kulturanalyse
Transdisziplinäre Zugänge qualitativer Forschung
Inhaltsverzeichnis: I: Medien und öffentliche Inszenierungen. - Generation, Mediennutzungskultur und (Weiter)Bildung: Empirische Rekonstruktion medial vermittelter Generationenverhältnisse. - Wunder werden Wirklichkeit: Überlegungen zur Funktion der „Surprise-Show“. - „Let your body take control!“: Ethnographische Kulturanalyse der Techno-Szene. - Die ausgefransten Ränder der Rationalität: Ein bildungstheoretisches Strukturformat am Beispiel von Star Trek- und Akte X-Fans. - II: Biographien: Prozesse der Bildung und Wandlung. - Biographie, Lernen und Gesellschaft: Erziehungswissenschaftliche Überlegungen zu biographischem Lernen in sozialen Kontexten. - Kindheit und Biographie. - Erwachsenenbildung und Biographieforschung: Metamorphosen einer Beziehung. - „Protestantische Ethik“ im islamischen Gewand: Habitusreproduktion und religiöser Wandel — Beispiel der Konversion eines Afroamerikaners zum Islam. - III: Kulturelle Differenzierungen: Milieus und Geschlechterkulturen. - Biographieanalysen im Kontext von Familiengeschichten: Perspektive einer Klinischen Soziologie. - Habitualisierte Männlichkeit: Existentielle Hintergründe kollektiver Orientierungen von Männern. - Metaphernanalyse in der kulturpsychologischen Biographieforschung: Theoretische Überlegungen und empirische Analysen am Beispiel des „Zusammenschlusses“ von Staaten. - Adoleszenz und Migration: Empirische Zugänge einer praxeologisch fundierten Wissensoziologie. - Au
Dokumentarische Evaluationsforschung
Theoretische Grundlagen und Beispiele aus der Praxis
Die Dokumentarische Evaluationsforschung steht in der Tradition der dokumentarischen Methode von Karl Mannheim und Ralf Bohnsack und ist methodologisch und forschungspraktisch durch Ansätze der qualitativen Evaluation aus den Vereinigten Staaten inspiriert. In diesem Buch wird das methodische Potential an einer Vielfalt von Evaluationsgegenständen forschungspraktisch demonstriert.--Verlagstext
Hauptbegriffe qualitativer Sozialforschung
- 203 Seiten
- 8 Lesestunden
Führende VertreterInnen aus Soziologie und Erziehungswissenschaft erläutern die wichtigsten Begriffe qualitativer Methodik und Methodologie. Qualitative Methoden haben in den letzten Jahren in der empirischen Sozialforschung deutlich an Gewicht gewonnen. Vor allem innerhalb der jüngeren Generation von Studierenden der Sozialwissenschaften konnten sie einen enormen Zuwachs an Popularität erfahren. Umso dringender erforderlich ist eine Klärung der Begrifflichkeiten. Dies ist das Anliegen des Bandes, in dem in kurzen Artikeln die wichtigsten Begriffe qualitativer Methodik und Methodologie übersichtlich und verständlich erläutert werden.